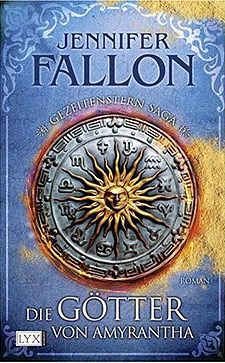
Jennifer Fallon: "Gezeitenstern-Saga 2: Die Götter von Amyrantha"
Broschiert, 574 Seiten, € 15,40, Egmont Lyx 2008.
Vor etwa 10.000 Jahren ist ein Häuflein Huren, Hehler und Hallodris über ein Trümmerstück aus dem Himmel gestolpert, mit dessen Hilfe sie Unsterblichkeit erlangten. Und zwar wirkliche Unsterblichkeit: Schlägt man einem von ihnen den Kopf ab, wächst er nach. Wirft man gleich den ganzen Unsterblichen in einen Vulkan (wofür es wahrlich gute Gründe en masse gäbe), entsteigt er der Lava: Vorübergehend leicht angekokelt, aber quicklebendig und mächtig angepisst - wehe dem Werfer! Neun der zwei Dutzend Unsterblichen haben über ihre Unverwüstlichkeit hinaus überdies Kräfte in apokalyptischem Ausmaß erhalten - und diese "nutzten" die sogenannten Gezeitenfürsten auch stets für höchst persönliche Belange. Wann immer sie aneinander krachten, erlebten die Bewohner von Amyrantha ein Weltenende - das letzte liegt ein Jahrtausend zurück. Der nichtige Anlass: Der Gezeitenfürst Brynden schleuderte seinem Nebenbuhler Cayal aus Eifersucht einen Meteoriten hinterher. Die Folge: Millionen Menschen starben, die Zivilisation versank einmal mehr im Chaos.
Doch die Macht der Unsterblichen bzw. Suzerain ist an den Gezeitenstern gebunden: Herrscht kosmische Flut, ist sie unbegrenzt - bei Ebbe bleibt den Suzerain zwar die Fähigkeit zur Selbstregeneration erhalten, darüber hinaus sind sie dann aber ganz normale Menschen und gezwungen, bis zur nächsten Flut inkognito unter den Sterblichen auszuharren (was ihre Laune keineswegs bessert). - Viele Jahrhunderte lang herrschte nun Ebbe, und die Gezeitenfürsten sind zur Legende verblasst. Nur im Kartenspiel Tarot wird eine verzerrte Erinnerung an sie wachgehalten - und wie es beispielsweise kam, dass just die beiden Schlampen Diala und Jaxyn als "Die Hohepriesterin" und "Der Fürst der Askese" in die Überlieferung eingingen, ist eine von vielen Episoden, die Jennifer Fallon im großartigen ersten Teil der "Gezeitenstern-Saga" schilderte (mehr dazu hier). Anders als "Der Unsterbliche Prinz" bewegt sich "Die Götter von Amyrantha" aber nicht mehr zu beinahe gleichen Anteilen auf einer Vergangenheits- und einer Gegenwartsebene, sondern konzentriert sich anhand eines großen Figurenensembles auf das aktuelle Geschehen: Denn die Flut kehrt zurück und die Unsterblichen machen ihre ersten Spielzüge.
Fürstin Arkady Desean, deren Begegnung mit Cayal in Band 1 die grausige Wahrheit enthüllte, dass die Gezeitenfürsten kein nettes Märchen sind, musste ihrem schwulen Ehemann als Alibi-Gattin auf diplomatische Mission folgen. Und sich nicht nur damit abfinden, dass im südlichen Torlenien Frauen in der Öffentlichkeit ganzkörperverhüllt zu sein haben (eine "kulturelle Tradition", die - wie könnte es anders sein - einst ein Gezeitenfürst aus einer eigensüchtigen Laune heraus etablierte), sondern auch damit, dass sich hier heimlich Unsterbliche eingenistet haben und nach weltlicher Macht streben. - Genauso wie im heimatlichen Glaeba und dessen Nachbarreich Caelum: Declan Hawkes, Erster Spion des glaebischen Königs, und die Tiermenschen Warlock und Tiji kämpfen an vorderster Front gegen die stille Usurpation - und langsam aber sicher geraten die Sterblichen ins Hintertreffen.
"Die Götter von Amyrantha" bezieht seine Spannung aus einer komplexen Gemengelage aus Loyalitäten und Rivalitäten: Menschen können Suzerain nicht von Normalsterblichen unterscheiden, Crasii-Sklaven wie Warlock und Tiji hingegen erkennen die Suzerain am Geruch. Leider sind die Tiermenschen aber einst von den Unsterblichen erschaffen worden und unterliegen einem genetisch aufoktroyierten Befehl zum absoluten Gehorsam gegenüber ihren Schöpfern. Davon ausgenommen ist nur eine kleine Gruppe der Crasii, die Arks: Zu ihrem Glück sind sie nicht von anderen Artgenossen unterscheidbar - ob sie den Befehlen eines Unsterblichen gegenüber immun sind, merken sie selbst allerdings erst in der direkten Konfrontation. Und um das Maß vollzumachen, halten die Suzerain ihre Operationen nicht nur vor den Menschen, sondern auch voreinander geheim. Denn fast alle von ihnen giert es nach einem Leben in Macht und Luxus, was sie zu direkten KonkurrentInnen werden lässt. - Jennifer Fallon entwickelt daraus ein facettenreiches Spiel der Täuschungen und Enthüllungen, lässt die LeserInnen über Identitäten rätseln und lockt sie geschickt auf Fährten, die sich perfiderweise zwar als richtig erweisen, aber nur als Tarnung für gänzlich Unerwartetes dienten: Band 2 wartet mit einem noch größeren Knalleffekt auf als sein Vorgänger.
Als Kirsche auf dem Cocktail ist das Ganze auch noch in einem so munteren Ton erzählt (respektive in glänzender Weise übersetzt), dass es einen nur so über die Seiten fliegen lässt. Besonders gelungen die Dialoge der ProtagonistInnen - man gewinnt den Eindruck, als hätten sich die Erkenntnisse amyranthischer Entsprechungen von Freud und Kinsey in den Hinterköpfen der Beteiligten ebenso fest verankert, wie sie bei uns in die Konversation einfließen. Aber Achtung: Wortwitz ist etwas gänzlich anderes als humoristische Erzählweise. Das Geschehen selbst ist alles andere als lustig: Denn in all den Jahrtausenden haben die Unsterblichen weder an Weisheit noch an menschlichem Niveau gewonnen - und schon gar nicht an Mitleid. Mit Nonchalance nehmen sie zur Verwirklichung ihrer Pläne Massenmord hin, und die paar Verzweifelten, die ihnen gegenübertreten, blicken mit Grauen in die Zukunft. - Während wir mit ungetrübter Vorfreude den weiteren Bänden der Tetralogie entgegen sehen dürfen ... so zynisch ist die Welt.
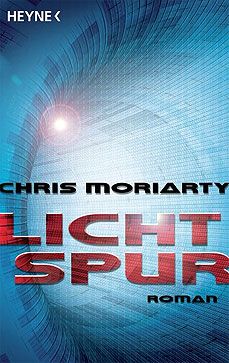
Chris Moriarty: "Lichtspur"
Broschiert, 701 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.
"Spin State" heißt der 2003 erschienene Debütroman der US-Amerikanerin Chris Moriarty im Original - und überlässt es der Interpretation der LeserInnen, ob sich der Titel auf Quanten-Spins bezieht, da sich im Roman die menschliche Zivilisation mithilfe von Quantentechnologie über einige Sternensysteme ausgebreitet hat. Oder ob es eher - im Sinne von spin doctors - um die Manipulation von Meinungen geht: Denn die "Lichtspur" wird nicht nur von einer Reihe unterschiedlichster Manipulatoren, die ihre Pläne und ihr Mehrwissen geschickt verbergen, verdunkelt - Erinnerungen selbst können verändert werden. Hat ein Mensch einen überlichtschnellen Quantentransport bzw. Bose-Einstein-Sprung absolviert, muss seine dabei zumindest teilweise verloren gehende Erinnerung aus Backups rekonstruiert werden. Und Passagen, die unter behördliche Zensur fallen, können gestrichen werden, wie die Hauptfigur Catherine Li am eigenen Leib erfährt.
Moriarty ballert einem gleich zu Beginn eine vor den Latz und beschreibt die Vorbereitung einer vernetzten Einsatzbesprechung wie folgt: Ein regelrechtes Sperrfeuer von Statusmeldungen blitzte in Lis Augenwinkeln auf und unterrichtete sie darüber, dass die Relaisstation gerade eine Verschränkung aufbaute, einen Spinschaum-Kanal einrichtete, Spincastings durchführte, Spinbits mit E-bits abglich, eine Sharifi-Transformation einleitete, nicht-triviale Spin-Abweichungen korrigierte und den replizierten Datenstrom an jene fernen Segmente von Cohens Netzwerk weiterleitete, die diese Einsatzbesprechung überwachten. - Das ist aber weniger ein Schreckschuss als eine Orientierungshilfe, um sich klarzumachen, dass die BürgerInnen von Moriartys Zukunftswelt mittels Körperimplantaten nahezu permanent online sind. Cyberpunk war allerdings gestern, denn hier hat die Software längst aus dem virtuellen Raum übergegriffen und die Gestaltung der realen (...) Welt übernommen: Virufaktur-Bodenkrume, Von-Neumann-Sonden und Viruglobuli terraformieren die Kolonialplaneten, und nicht ein einziges Mal bewegen sich die ProtagonistInnen in einer Umgebung, die wir als natürlich empfinden würden (selbst die toughste Großstadpflanze wird nach der Lektüre von "Lichtspur" das Bedürfnis verspüren, raus aufs Land zu radeln und sich im Gras zu wälzen ...).
Hier finden wir uns mitten im Transhumanismus wieder, wo die Grenzen, was ein Mensch sei und was nicht, mehr und mehr verschwimmen: Künstliche Intelligenzen genießen Bürgerrechte und betreiben handfeste Politik - etwa Lis ebenso dandyhafter wie dubioser Kompagnon Cohen, der sogar schon mehrere Ehen geführt hat. Körperlicher Kontakt ist ihm - wie anderen KIs, aber auch Menschen - möglich, wenn er im Overlay-Modus einen Menschen als lebendes Interface benutzt. Weniger Rechte haben da schon Genkonstrukte (wie auch Li eines ist: ein Geheimnis, das sie ängstlich wahrt), also Menschen, die zum Teil oder ganz aus patentiertem Zellmaterial gezüchtet wurden. Die Gründe für deren Diskriminierung sind vor allem politische, denn einige Genkonstrukte haben sich aus dem Raum der UN-Verwaltung gelöst und die Syndikate gebildet: Nicht nur ein konkurrierendes Staatengebilde, sondern möglicherweise auch eine neue Zivilisation, die Ansätze zu einer Kollektivintelligenz zeigt. - All das mag manchen erschreckend erscheinen, aber auch unsere Normalität ist schließlich eine relative: Li beispielsweise erschaudert beim Anblick eines Ledersessels und findet den Gedanken, ein Möbelstück mit Säugetierhaut zu überziehen, "einschüchternd dekadent".
Die in "Lichtspur" geschilderten Rahmenbedingungen sind im Grunde interessanter als die eigentliche Handlung: UN-Friedenssoldatin Li wird zur Klärung eines Mordfalls in "Mission Impossible"-artiger Manier auf den Bergwerksplaneten geschickt, auf dem die Bose-Einstein-Kondensate abgebaut werden, ohne die die gesamte menschliche Technik perdü wäre. Gewonnen werden sie übrigens von Menschen unter unmenschlichen Bedingungen: Kinderarbeit ist zugelassen, Gewerkschaften nicht und die Bergleute müssen ihre Atemluft kaufen - aber schließlich hat sich die Inhabergesellschaft von Comptons Planet auch gegen die Unterzeichnung der Menschrechtskonvention entschieden, es lebe die New Economy! In dieser Hölle, die kaum jemanden älter als 40 werden lässt, stellt Li fest, dass so gut wie jeder, der ihr begegnet, verborgene Agenda fährt - was die Handlung bisweilen etwas unübersichtlich (und auch lang) macht. - Sehr gut gelungen ist Moriarty hingegen das Spiel mit persönlichen und sexuellen Identitäten, was "Spin State" auch eine Reihe von Preisnominierungen eingebracht hat; der Folgeroman "Spin Control" wird im Februar als "Lichtjagd" auf Deutsch erscheinen.
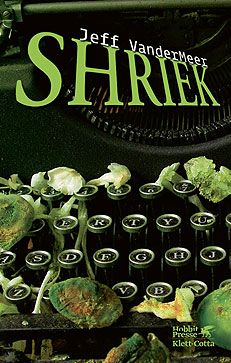
Jeff VanderMeer: "Shriek"
Kartoniert, 488 Seiten, € 25,60, Klett-Cotta 2008.
Dieses Buch hat drei AutorInnen und zwei davon tragen den Nachnamen Shriek - der dritte ist Star-Autor Jeff VanderMeer, der nach "Stadt der Heiligen und Verrückten" einmal mehr in die Gewölbe unter der Stadt Ambra hinabsteigt und sie zum Schauplatz einer formidablen Erzählung macht.
Geschrieben ist "Shriek" als Buch-im-Buch, und eines gleich vorneweg: Falls sich die Ausgangslage ein wenig kompliziert anhören sollte - der Lesefluss (respektive Sog) wird durch die mehrschichtige und sich selbst reflektierende Erzählung in keinster Weise abgebremst. Im Original trägt das Buch den Titel "Shriek: An Afterword", denn es handelt sich um ein ausführliches Nachwort, das die Ambraer Galeristin und Partylöwin Janice Shriek zum Werk "Hoegbottons Führer zur Frühgeschichte der Stadt Ambra" ihres unter der Erde verschollenen Bruders Duncan verfasst hat. - Der jedoch zu einem späteren Zeitpunkt, da Janice ihrerseits verschwunden ist, kurzfristig wieder aufgetaucht sein muss, das Manuskript seiner Schwester in die Hände bekommen hat und ihre Überlegungen kommentiert (im Text sind seine Passagen durch geschwungene Klammern {} kenntlich gemacht). Aus den wechselnden Perspektiven der beiden erschließt sich die im Großen und Ganzen chronologische Biografie des Geschwisterpaars und der Geschichte Ambras über einige Jahrzehnte hinweg. Ein surrealer Effekt ergibt sich daraus, dass beide ErzählerInnen gewissermaßen "nicht mehr da" sind - und die Stellen, an denen sie sich auf ihre aktuelle Situation während des Schreibens beziehen, deuten ominöse Vorgänge an: Janice tippt ihren Text in eine Schreibmaschine, die langsam von Pilzen überwuchert wird, und spricht von dem Wandel in Ambra - Duncan wiederum durchläuft die letzten Stadien eines körperlichen und geistigen Verwandlungsprozesses, ausgelöst ebenfalls von Pilzen.
Mit Ambra hat der kosmopolitische US-Amerikaner Jeff VanderMeer eine traumartige Metropole geschaffen, die sich jeglicher Einordnung entzieht: Das Telefon hält als neue Erfindung Einzug, während Motorfahrzeuge nach einem Jahrhundert kaum noch im Stadtbild vertreten sind. "Die Welt ist zerbrochen. Gott ist in der Verbannung" lauten die Kernsätze der verbreitetsten Religion, und alljährlich lassen die BewohnerInnen der in einem sumpfigen Flussgebiet liegenden Stadt beim "Fest des Süßwasserkalmars" die Masken der Zivilisation fallen - vor 200 Jahren verschwanden dabei 25.000 Menschen ohne jede Spur: ein Ereignis, das als die Stille in die Geschichte einging. Neben Menschen bewohnen auch einige Angehörige anderer Spezies die Stadt - und tief unter ihr leben die stummen Grauhüte. Sie waren die ursprünglichen Bewohner des Gebiets, ehe sie von den Menschen unter die Erde getrieben wurden. Doch Duncan ist sich sicher, dass sie die Oberwelt über Sporen und Insekten beobachten und heimlich beherrschen: In einer Vision hat er eine gigantische Maschine, die von Dali ersonnen sein könnte, gesehen und glaubt, dass sie mit dem kommenden Wandel in Verbindung steht.
In einem Interview relativierte VanderMeer Sichtweisen "Shrieks" als rein idiosynkratische Schöpfung und verwies unter anderem auf die kolonialistische Handelspolitik der USA und die Folgekriege von 9/11 als Bezüge für sein zwischen 1998 und 2005 gewachsenes Werk (die Kapitel über den in Ambra ausbrechenden Bürgerkrieg zwischen zwei Handelshäusern sind übrigens auch die, in denen er seine volle erzählerische Wucht entfaltet). Augenfälliger ist aber natürlich die Verbindung zwischen Unterirdischem und Unterbewusstem: Duncan vergleicht seine Expeditionen in die Höhlensysteme der Grauhüte explizit mit dem Schreiben eines Buchs. Außen- und Innenwelt durchdringen einander wie das Myzel der allgegenwärtigen Pilze, die sich in menschlichen Körpern einnisten und die Persönlichkeit der Befallenen verändern. Ein Rausch!
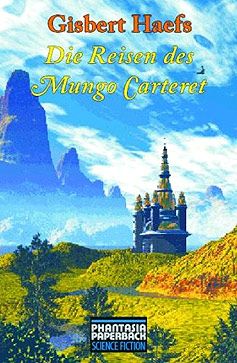
Gisbert Haefs: "Die Reisen des Mungo Carteret"
Broschiert, 167 Seiten, € 13,30, Edition Phantasia Bellheim 2007.
Auf den ersten Seiten ist Konzentration gefragt: Bei "Wanderlust" einzusteigen hat etwas von dem Gefühl der Orientierungslosigkeit, das einen beschleicht, wenn man verspätet beim Dinner erscheint und versucht, dem bereits laufenden Tischgespräch der Sitznachbarn zu folgen. Der Alltag im Jahre 2878 ist nämlich bunt - und in der zwischenmenschlichen Kommunikation befleißigt man sich eines Gebräus aus Aphorismenseligkeit und flapsigem Neusprech, da heißt es erst mal durchsteigen. Für Hintergrundwissen zum beschriebenen Kosmos setzt Gisbert Haefs Fußnoten - und selbst hält der Autor bildungsbürgerliche Tugenden genauso hoch, wie es seine Figuren tun: Eben noch wird ein Bild aus Grass' "Blechtrommel" übernommen, schon ist Kants Kategorischer Imperativ an der Reihe, durch den Kakao gezogen zu werden. Anspielungen sind in den insgesamt fünf Kurzgeschichten, die aus den Jahren 1989 bis 2007 stammen ("Tischgenossen" wurde in diesem Band erstmalig veröffentlicht), reichlich enthalten.
Aristide "Mungo" Carteret ist ein typisches Kind seiner Zeit: Ein Genussmensch in Sachen Essen, Wein und Frauen. In seinem einigermaßen tabulosen Umgang mit dem Thema Sex ist Haefs' galaktischer Commonwealth jedenfalls ein erfreulich unverkrampfter Gegenpol zu "Star Trek" und ähnlichen kosmischen Klemmgesellschaften. Wenn auch nicht alle Galaktiker so beglückt sein können wie die pflanzlichen qlf vom Planeten Setebos, die in einem annähernden Dauerorgasmus durch die Gegend stelzen und ihre Kitzligkeit gegenüber Bodenbeschaffenheiten Rohstoffsuchern als "Libidetektoren" zur Verfügung stellen ... Sie bilden den Hintergrund für einen der Fälle, die Weltraumdetektiv Carteret zu lösen hat: Er ermittelt überall da, wo der galaxisweite Servis Investigativo del Commonwealth aus formalen Gründen nicht aktiv werden kann. Wie z.B. auch bei einem Mordanschlag im Rahmen eines dekadenten Gift-Dinners unter Grandgourmets ("Mundwerk") oder einer Selbstmordserie unter Konsumenten der Droge "Seelenkot".
Skurrilität scheint Trumpf - durchaus auch zu Lasten der Erzählung. Weite Strecken, vor allem der älteren Geschichten, erschöpfen sich in Aufzählungen wie Speisekarten, Auszügen aus galaktischen Enzyklopädien sowie Gäste- und Ladelisten, die einzig die Funktion erfüllen, möglichst viele absurd-überkandidelte Begriffe aneinander zu reihen. Siehe auch "Heimweh", das auf einem Planeten spielt, auf dem alle topografischen Bezeichnungen Hundebezug haben: Baskerville, Kynoborg, Corgy & Bess (okay, der war gut), Welping, usw. usf. Kann man lustig finden. Muss man nicht. Auf Dauer erschöpfen sich die Gags jedenfalls - zumindest dann, wenn der eigentliche Fall dann eher beiläufig gelöst wird. In den beiden jüngsten Geschichten hat Haefs, neben seinen Ausflügen in die SF immerhin vor allem ein erfolgreicher Krimi-Autor, die Extravaganzen daher auch ein wenig zurück genommen und sich mehr auf die Entwicklung der Geschichte konzentriert.
Fazit: Was für einmal einen originellen Gegenentwurf zu herkömmlichen Erzählweisen bietet ("Wanderlust" wurde 1990 mit dem Kurd Laßwitz Preis ausgezeichnet), braucht in der Wiederholung zusätzliche Substanz, um mehr zu sein als das anfangs erwähnte Tischgespräch: Etwas, das amüsant und mit Esprit um nichts kreist.
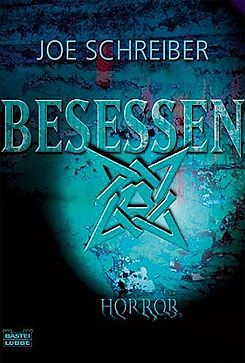
Joe Schreiber: "Besessen"
Broschiert, 253 Seiten, € 8,20, Bastei Lübbe 2008.
Wenn sich Joe Schreibers neuer Roman von Anfang an durch etwas auszeichnet, dann ist es Tempo: Binnen weniger Seiten sind die Figuren auf dem Spielfeld platziert, und bis zum Ende wird dieses auch niemand mehr verlassen. Bei diesem genau abgegrenzten Feld handelt es sich um das Tanglewood Memorial Hospital, ein Krankenhaus irgendwo in Pennsylvania, das einen Tag vor der Schließung steht: Arbeiter haben bereits die Fenster mit Spanplatten abgedichtet, alle PatientInnen und ein Großteil des Inventars sind längst weg.
Nur mehr eine Rumpfbesetzung hält die Stellung, darunter die Hauptfigur Mike Hughes, ein - vermutlich - MRT-Techniker Mitte 30: Explizit wird sein Beruf nie erwähnt, aber aus der Handlung und dem Umstand, dass Joe Schreiber selber seit ein paar Jahren an einem Magnetresonanztomographen arbeitet, lässt sich das ableiten. Bei Mike sind noch seine Kollegin Jolie Braun, der Wachmann Steve Calhoun und der Arzt Walker. Und es kommt zweimal unerwarteter Besuch: Mikes Ehefrau Sarah samt ihrem dreijährigen Sohn Eli - und eine Abordnung Polizisten (Kanonenfutter, argwöhnt man gleich ...), die den inhaftierten Serienmörder Frank Snow zur Untersuchung im Kernspintomographen bringen.
Danach geht es Schlag auf Schlag: Snow kommt unter äußerst mysteriösen Umständen frei, die Beleuchtung fällt aus - und in der Folge werden alle Genannten damit beschäftigt sein um ihr Leben zu rennen. Atemlos hetzen die ProtagonistInnen, durch geschickt gesetzte Handlungsentwicklungen voneinander getrennt, durch die dunklen Korridore - vorwärts getrieben nicht nur von ihrer Angst, sondern auch von Hinweisen Snows, der sie wie ein perverser Spielleiter von Feld zu Feld schiebt (ein Motiv, das Schreiber schon in seinem Debütroman "Chasing the Dead"/"Untot" verwendete und hier noch verstärkte). Informationen erhält der Leser nur bruchstückhaft und aus der jeweiligen Perspektive der Betroffenen: "Besessen" ist gleichsam das literarische Äquivalent eines mit der Wackelkamera gedrehten Films. Die extreme räumliche und zeitliche Verdichtung sorgt für Geschwindigkeit - nochmals unterstrichen dadurch, dass die 253 Seiten des Buchs in beinahe 60(!) gehetzte Kapitel zerhackt sind.
Zu bemängeln ist nur etwas, für das Schreiber selbst gar nichts kann: schon wieder (siehe Neal Ashers "Hilldiggers"/"Kinder der Drohne" in der vorigen Rundschau, ebenfalls bei Bastei Lübbe erschienen) hat ein Roman für seine deutschsprachige Ausgabe einen Titel verpasst bekommen, der den Interpretationsspielraum unnötig einschränkt. Im Original heißt "Besessen" nach einem Zitat aus Ray Bradburys "Something Wicked This Way Comes" nämlich "Eat the Dark": viel angemessener für eine Geschichte, die uns zusammen mit den ProtagonistInnen durchs Dunkel treibt. Ein typischer In-einem-Durchleser bleibt's dennoch.
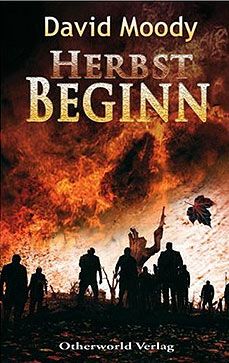
David Moody: "Herbst. Beginn"
Broschiert, 291 Seiten, € 10,30, Otherworld 2007.
2001 geschrieben - nahezu zeitgleich arbeitete Danny Boyle an seinem Film "28 Days Later" - stand "Autumn" am Beginn des Neo-Zombie-Booms: Erst als Gratis-Download erhältlich, später wegen des überraschenden Erfolgs auch in Buchform erschienen. Drei weitere Romane sind seitdem herausgegeben worden, ein vierter soll demnächst folgen und Teil 1 wurde gerade eben verfilmt. Der Brite David Moody hat offensichtlich eine Erfolgsgeschichte gelandet - und "Herbst. Beginn" zeigt auch, warum.
Um einen interessanten Genre-Roman zu schreiben, braucht man entweder eine originelle Grundidee oder bringt eine überzeugende Umsetzung einer schon bekannten zustande. Auch bei Moody wandeln also die Toten, doch - erste Überraschung - sie wandeln davon. Jedenfalls werden die wenigen Überlebenden eines Virus, das blitzartig über den Globus gezogen ist, nicht augenblicklich angefallen, nachdem sich ein Teil der Leichen, die die Straßen bedecken, wieder erhebt und ziellos durch die Gegend wankt. Ohne Beißattacken. 95 Prozent der Bevölkerung sollen tot sein - vielleicht auch mehr, denn von den 19.000 EinwohnerInnen des nordenglischen Städtchens Northwich finden sich gerade einmal 26 in der Whitchurch Community Hall ein, um gemeinsam den Schock der Katastrophe zu bewältigen. Konflikte sind in der klaustrophobischen Situation vorprogrammiert.
Drei beschließen auszubrechen: Der Reparaturarbeiter Carl Henshawe, der Angestellte Michael Collins und die Medizinstudentin Emma Mitchell, die schon von Beginn an hervorgehoben wurden, indem das Eintreten der Katastrophe kurz aus ihrer jeweiligen Sicht geschildert wurde - auch später springt der Roman gelegentlich von der auktorialen Erzählweise zu wechselnden Ich-Perspektiven. Mit der Expedition der drei ProtagonistInnen begibt sich "Autumn" auf ein Gebiet, das in Großbritannien ehrwürdige Tradition hat: Schon in John Wyndhams "The Triffids", Samuel Youds "The Death of Grass" oder J.T. McIntoshs "The Fittest" - drei Beispiele aus den 50ern - schlugen sich Menschen auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort zum Verschanzen durch ein post-apokalyptisches England. Und auch wenn diese zur Science Fiction gezählt werden und "Autumn" unter Horror läuft, sind die grundlegenden Abläufe der Erzählung die gleichen. Dass sich Moody Genre-bedingt weniger Mühe zur Plausibilisierung des Bedrohungsszenarios machen muss (ein schon in seiner Wirkungsgeschwindigkeit biologisch unmögliches Virus, von der Reaktivierung der Toten ganz zu schweigen), spielt da vergleichsweise nur eine untergeordnete Rolle. - Spannend nebenbei bemerkt, wie sehr sich das Bild von Mensch und Gesellschaft in einem halben Jahrhundert verändert hat: Wo die Romane der 50er noch mit Autoritätsfiguren oder zumindest Menschen mit Wissensvorsprung aufwarteten, die gleich nach der Katastrophe Konzepte für die Zivilisation danach entwarfen (und beinhart umsetzten), bleiben die Hauptfiguren Moodys ohne Hintergrundinformationen und auf sich allein gestellt.
"Herbst.Beginn" fokussiert auf einige wenige Personen, aus deren Hoffnungen, Erinnerungssplittern und zwischenmenschlichen Konflikten es seine Glaubwürdigkeit bezieht. Und einen Teil der Spannung - nicht die ganze allerdings, denn beizeiten merken Carl, Michael und Emma noch, dass es nicht damit getan sein wird, in aller Ruhe den Toten beim Verrotten zuzusehen ... - Wer das ausgesprochen fesselnde Leseerlebnis ohne Zeitverlust verlängern möchte: Im September ist auch schon das zweite Buch aus Moodys "Autumn"-Reihe ("Herbst. Stadt", ebenfalls bei Otherworld) erschienen.
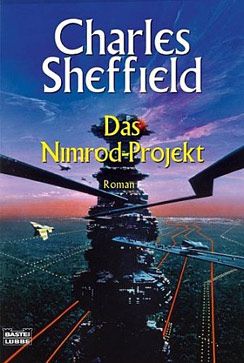
Charles Sheffield: "Das Nimrod-Projekt"
Broschiert, 556 Seiten, € 9,20, Bastei Lübbe 2008.
Die Nachlassbearbeitung des 2002 verstorbenen Autors Charles Sheffield bei Bastei Lübbe hält an: Nach dem kompletten "Heritage"-Zyklus werden nun auch Einzelromane wie das 1993 erschienene "Mind Pool" veröffentlicht - das seinerseits eine ungewöhnliche Vorgeschichte der Überarbeitung und Wiederveröffentlichung hinter sich hat. Sheffield selbst hat ein auch in der deutschen Version enthaltenes Vorwort geschrieben, in dem der sowohl mit "Hugo" als auch "Nebula" ausgezeichnete Autor diese Entstehungsgeschichte schildert.
Zur Handlung: Einige Jahrhunderte in der Zukunft bildet das Sonnensystem der Menschheit (Achtung, nicht die Erde!) den Mittelpunkt der Stellar-Gruppe, der noch drei außerirdische Völker angehören: die Tinker (bzw. Tinker-Komposita, da es sich um Schwarmwesen mit Gemeinschaftsintelligenz handelt), die arthropoden Pipe-Rillas und die symbiotischen Engel. Sheffield hat sich um möglichst exotische Lebensformen bemüht - und unterstreicht damit noch die Sonderrolle der Menschen. Denn so sehr sich die drei Alien-Völker auch voneinander unterscheiden, eines haben sie gemeinsam: Die Xenophobie, Aggression und Fähigkeit des Menschen zur Gewalt bleibt allen dreien ein Rätsel. "Ihr Menschen haltet einen Spiegel vor das Universum, seht euer eigenes Gesicht und erklärt dann den ganzen Kosmos als furchterregend", hält ein Tinker-Kompositum seinem menschlichen Widerpart zu Beginn eine Moralpredigt, die in der Folge als Menetekel über der Handlung stehen wird.
Tatsächlich ist die im "Nimrod-Projekt" heraufdämmernde Bedrohung für die Stellar-Gruppe eine menschengemachte: Zur Erkundung unbekannter Weltraumsektoren wurden die waffenstarrenden Morgan-Konstrukte (Verbindungen aus organischen und mechanischen Komponenten mit künstlicher Intelligenz) geschaffen. Nach einem blutigen Amoklauf und der Flucht des gefährlichsten Konstrukts sehen sich die Völker der Stellar-Gruppe genötigt, dem potenziell bedrohlichen Objekt aliquot besetzte Jagdkommandos hinterher zu schicken. Deren Erlebnisse (inklusive der Schilderung, wie Menschen und Aliens zu einer praktikablen Kooperation finden) bilden aber nur das Rahmengerüst der Handlung. Immer interessanter werden die parallel dazu geschilderten Passagen rund um die beiden für das "Nimrod-Projekt" hauptverantwortlichen Menschen Luther Brachis und Esro Mondrian, in deren Vergangenheit der Schlüssel für das aktuelle Geschehen liegt.
Die Bilanz fällt gemischt aus: manches überzeugt, etwa Mondrians Sitzungen bei einem Fropper (einer Art Zukunfts-Psychotherapeut, in diesem Fall noch dazu einer Pipe-Rilla), die den Jagdszenen an Spannung zunehmend den Rang ablaufen. Oder die feine Ironie, dass mit Chan Dalton ein geistig zurückgebliebener Mensch für ein Jagdteam rekrutiert wird, dessen Intelligenz erst mit künstlichen Mitteln auf Normalniveau angehoben werden muss - was Chan in gewissem Sinne auch zum Konstrukt macht und einmal mehr das gewaltsame Eingreifen des Menschen in bestehende Gegebenheiten illustriert. - Zugleich erscheint es wenig plausibel, dass man diese Mühen überhaupt auf sich nimmt, statt gleich einen sofort einsatzfähigen Menschen von der Erde, wo für Geld ohnehin alles zu haben ist, unter Vertrag nimmt. Auch warum sich die pazifistischen Aliens unbedingt an der Jagd beteiligen wollen, erschließt sich nicht wirklich. Ebensowenig wie die kursorisch gestreifte Geschichte von Mama Erde selbst, der auschließlich unterirdisch besiedelten Welt das Wahnsinns, die dem Menschenreich nicht angehören will: Obwohl über Jahrhunderte hinweg die "Besten" (durchaus darwinistisch zu verstehen) ins All ausgewandert sind, scheint die Erde immer noch überbevölkert zu sein: und zwar hauptsächlich von den verarmten Nachkommen einer auf sehr an den Haaren herbeigezogene Art und Weise neu entstandenen Adelsschicht. Aber Sheffield war auch Physiker und kein Soziologe oder Historiker.
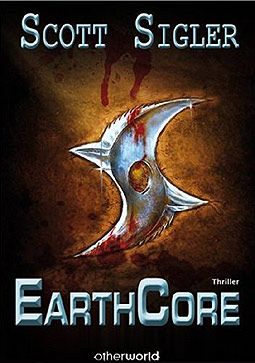
Scott Sigler: "EarthCore"
Gebundene Ausgabe, 482 Seiten, € 22,60, Otherworld 2008.
Alle Wege führen nach Utah. Dort hat nämlich der alte Prospektor Sonny McGuiness einen gigantischen Platinklumpen aufgespürt, der sich bald als das größte Vorkommen auf dem ganzen Planeten entpuppt - Grund genug für ein vielköpfiges Personal, sich zur Fundstelle in Bewegung zu setzen: Connel Kirkland, Spitzenmanager des Bergwerkunternehmens "EarthCore" und verbitterter Witwer, die eigentliche Hauptfigur des Romans. Kayla Meyers, eine Tötungs- und Verhörspezialistin, die Kirkland gerne engagiert, um Menschen einzuschüchtern, die seinen Plänen im Weg stehen; Foltern bereitet ihr Genuss. Angus Kool, arrogantes Jung-Genie und Leiter von Kirklands Forschungsabteilung. Und die Archäologin Veronica Reeves, die in Südamerika ein uraltes Platin-Artefakt (siehe das Titelbild des Buchs) ausgebuddelt hat, welches Funden aus Utah gleicht. Womit sie alle unter der Erde konfrontiert werden, soll hier nicht verraten werden - dass es keine Vampire aus dem Neandertal sein werden, macht aber bereits der Prolog klar: Den bildet eine Episode aus dem Jahr 1943, in der drei Geologie-Studenten unter Tage metallisch schabende Geräusche und funkelnde Lichter feststellen ...
US-Autor Scott Sigler hat seinen Roman ursprünglich häppchenweise als Podcast veröffentlicht - zu Inkongruenzen, die aus einer solchen Arbeitsweise erwachsen könnten, kommt es glücklicherweise dennoch nicht. Dafür hapert es immer wieder mit der Plausibilität von Handlung und Charakteren: Ist es wahrscheinlich, dass ein Riesenkonzern im PR-Zeitalter so geheim bleibt, dass nicht einmal die Regierung seine Firmenadresse kennt? Wie konnte der 23-jährige Angus drei Doktortitel erlangen, wenn er ein Gutteil seiner Zeit Extremsportarten frönt? Warum willigt Reeves in Kirklands Angebot ein, mit ihm für ganze sieben Tage unter die Erde zu gehen und etwaige archäologische Schätze zu retten, statt über ihre Regierungskontakte die gesamte Fundstelle sperren zu lassen (schließlich dauern ordentliche Ausgrabungen Monate/Jahre/Jahrzehnte)? Und wie können die ProtagonistInnen aus einer Höhle, in die sie sich mit einem High Tech-Bohrer fünf Kilometer unter die Erdoberfläche bohren mussten, durch einen versteckten zweiten Eingang wieder rausspazieren - in Rekordzeit und offenbar nicht allzu vertikal?
... und solche Beispiele gebe es noch reichlich. - Positiv fällt hingegen Siglers egalitärer Umgang mit den Haupt- bzw. Nebenfiguren auf; was nicht zuletzt auf die spannende Frage Auswirkungen hat, wer das blutige Kreszendo des Romans überleben wird und wer nicht. Die Philosophie, die hinter dem nicht gerade völkerverbindenden Schluss steht, wäre dann allerdings noch mal ein Kapitel für sich.
Am ehesten lässt sich "EarthCore" mit TV-Verfilmungen à la "Vulkanausbruch in New York", "Invasion der Killerameisen" etc. vergleichen: Ein reißerischer Plot gepaart mit einer nicht ganz so spektakulären Umsetzung, und die begrenzten Mittel sind zum Großteil in CGI-Spezialeffekte geflossen, von denen man sich gar nicht sicher ist, ob sie sich die nicht besser gespart hätten. Wieder einmal ist man vom Plot unwiderstehlich angelockt worden, wundert sich am Ende, dass nicht mehr draus geworden ist ... und eigentlich noch mehr darüber, warum man deswegen überrascht ist. - Dass sich Michael Crichton und Douglas Preston/Lincoln Child mit dem gleichen Rezept ein Millionenpublikum erschrieben haben, relativiert mein Statement allerdings beträchtlich.

Reinhold Ziegler: "Nachtläufer"
Gebundene Ausgabe, 143 Seiten, € 12,95, Ueberreuter 2008.
Dass in der Kürze die Würze zwar nicht liegen muss, aber durchaus kann, zeigt der deutsche Autor Reinhold Ziegler mit seinem aktuellen Buch, das als Jugendroman rezipiert werden kann, aber durchaus nicht muss. ProtagonistInnen von "Nachtläufer" sind jedenfalls das Brüderpaar Tom und Urs und das Mädchen Eoda, kurz Eo. Die drei Teenager sind in einer unterirdischen Welt aufgewachsen und können sich nicht mehr an die helle Zeit, die vor 15 Jahren endete, erinnern. Außerhalb ihrer jeweiligen Höhlensysteme unter den Ruinen einer Stadt tobt ein Dauersturm, der nicht nur das Sonnenlicht verhüllt hat, sondern auch für jeden, der sich hinauswagt, zur lebensgefährlichen Bedrohung wird. Nur die Nachtläufer halten spärlichen Kontakt zwischen den einzelnen "Kolonien", die allem Anschein nach nur wenige Kilometer oder gar nur einige hundert Meter voneinander entfernt liegen und dennoch nur für die Robustesten erreichbar sind.
Noch bevor auf die globale Katastrophe eingegangen wird, streut Ziegler bereits kleine Indizien für den allgemeinen Verfall ein: etwa dass Lesen und Schreiben keine selbstverständlichen Fähigkeiten mehr sind oder dass Öllampen zur Beleuchtung verwendet werden, aber Glühbirnen bereit liegen, sobald das mit dem Strom klappte. Den Gegensatz zu seiner düsteren und einengenden realen Umgebung findet Tom in Büchern und Bildbänden von früher. Hier hat er sich auch rührendes "Wissen" über die Liebe angelesen, das ihm mehr schadelt als hilft, als Urs und er die aus einer Nachbar-Kolonie geflohene Eo bei sich aufnehmen - was für Tom zwangsläufig gängige Liebesroman-Mechanismen in Gang setzt: Die Frau bringt die Brüder auseinander, Zwist und Tod oder Flucht scheinen ihm unvermeidlich - kurz: der Hormonsturm tobt nicht minder als der Orkan über der Erdoberfläche.
Wissenschaftliche Fundierung ist nicht die Stärke der Erzählung: Offen bleibt etwa die Frage, wie die unterirdisch hausenden KoloniebewohnerInnen über ein bisschen Tauschhandel ausreichend mit Nahrung versorgt werden können. Und dass der globale Staubsturm keinem bekannten Klimawandel-Szenario entspricht, fällt gar nicht mal besonders ins Gewicht - haarsträubend dafür ein Nebensatz über das Aussterben der Dinosaurier (der Zeitpunkt vor 65 Millionen Jahren sollte für SF-AutorInnen echt zur No-Go-Area erklärt werden: da kommt irgendwie nie was Gscheites bei raus). - Das spielt letztlich aber keine entscheidende Rolle, denn die Darstellung von Haupt- und auch Nebenpersonen ist gelungen. Die angesprochene Kürze bezieht sich nicht nur auf die Länge des Buchs - mit 143 Seiten kann "Nachtläufer" als Novelle betrachtet werden - sondern auch auf die der Sätze: Die schlichte, manchmal lakonische Sprache spiegelt die eingeschränkte Erfahrungswelt der ProtagonistInnen wider und steht ihnen gut.

George R. R. Martin: "Tuf Voyaging"
Broschiert, 440 Seiten, Meisha Merlin 2003.
Kürzlich ist George R. R. Martin 60 geworden: Anlass ein weniger bekanntes Werk des US-Autors vorzustellen, der hierzulande in erster Linie mit seinen Fantasy-Romanen ("Das Lied von Eis und Feuer") populär geworden ist, aber auch eine Menge origineller Science Fiction - darunter die legendären "Sandkings" - geschrieben hat. "Tuf Voyaging" ist ein kleines Juwel von Kurzgeschichtensammlung aus den 80ern, das im 2007 leider dahingeschiedenen Verlag Meisha Merlin neu erschienen ist: Dem selben Verlag, der unter anderem auch Jim Grimsleys "Kirith Kirin", eines der besten High Fantasy-Epen der vergangenen Jahre, herausbrachte. Restexemplare von "Kirith Kirin" sind heute nur mehr zu abartigen Preisen zu bekommen - "Tuf Voyaging" hingegen bewegt sich noch in regulären Sphären, also am besten schnell zugreifen!
Alle Geschichten, die aus den Jahren 1976 bis 1986 stammen, drehen sich um denselben Protagonisten: Haviland Tuf, einen ehemaligen Weltraumkaufmann, der per Zufall in den Besitz des lange verschollenen letzten Saatschiffs des Ecological Engineering Corps aus dem untergegangenen Erd-Imperium gelangt ist. An Bord hat die 30 Kilometer lange Ark die Zellproben von Millionen irdischer und außerirdischer Spezies, die mittels Cloning-Anlagen jederzeit zu voll entwickelten Lebewesen herangezüchtet werden können: vom Killerbakterium bis zum Tyrannosaurus. Denn ursprünglich stellte die Ark die ultimative Waffe in Sachen biologischer Kriegsführung dar - doch Haviland Tuf hat andere Pläne: Er gondelt mit seinem Riesenkasten durch einen Kosmos voller schillernd exotischer Welten, um deren ökologische Probleme zu lösen: Vom grauenhaft überbevölkerten und am Rand der Hungerkatastrophe stehenden S'uthlam ("Loaves And Fishes") über die Wasserwelt Namor, die sich einer Art vorweggenommener "Der Schwarm"-Bedrohung gegenüber sieht ("Guardians") bis zu Lyronica, wo - und das sieht Haviland gar nicht gerne! - Adelshäuser Tiere in Arenakämpfe treiben und gerne bessere "Monster" kaufen würden ("A Beast For Norn"). Selten gibt Tuf seinen KundInnen, was sie wollen - doch stets das, was sie wirklich brauchen.
Mit Haviland Tuf hat Martin eine Figur zum Niederknieen geschaffen: Ein gravitätischer Zweieinhalb-Meter-Buddha und überzeugter Vegetarier, der sich lieber mit Katzen umgibt als mit Menschen, obwohl er sich zu deren Rettung berufen fühlt (freilich nur gegen ordentliche Bezahlung). Und ein Gentleman, der seiner Umgebung mit genialem Understatement begegnet: "We're dead," wailed Celise Waan, "we're dead, dead, dead." "Madam," said Haviland Tuf, "you continue to be premature." Wie Tuf den planetengroßen Egos seiner KontrahentInnen keine Chance lässt und alle Herausforderungen bewältigt, ergibt eine Reihe von Schelmenstücken voller großartiger Wortduelle: Von der Komik der überraschenden Problemlösungsstrategien her ähnlich Barry B. Longyears Klassiker "Ein Zirkus für die Sterne" - doch noch mit dem Extradreh versehen, dass man Tuf nicht wirklich nachweisen kann, er würde absichtlich tricksen. Im Gegenteil: Mit seiner enervierenden Integrität wird Tuf zur ebenso sympathischen wie entsetzlichen Verkörperung des Prinzips Ehrlich währt am längsten.
Nur eine Gegenspielerin ist Tuf nahezu ebenbürtig: "Ma Spider", die vierschrötige, mit allen Wassern gewaschene Direktorin des Orbitalhafens von S'uthlam. Für ihre Quasi-Niederlage in "Loaves and Fishes" rächt sie sich in "Second Helpings", indem sie die Konfrontation zwischen Tuf und ihr - sehr zu Tufs Entsetzen - für eine TV-Seifenoper zur kitschigen Romanze entstellt hat: "And you and I have become the stuff of legends, the most celebrated lovers since all those famous romantic couples from ancient times - you know, Romeo and Juliet, Sodom and Gomorrah, Marx and Lenin" (naja, seit dem Untergang das Federal Empire vor 1.000 Jahren ist eben manches Wissensdetail verloren gegangen - aber dass ein "Moses" und ein "Noah" irgendetwas mit ökologischer Kriegsführung zu tun hatten, weiß der gebildete Sternenbürger noch - und das ist schließlich Tufs Spezialgebiet!). Doch Ma Spider ist es auch, die Tuf den Spiegel vorhält und ihn warnt, dass absolute Macht - wie von der Ark verkörpert - am Ende stets absolut korrumpieren wird: nicht ganz unberechtigt, wie Tufs Wandlung in den letzten Episoden ("Call Him Moses", "Manna From Heaven") zeigen wird. Dass der vor Witz sprühende Erzählreigen am Ende noch einen Drall ins Ernstere bekommt, mag zunächst wie ein unerwarteter Misston erscheinen. Es zeigt aber einmal mehr Martins Gabe als großer und kluger Erzähler. Ein vergessenes Kleinod der Science Fiction!
Und in der nächsten Rundschau wird es unter anderem um aktuelle Werke der großen Lynn Flewelling und das Thema Überwachung - mit Österreich-Bezug - gehen. (Josefson)