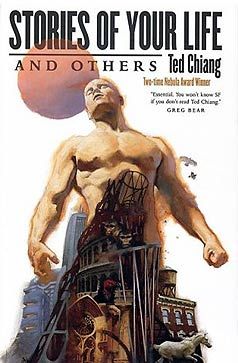
Ted Chiang: "Stories Of Your Life And Others"
Gebundene Ausgabe, 333 Seiten, Tor Books 2002.
Es ist verblüffend, dass sich die Verlage noch nicht darum geprügelt haben, Ted Chiang ins Deutsche zu übersetzen - immerhin gehört der Computerwissenschafter aus den USA zum mit Abstand Besten, was der Phantastikmarkt in den vergangenen Jahrzehnten zu bieten hatte. Chiangs Output ist zwar extrem schmal - nur zehn Kurzgeschichten seit 1990(!), acht davon in diesem Band versammelt -, hat es aber in sich. 1990 gewann er für seine Erstpublikation "Tower of Babylon" den Hugo Award, 1998 für das nach längerer Schaffenspause erschienene "Story of Your Life" erneut. "Hell is the Absence of God" erhielt 2001 Hugo und Nebula, und als im folgenden Jahr "Liking What You See" schon wieder nominiert wurde, verzichtete Chiang freiwillig. Aus einer neuerlichen Schaffenspause kehrte er 2007 mit "The Merchant and the Alchemist's Gate" zurück ... und das räumte heuer prompt erneut Hugo und Nebula ab. Ein Phänomen.
Chiang schreibt in einem wunderbar präzisen Stil Geschichten, die stets von einem konkreten Grundgedanken ausgehen - oft einem wissenschaftlichen Lehrsatz wie etwa dem Fermatschen Prinzip, aber gerne auch von verworfenen Postulaten aus der Wissenschaftsgeschichte oder Glaubensdogmen ... und diese Grundidee wird dann bis zur letzen Konsequenz weitergedacht. Besonders schön illustriert dies "Liking What You See: A Documentary". Darin geht es um eine fiktive Weiterführung der Political Correctness, die sich an amerikanischen Colleges verbreitet: Calliagnosia, eine durch neuronalen Eingriff künstlich herbeigeführte Unfähigkeit, Gesichter ästhetisch zu bewerten. Zwar können individuelle Gesichtszüge uneingeschränkt identifiziert - doch nicht mehr als "schön" oder "hässlich" assoziiert werden; Diskriminierung in Form von lookism ist unmöglich. Vor dem Hintergrund einer möglichen verpflichtenden Einführung von "Calli" handelt Chiang anhand von Interview-Statements der BefürworterInnen und GegnerInnen alle denkbaren Aspekte des Themas ab. - Ähnlich konsequent "Understand", das ein altes SF-Motiv aufgreift: Durch Hormonbehandlung wird die Intelligenz des Protagonisten Leon bis in übermenschliche Bereiche gesteigert - Chiang geht dabei das Wagnis ein, den Prozess aus Leons Ich-Perspektive zu schildern, und bleibt doch erschreckend glaubhaft.
In "Division by Zero" verzweifelt eine Mathematikerin daran, dass sie eine komplizierte aber wasserdichte Gleichung entwickelt, die unwiderlegbar beweist, dass 1 = 2 ist bzw. jede Zahl mit jeder beliebigen anderen gleichgesetzt werden kann. Die Arithmetik ist also in sich widersprüchlich - und die Mathematik somit im menschlichen Alltag ganz nützlich, als vermeintliches Fundament des Universums aber untauglich. In "Story Of Your Life" wiederum - einer Sprachreflexion ganz im Sinne Samuel R. Delanys - verändert sich die gesamte Zeitwahrnehmung einer Linguistin, als sie mit einer Alien-Sprache konfrontiert wird, die nicht auf sequentiellem, sondern auf teleologischem Denken beruht. Und "Seventy-Two Letters" führt gleich zwei Ideen zusammen: Die alchemistische Vorstellung von der Möglichkeit, Objekte durch Kenntnis ihres "wahren Namens" zu beeinflussen, und den Präformationismus, demzufolge z. B. menschliche Eizellen nicht von Spermien befruchtet werden, sondern von winzigen Homunculi, welche seit Anbeginn der Schöpfung - in immer kleineren Dimensionen - bereits im Körper der jeweiligen Vorgängergeneration enthalten sind. Bei immer stärkerer Mikroskopleistung könnte man demzufolge mit einem Blick ins Körperinnere bis ans Ende der Schöpfung sehen ... Chiang begnügt sich aber nicht damit, eine Welt mit anderem Quellcode als die unsere zu schildern, sondern fokussiert auf die sozialen Auswirkungen der hier gültigen Wissenschaften auf die gerade stattfindende industrielle Revolution.
Die Grenzen zur Fantasy verschwimmen in den Geschichten mit religiösem Bezug: In "Tower of Babylon" baut die ultimative Hydraulische Gesellschaft ihren Turm tatsächlich bis in den Himmel. Hillalum und seine Gruppe von Bergleuten machen sich auf den monatelangen Aufstieg, um jenseits der Bahnen von Sonne, Mond und Sternkugeln das Himmelsgewölbe zum Wohnsitz Jahwes aufzubrechen. Dort werden wir erfahren, dass Hillalums Welt anders konstruiert ist als die unsere - und doch weisen beide eine entscheidende kosmologische Gemeinsamkeit auf. Und einmal mehr schlägt man eine Chiang-Geschichte mit dem Gefühl zu, eine Wahrheit erkannt zu haben. - "Hell is the Absence of God" schließlich nimmt ebenfalls die Bibel wörtlich: In Form einer Parallelwelt, in der Engel wie Naturkatastrophen auftreten, bei deren Erscheinen sich Wunderheilungen und Todesfälle die Waage halten. Die Welt eines zutiefst unberechenbaren und ungerechten Gottes, der dennoch bedingungslose Liebe verlangt - auch vom Protagonisten Neil, dem als modernem Hiob noch grausamer mitgespielt wird als seinem alttestamentarischen Vorbild. Visionen der Hölle demonstrieren den Menschen, was sie erwartet, wenn sie diese Liebe nicht erbringen können: Eine recht normale Weiterführung des Diesseits - doch in einer Sphäre, in der die Anwesenheit Gottes nicht mehr spürbar ist ... jedem sei selbst überlassen, ob er dies als erschreckend oder eher beruhigend empfindet. Wie schon die gefallenen Engel verkünden, die Neils Welt ebenfalls gelegentlich passieren (ohne Schaden oder Wunder zu bewirken): Decide for yourselves. That is what we did. We advise you to do the same.
"Stories Of Your Life And Others" ist in der Zwischenzeit auch in zwei verschiedenen Paperback-Editionen erschienen: kostengünstiger, wenn auch räudiger in der Aufmachung. Die 2008 doppelt ausgezeichnete Kurzgeschichte "The Merchant and the Alchemist's Gate", die noch nicht in der Sammlung enthalten ist, können sich alle die als Schmuckband bestellen, die es nicht stört, wenn sie einen Preis von mehr als drei Dollar pro Textseite hinblättern. Aber wofür gibt's denn Anthologien ... was uns gleich zum nächsten Tipp führt:
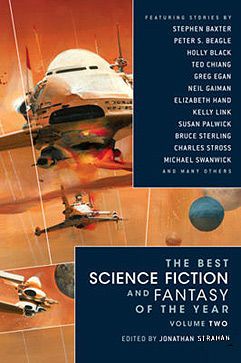
Jonathan Strahan (Hrsg.): "The Best Science Fiction and Fantasy of the Year: Volume 2"
Broschiert, 457 Seiten, Night Shade Books 2008.
Jonathan Strahan ist ein überaus umtriebiger Publizist im Phantastikbereich - er hat in Australien und den USA eine lange Reihe von Anthologien herausgegeben, für die in schöner Regelmäßigkeit die bekanntesten AutorInnen des Genres versammelt wurden; im aktuellen Beispiel etwa Charles Stross, Stephen Baxter oder Bruce Sterling. Insgesamt enthält diese Anthologie 24 Kurzgeschichten, die nahezu die volle Bandbreite des Genres abdecken: Science Fiction, Alternativweltgeschichten, Mystery und (Urban) Fantasy - Schwert schwingende Krieger und Roben tragende Magier hingegen sind kaum vertreten.
Wie erwartet ein Highlight die zuvor erwähnte preisgekrönte Geschichte von Ted Chiang, "The Merchant and the Alchemist's Gate": Im mittelalterlichen Bagdad lässt sich Kaufmann Fuwaad ibn Abbas vom Alchemisten Bashaarat ein Gate of Years vorführen, mit dem man 20 Jahre vor und/oder zurück reisen kann. Doch ist die Zukunft ebenso unveränderlich wie die Vergangenheit, wie Basharaat anhand von drei Geschichten demonstriert - zur vierten schließlich wird Fuwaads eigene Reise. Einmal mehr eine Chiang-Erzählung, die aufgeht wie eine wunderschöne mathematische Gleichung. - Nicht minder beeindruckend Stephen Baxters Beitrag "Last Contact", in dem er die letzten sechs Monate des Universums auf der Makro- wie der Mikroebene schildert: Während aus dem All die Botschaften ferner Superzivilisationen eintreffen, sehen Maureen und ihre Tochter Caitlin bei der Gartenarbeit gefasst dem unausweichlichen Ende allen Seins entgegen.
Das poetische Potenzial der Physik schöpft Greg Egan vor allem im Beginn von "Glory" aus, indem er die ausgeklügelte Kausalkette beschreibt, mit der zwei Forscherinnen auf einen fernen Planeten geschickt werden; die Erzählung ist vor demselben Amalgam-Handlungshintergrund angesiedelt wie Egans aktueller Roman "Incandescence". Mehr eine humoristische Fingerübung ist Charles Stross' "Trunk and Disorderly" über die dekadenten Hobbies der nouveau riche des Sonnensystems und ein genmodifiziertes Mini-Mammut mit Alkoholproblem; als eines von Stross' zentralen Werken dürfte dies in die Literaturgeschichte eher nicht eingehen. Deutlich interessanter das melancholische Märchen "The Last and Only; or Mr Moskowitz Becomes French" von Peter S. Beagle (Autor von "Das letzte Einhorn"), eine Parabel über Transformation, Entfremdung und enttäuschte Erwartungen, oder Neil Gaimans gleichermaßen humor- wie geheimnisvolles "The Witch's Headstone": ein Auszug aus "The Graveyard Book", dem brandneuen Roman des "American Gods"-Autors über den Jungen Bod, der auf einem Friedhof zwischen Geistern heranwächst. Souverän wie immer Kurzgeschichten-Königin Kelly Link mit der Hexengeschichte "The Constable of Abal"; 2008 ist ja endlich auch eine Link-Sammlung auf Deutsch erschienen ("Die Elbenhandtasche" bei Heyne). Einfach nur großartig schließlich Bruce Sterlings Kurznovelle "Kiosk": In einer nahen Zukunft, die sowohl den Globalismus als auch verheerende Epidemien überstanden hat, wird ein ungenanntes osteuropäisches Land an der Peripherie der EU zum Ausgangspunkt einer ökonomischen Revolution. Kiosk-Besitzer Borislav nutzt eine Art HighTech-Füllhorn, das ihm in die Hände gefallen ist, den fabrikator, auf so kreative Weise, dass der auf Qualitätsstandards, Copyrights und Korrektheit versessene Westen dem nichts entgegen zu setzen hat. Eine ohnehin schon seltsame Welt, in der Wirtschaft alles ist, jeder etwas bastelt und verkauft, KIs Produkte für Marktnischen zurechtdesignen und Menschen als wandelnde Zukunftstrends betrachtet werden, taumelt einer neuen Ära entgegen.
Aber auch hierzulande noch weniger bekannte AutorInnen haben etwas zu bieten: Etwa Ted Kosmatka mit "The Prophet of Flores", einer Alternativweltgeschichte von einer Erde, die vom Verständnis der Genetik bis zum Auftreten von Aids ein Ebenbild unserer modernen Welt darstellt - doch beweist die Radiokarbondatierung unumstößlich, dass sie nicht älter als 5.800 Jahre alt ist; Darwins Evolutionstheorie musste daher ihren Platz an der Seite "anderer Pseudowissenschaften wie Astrologie oder Akupunktur" einnehmen. Als wie in unserer Welt auf der Insel Flores Überreste des "Hobbit" gefunden werden, führt dies zu bemerkenswerten, aber für diese Welt folgerichtig gedachten (und womöglich sogar zutreffenden) Schlüssen. Aufgrund ihrer Perspektive verstörend, dennoch hervorragend M. Rickerts Erzählung "Holiday" über Sexualmorde an Kindern - ein ästhetischer Kontrapunkt dazu Theodora Goss' poetisches "Singing of Mount Abora", in dem Samuel T. Coleridges weltberühmtes Gedicht "Kubla Khan" und die Wirklichkeit einander gegenseitig erschaffen. In seiner erzählerischen Wucht beeindruckend schließlich "Urdumheim" von Michael Swanwick, der mesopotamische Schöpfungsmythen zum Ausgangspunkt nimmt, um auf martialische Weise die Loslösung des Menschen aus den Fesseln einer tierischen Bewusstseinsstufe zu schildern.
Natürlich könnte man über die Beweisführung für einen Titel wie "The Best Science Fiction and Fantasy of the Year" trefflich streiten - auf jeden Fall enthält diese Anthologie aber einige verdammt gute Erzählungen; soviel ist amtlich.
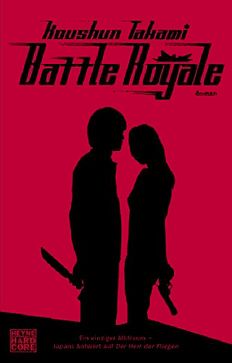
Koushun Takami: "Battle Royale"
Broschiert, 622 Seiten, € 10,30, Heyne 2007.
Timewarp: Koushun Takamis Aufsehen erregender Roman erschien in Japan 1999, wurde zum Bestseller und zog unter anderem eine Verfilmung und eine Manga-Serie nach sich. Und diese Folgeerscheinungen sind hierzulande früher angekommen als das Buch selbst: Der Film war 2002 kurz im Kino zu sehen - mit Takeshi Kitano in einer höchst ironisch pervertierten Variante seiner Spielleiter-Funktion bei "Takeshi's Castle". Die Mangas waren immerhin auf Englisch erhältlich; November 2008 ist bei Tokyopop übrigens auch eine deutschsprachige Version erschienen. Der Roman selbst hingegen kam erstmals im Jahr 2006 auf Deutsch heraus. Damals gab's diese Rubrik noch nicht, also ist dies gewissermaßen ein doppelter Nachtrag.
Zur Handlung: Auf einer alternativen Version der Erde bildet Japan seit einigen Jahrzehnten das Herzland der "Republik Großostasien", einer totalitären Diktatur, die für sich reklamiert den erfolgreichen Faschismus in Form des nationalen Sozialismus entwickelt zu haben. Eine Besonderheit stellt das Programm dar: Allwöchentlich wird im Auftrag der Behörden eine Klasse von MittelstufenschülerInnen entführt und an einen abgelegenen Ort - im konkreten Fall eine kleine Insel, deren Bevölkerung zuvor zwangsevakuiert wurde - verfrachtet. Diesmal erwischt es die 42 Jungen und Mädchen der 9-b der Shiroiwa Junior High: Sie befinden sich vermeintlich auf einer Klassenfahrt, als in ihren Bus Betäubungsgas eingeleitet wird (ein Szenario, das ein deutschsprachiger Autor wohl nicht so schnell heraufzubeschwören wagte ...). Als sie wieder erwachen, erklärt ihnen Programmleiter Sakamochi die simplen Regeln: Bringt euch gegenseitig um, bis nur noch eine(r) am Leben ist. Sollte es zu lange keine Todesfälle geben oder am Ende der "Spielfrist" mehr als einer übrig sein, werden kurzerhand alle umgebracht. Zur Demonstration, dass es ernst ist, wirft Sakamochi ihnen den verstümmelten Leichnam ihres Klassenlehrers vor die Füße und erklärt nonchalant, dass eine Betreuerin, die gegen das Programm protestierte, "vergewaltigt werden musste", um sie zur Räson zu bringen. Der Albtraum beginnt.
Ein paar der 15-Jährigen spielen bereitwillig das Spiel und ziehen die anderen mit hinein; nur ein Liebespaar, das gemeinsam in den Freitod geht, kann sich seine Integrität bewahren. Der Rest jagt oder wird gejagt, tötet oder wird getötet. Das Geschehen fokussiert dabei zunehmend auf eine Kerngruppe aus drei Jugendlichen: Den sympathischen Shuya, Fan der in Großostasien verpönten westlichen Rockmusik; Noriko, die Flamme seines besten Freundes Yoshitoki (der wurde gleich bei der Programmpräsentation zu Demonstrationszwecken erschossen), für die Shuya sich nun verantwortlich fühlt; und Shogo, der schon einmal ein Programm mitgemacht hat und daraus als "Sieger" hervorging. In einem Wechselbad aus gegenseitigem Vertrauen und Misstrauen müssen sie sich behaupten, während um sie herum Schüler für Schülerin in detaillierter Beschreibung massakriert wird. Gelegentlich steigt Takami dabei aus der Perspektive der ProtagonistInnen aus, um uns die Szenerie noch deutlicher unter die Nase zu reiben: Die beiden schönsten Mädchen der Shiroiwa Junior High starrten einander an, die Leiche eines Jungen mit zerquetschten Augen als Accessoire. So ein hübsches Bild.
Zynisch, widerlich, gore-geil - das ist schon mal gar nicht schlecht, macht aber noch nicht den ganzen Roman aus. In Flashbacks erhält man Einblick in die Lebenswelt der SchülerInnen vor dem Spiel, das angesichts der omnipräsenten Gewalt allmählich nur noch wie eine letzte Zuspitzung des "ganz normalen" Lebens wirkt: Schlägereien an der Schule, Vergewaltigungen und Missbrauch in der Familie, die Ermordung von Regimekritikern - "Battle Royale" verwischt bewusst die Grenzen zwischen dem rein Fiktiven und dem in auch in unserer Welt real Existierenden; ebenso wie die Beschreibung der Diktatur sehr vage gehalten ist und nicht auf das Paradoxon eingeht, dass all die oft bestaunten grellen Phänomene japanischer Popkultur auch im totalitären Großostasien vorhanden zu sein scheinen.
So leicht lässt sich Takamis Absicht also nicht fassen - ebensowenig wie die Einordnung seines Romans: Sport als Ventil für das gesellschaftliche Gewaltpotenzial hat in der Science Fiction Tradition (siehe etwa Pierre Pelots "Der Olympische Krieg", William Harrisons "Rollerball Murders" oder Stephen Kings "Running Man"). Goldings "Herr der Fliegen" wurde als Vergleich oft zitiert; zumindest zeigt er im Insel-Szenario einige Parallelen. Auch Egoshooter-Spiele dürften aber eingeflossen sein, immerhin endet jedes Kapitel - wie auf einem Video-Display - mit dem lapidaren Zwischenstand [...] Schüler übrig. - Wie jedes gute Exploitation-Werk überschreitet "Battle Royale" alle denkbaren Grenzen, die des Geschmacks ebenso wie die der einfachen Interpretation, und zielt direkt und treffsicher auf den Unterbauch ab. Sicher ist nur eines: Zartbesaitete Gemüter sollten von dem mit Recht in der Sonderreihe "Heyne Hardcore" erschienenen Buch besser die Finger lassen.
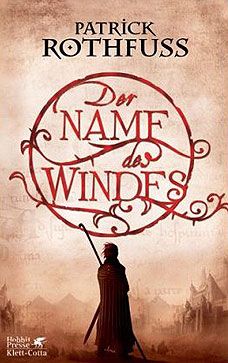
Patrick Rothfuss: "Der Name des Windes"
Gebundene Ausgabe, 863 Seiten, € 25,60, Klett-Cotta 2008.
"Jeder erzählt in seinem eigenen Kopf eine Geschichte über sich. Und diese Geschichte macht einen zu dem, der man ist. Wir gründen unser ganzes Leben auf diese Geschichte." Für "Der Name des Windes" ist dies eine Schlüsselstelle, und sie bezieht sich nicht nur auf die Hauptfigur Kvothe, sondern lässt sich auf den ganzen Roman und darüber hinaus das Genre Fantasy an sich anwenden.
Dass Fantasy im Format Kurzgeschichte, bei dem es vor allem auf eine originelle Grundidee ankommt, gegenüber der Science Fiction eher abstinkt (siehe die Anthologie Strahans zwei Bilder zurück), kommt nicht von ungefähr. Sie benötigt den langen Atem (bei "Der Name des Windes" ist alleine das Kapitelverzeichnis volle drei Seiten lang), um ihre Wirkung zu entfalten. Die LeserInnen sind aufgerufen, sich am virtuellen Lagerfeuer zu versammeln und sich dem Regelwerk des Mythos zu ergeben. Die Geschichte selbst kann dabei durchaus bekannt sein, vielleicht soll sie es sogar. Rothfuss' Auftakt zur "Königsmörder"-Trilogie mit dem geläufigen Plot vom verwaisten Nomaden-Sprössling, der an einer Universität seine magische Ausbildung antritt, bildet da keine Ausnahme.
Allerdings reflektiert College-Lehrer Patrick Rothfuss aus Wisconsin die erzählerischen Mechanismen stärker als andere Fantasy-AutorInnen: Beispielhaft etwa das Auftreten des Geschichtenerzählers Skarpi in der Stadt Tarbean, der dem jungen Kvothe und dem Rest des Publikums klar macht, dass sie gewisse Rahmenbedingungen zu erfüllen haben, wenn er etwas aus seinem Sagenvorrat zum besten geben soll. Mythen, Märchen und Lieder spielen eine große Rolle im Roman - immerhin werden Kvothes Eltern ermordet, weil sie die falschen Lieder gesungen haben. Niedergemetzelt wurden sie von den Chandrian, vermeintlichen Märchengestalten, über die Kvothe, der sie ja mit eigenen Augen sehen musste, an der Universität alles zusammen tragen wird, was je von ihnen überliefert wurde. Er allein weiß, dass die Chandrian wirklich existieren.
Und schließlich stellt die ganze Trilogie eine gedoppelte Erzählung dar: Geschildert im Rückblick, eingebettet in eine Gegenwartsebene, auf der sich der gealterte Kvothe von einem Chronisten überreden lässt, ihm die wechselvolle Geschichte seines Lebens zu erzählen. Und einmal mehr gelten dafür Regeln: Drei Tage muss sich der Chronist zum Zuhören nehmen, Teil 1 der Trilogie trägt dementsprechend den Untertitel "Erster Tag". - Rothfuss versteht es aber, das Spiel mit Meta-Ebenen durch geschicktes Einbauen von Action-Elementen und angedeuteten Geheimnissen mit Fleisch zu versehen: Sei es ein Angriff dämonischer Kreaturen, deren Herkunft vorerst allen außer Kvothe unbekannt bleibt, sei es ein seltsamer nicht-menschlicher Begleiter Kvothes, seien es die zahlreichen Beinamen, die er im Lauf seines Lebens erhalten hat: der Blutlose, der Arkane und natürlich der Königsmörder. All diese Elemente stehen für Stationen in Kvothes Leben und bilden die Ausgangspunkte weiterer Erzählungen, die sich letztlich zu der "Geschichte, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist" fügen werden.
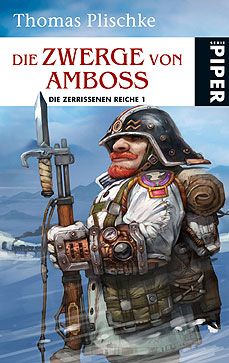
Thomas Plischke: "Die Zwerge von Amboss"
Broschiert, 491 Seiten, € 9,20, Piper 2008.
Don't judge a book by its cover, wie schon Frank'n'Furter sagte: Es scheint paradox, den Mehrwert eines Buchs im Klappentext zu verschweigen. Der liegt in diesem Fall darin, dass es sich nicht um eine Fortführung der mit Tolkien populär gewordenen und durch die Rollenspiel-Tradition festgebackenen Zwergen-Stereotype handelt. Dafür gäbe es ja unter anderem Markus Heitz' "Zwerge"-Mehrteiler oder gar Dennis L. McKiernans "Iron Tower"- und "Silver Call"-Reihen. - Vermutlich zielt der Klappentext primär auf ebendieses Publikum ab, das gern immer noch mehr vom Selben hätte. Allen, die bei Stichwörtern wie "Zwerge" oder "Halblinge" nur noch gelangweilt mit dem Fuß wippen, sei aber gesagt: "Die Zwerge von Amboss" führen ein etwas anderes Leben als die rauschebärtigen Axtschwinger anderer AutorInnen.
Am polaren Kontinent ihrer Welt haben sie sich eine Industriegesellschaft Typ 19. Jahrhundert aufgebaut, inklusive Eisenbahnnetz, Presse, ausgeprägter Bürokratie und einem Einheitslohn-System. Im Arbeiter- und Bauernstaat des Zwergenbunds regiert vielleicht der Oberste Vorarbeiter, doch es herrscht die Vernunft: Längst hat man die Bande der Religion abgestreift - ganz anders als auf dem südlichen Nachbarkontinent, wo die Menschen hausen und sich in endlosen Glaubenskriegen selbst zerfleischen. Kein Wunder, dass von dort schiffsladungsweise Flüchtlinge eintreffen - mit der Folge, dass das planvoll gestaltete Wirtschaftssystem im real existierenden Zwergensozialismus zunehmend in Schieflage gerät. Die Migrationsthematik zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Roman - manchmal ein wenig plakativ, nichtsdestotrotz aber wie ein frisches Lüftchen im Genre. Überhaupt lässt sich der Roman des Hamburger Autors Thomas Plischke nur mit Einschränkungen als "Fantasy" bezeichnen: Ersetzte man Zwerge, Halblinge usw. durch eigene Namensschöpfungen, wäre es eine Alternativweltgeschichte, vielleicht Steampunk - nicht zuletzt aber ein Krimi.
Polizeibeamter Garep Schmied ermittelt im Fall des Mords an einem Komponisten, der gerade eine Hymne zu Ehren des Fleißes und der Schaffenskraft des Zwergenvolks verfasste - es wird nicht der einzige Fememord an prominenten Zwergen bleiben, und Menschen sind die Hauptverdächtigen. Ein zweiter Handlungsstrang dreht sich um den - menschlichen - Auftragsjäger Siris, der auf dem Südkontinent gefährlichen Tieren nachstellt und in Richtung Norden zu seiner Schwester zieht, als ihm die mühsam eingeschmuggelte Munition für sein Zwergengewehr ausgeht. Auf der dritten Ebene wird der zwergische Chirurg bzw. Leiböffner Himek Steinbrecher in Gewissensnöte gestürzt, als er erkennen muss, dass der Chefarzt der psychiatrischen Klinik, in der er arbeitet, dunkle Experimente mit Menschen und Halblingen durchführt. Die gönnerhafte Einstellung der Zwerge gegenüber ihren "minderen" Vettern zeigt hier ihr hässlichstes Gesicht.
Die drei Handlungsstränge treffen mit einigen Überraschungseffekten genau in der Mitte des Romans - das nennt man exakte Komposition - aufeinander; von da an geht es unter den Vorzeichen politischer Verschwörungen und eines heraufziehenden Krieges in neuen Personenkonstellationen weiter. Der eigentliche Plot ist damit weniger ungewöhnlich als das Setting - aber spannend und in zwergengemäß recht derber Sprache passabel erzählt: Wird interessant sein zu sehen, wie es weitergeht (vielleicht beim nächsten Mal mit einem geglückteren Titelbild). "Die Zwerge von Amboss" ist kein abgeschlossener Roman, sondern bildet den Auftakt zu einer Serie, die nach dem politischen Chaos in der Menschen-Domäne "Die Zerrissenen Reiche" betitelt ist.
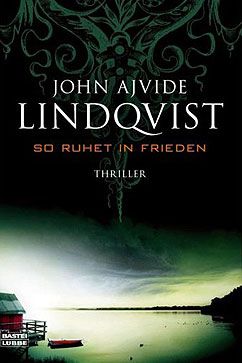
John Ajvide Lindqvist: "So ruhet in Frieden"
Broschiert, 445 Seiten, € 9,20, Bastei Lübbe 2008.
... natürlich ruht hier nix in Frieden, wie schon der Originaltitel "Hanteringen av odöda" ("Die Handhabung von Untoten") zeigt - und dessen eigentümliche Formulierung liefert auch gleich einen Hinweis darauf, dass man das Buch nicht als herkömmlichen Zombieroman angehen sollte. Vielleicht nicht einmal als Horrorroman, das bewahrt nämlich vor enttäuschten Erwartungshaltungen.
Angesiedelt ist der 2005 veröffentlichte Roman - warum auch immer; eine von vielen offenen Fragen, die das Buch zurück lässt - 2002, in einer Vergangenheit also, die so nicht stattgefunden hat. Inmitten einer Hitzewelle legt sich ein elektrisches Feld über Stockholm, das Haushaltsgeräte Amok laufen lässt und den Menschen drückende Kopfschmerzen beschert. An ominösen Vorzeichen mangelt es nicht: Ein Stadtstreicher glaubt eine Art Made zu sehen, die vom Himmel fällt und sich in ein Grab bohrt, Passanten beobachten Kämpfe zwischen Ratten, und über allem liegt ein quälendes Gefühl von Etwas. Wird. Passieren. Das tut es auch: Die kürzlich Verstorbenen, insgesamt ein paar tausend Menschen, erwachen zu einer Art Pseudoleben auf geringstem Niveau. Weder schreien sie "Gehürn! Gehürn!", noch attackieren sie Menschen. Sie versuchen lediglich - kaum intelligenter als Tiere, doch von einem Rest an Erinnerung getrieben - an die Orte zurückzukehren, an denen sie einst lebten. Und zu ihren Familien.
Die sind von der Situation überfordert: Elvy etwa, die nach Jahrzehnte langer mäßig erfüllter Ehe endlich tun kann, was sie will - da ist der gerade erst verstorbene Gemahl wieder da und imitiert das Leben. Bis dass der Tod uns scheidet, von wegen ... Ganz anders die Probleme des Stand-Up Comedian David und des gealterten Journalisten Gustav: Beide haben kürzlich enge Angehörige verloren und versuchen nun alte Fehler wiedergutzumachen und unter unmöglichen Bedingungen ein neues Familienglück aufzubauen. Der Gesellschaft insgesamt geht es nicht besser: Für Nichtbetroffene haben die Wiederlebenden, so die offizielle Sprachregelung, schnell ihren Novelty-Charakter verloren - Angehörige und Behörden hingegen stehen vor immer mehr Problemen. Kontroversielle und drastische Entscheidungen werden getroffen, und nicht wenige beginnen sich zu fragen: Ist das hier Schweden?
John Ajvide Lindqvist, selbst ursprünglich Comedian gewesen, hat mit "Låt den rätte komma in" (deutsch: "So finster die Nacht") 2004 einen Überraschungsbestseller gelandet; 2008 wurde der recht durchwachsen verfilmt. Lindqvists zweiter Roman macht sich darin verdient, ein altes Motiv zu einem anderen als dem gewohnten Thema weiterzuspinnen. Allerdings ist die Reflexion gesellschaftlicher Überforderung im Umgang mit dem Fremden nicht das einzige Element und darum auch nicht in voller Tiefe ausgeschöpft. Das Buch respektive die Gedanken der ProtagonistInnen strotzen beispielsweise vor geekigen Verweisen auf die Popkultur von "Buffy" bis Romero, was der Ernsthaftigkeit entgegen läuft. Und gegen Ende hin mehren sich auch die Anzeichen, dass die herkömmlichen "Begleitphänomene" eines Zombie-Auftritts nicht ganz ausbleiben dürften. Eine wilde Mischung, alles in allem. - Spannung bezieht "So ruhet in Frieden" daraus, dass man nicht weiß, worauf es letztlich hinauslaufen wird. Am Schluss bleibt aber der zwiespältige Eindruck zurück, dass sich auch der Autor darüber nicht voll und ganz im Klaren war.

Ralf Isau: "Die Dunklen"
Broschiert, 587 Seiten, € 10,30, Piper 2008.
Es beginnt noch recht vielversprechend: Im 1866 angesiedelten Prolog dirigiert Franz Liszt die Missa solemnis in der Pariser Kathedrale Saint-Eustache - doch hinter den Kulissen und vom Publikum weitgehend unbemerkt gerät die Aufführung zu einem surrealen musikalischen Duell zwischen Liszt und einem geheimnisvollen Kontrahenten; am Ende kann ein Helfer Liszts einige Notenblätter in Sicherheit bringen, die noch eine große Rolle spielen werden.
Wir blenden in die Gegenwart - oder genauer gesagt in die jüngste Vergangenheit, nämlich den Zeitraum kurz vor dem Tod von Papst Johannes Paul II. (auch das wird natürlich von Bedeutung sein). Sarah d'Albis, Liszt-Nachfahrin, renommierte Pianistin und Protagonistin des Romans, lauscht in Weimar der Aufführung eines lange verschollenen Musikstücks ihres Ahnen. Sarah ist Synästhetikerin: Akustische Signale führen bei ihr auch zu optischen Wahrnehmungen. Bei diesem Stück allerdings drängt sich ihr nicht nur das übliche Farben- und Formenwabern auf, vor ihren Augen erscheinen die Buchstaben eines ominösen (und holprigen) Gedichts von Liszt persönlich. Seine letzten Zeilen: Eile Volkes Wille flicht schon Alexanders Kranz / in nur zwei Monden weht er auf seinem Grabe Franz; klingt wie eine SMS aus dem 19. Jahrhundert.
Bereits auf den nächsten paar Dutzend Seiten wird Sarah vom zwielichtigen Musikprofessor Oleg Janin über die Hintergründe aufgeklärt: Die Farbenlauscher, eine Art Meta-Geheimbund von Synästhetikern, die selbst Freimaurer und Illuminaten unterwandert hätten, hüte seit Anbeginn der Zeit Wissen über Klänge der Macht: Musik, die den menschlichen Willen manipulieren kann. Derivate davon ließen sich in der Marseillaise ebenso finden wie in subliminaler Kaufhaus-Musik - das ganz dicke Ding aber, die Purpurpartitur, sei im 17. Jahrhundert verloren gegangen. Zwei konkurrierende Gruppierungen der Farbenlauscher, die menschenfreundlichen Schwäne und die skrupellosen Adler bzw. Dunklen, würden sich seitdem einen Kampf um die Wiederentdeckung der von Liszt versteckten melodischen Waffe liefern. Und wehe die Dunklen bekommen sie in die Hände. - Ganz erschließt sich dieses Bedrohungsszenario freilich nicht: Zwar streut Ralf Isau im Verlauf seines mit Stilblüten angereicherten Romans ("Die Stunden bei der Stalkingberaterin im vergangenen Jahr hatten aus ihrem Nervenkostüm noch lange keinen Kampfanzug gemacht ...") einige Sequenzen ein, die die manipulative Wirkung gezielt eingesetzter Melodien demonstrieren. Aber bis zum 17. Jahrhundert soll das Musikstück, das die Welt aus den Angeln heben kann, ja bereit gelegen haben - und wie genau unterschied sich nun die Welt davor von der danach?
Sei es, wie es sei: Sarah entdeckt die Detektivin in sich und setzt sich auf die von Liszt gelegte Spur, die sie auf eine Schnitzeljagd quer durch Europa führt - unter anderem zum Kopenhagener Tivoli, zur ungarischen Stephanskrone, der Sankt Petersburger Eremitage und natürlich zum Vatikan. Jede Sehenswürdigkeit liefert einen weiteren, extrem vagen Hinweis, der ungefähr 1.000 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zuließe - doch Sarah zieht aus der Mythologie, Liszts Vita oder dem, was ihr halt gerade so durch den Kopf schießt, stets den richtigen Schluss an den Haaren herbei und weiter geht's zur nächsten Station, wieder in architektonisch ansprechendem Ambiente. Das wird auf Dauer ebenso unglaubwürdig wie banal. Isau hat für "Die Dunklen" zwar reichlich kulturgeschichtliche Recherche betrieben (und Fans des "Da Vinci Code" oder der "Pythagoras-Morde" werden dem gepflegt bildungsbürgerlichen Setting vielleicht etwas abgewinnen können) - einen einigermaßen überzeugenden Roman hat er daraus jedoch nicht gemacht.

Greg Bear: "Blutmusik"
Broschiert, 428 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.
Eine der willkommensten Wiederveröffentlichungen des Jahres war Greg Bears Klassiker "Blutmusik" - der, soviel lässt sich nach neuerlicher Lektüre feststellen, nach über 20 Jahren in keinster Weise veraltet wirkt. Das Auftauchen des World Trade Centers und der Sowjetunion (interessant, dass deren bevorstehendes Ende wirklich so gut wie niemand in der westlichen SF-Literatur antizipiert hat) sind nahezu die einzigen Hinweise auf das Alter des Romans. Und dem steht seine Pionierleistung gegenüber, das Eintreten einer Technologischen Singularität zu beschreiben - noch vor Vernor Vinge oder Charles Stross, der im Vorwort die Bedeutung von "Blutmusik" würdigt.
Vergil Ulam, ein 32-jähriger Koloss von einem Wissenschaftsnerd mit geringer sozialer Kompetenz, arbeitet für das kalifornische Biotech-Unternehmen Genetron, kocht dort aber sein eigenes Forschungssüppchen: Er will das Potenzial der DNA für eine biologische Variante der Datenverarbeitung nutzen und experimentiert dazu mit Bakterien und seinen eigenen Blutzellen. Als Vergils Vorgesetzte dessen fahrlässige Forschung stoppen und ihn entlassen, schmuggelt er veränderte Zellen in seinem Körper aus dem Institut - die Ereignisse nehmen ihren Lauf. Denn die Noozyten benannten Zellen verarbeiten Informationen nicht nur wie ein simpler Computer, sie beginnen sie auch zu verstehen: Eine neue Intelligenzform betritt die Bühne, die zunächst ihre Ökosphäre - also Vergils Körper - optimiert. Da man weiß, dass sich Vergil verändern wird, beobachtet man argwöhnisch, wann der Prozess einsetzt: Vielleicht schon damit, dass der unerfahrene Einzelgänger einer Frau, die ihn in einer Single-Bar aufgabelt, mühelos multiple Orgasmen beschert. Spätestens aber damit, dass er die Blutmusik zu hören beginnt: die Kommunikation der Noozyten untereinander und schließlich auch mit ihm. In seinem Körper entstehen ganze Zivilisationen, die Forschung betreiben und daher auch bald erkennen, dass außerhalb Vergils ein neuer Makrokosmos der Besiedelung offensteht: Eine Krankheit, die denken kann, beginnt sich auszubreiten. Eine höfliche noch dazu: Ist es unangenehm? fragen die Noozyten eines ihrer Opfer ... nicht dass sie deswegen innehalten würden.
Dass der ziemlich unsympathische Vergil nach einigen Kapiteln als Hauptfigur verloren geht, ist kein großer Schaden. Sein Freund Edward, der die sich anbahnende Epidemie verhindern will, übernimmt zunächst, später sind es Überlebende der großen Umwälzung - geplant war diese ProtagonistInnen-Stafette ursprünglich nicht: "Blood Music" wurde zunächst (1982) als Kurzgeschichte verfasst und drei Jahre später zum Roman ausgeweitet; Brüche haben sich also eher aus technischen Gründen ergeben. Nichtsdestotrotz unterstreicht der kühle Umgang mit den Hauptfiguren noch einmal auf glänzende Weise, dass die beschriebene Entwicklung menschliche Dimensionen sprengt. Bei weitem.
Die Folgeereignisse schreiten so rasend schnell voran und nehmen derart drastische Ausmaße an, dass man sich spätestens in der Mitte des Romans wundert, was denn eigentlich noch kommen kann - doch es kommt. Und zwar immer dicker und gewaltiger. Es ist diese Konsequenz des Weiterdenkens bis hin zum buchstäblich Unvorstellbaren, die "Blutmusik" auszeichnet. Und anders als in Bears neueren "Darwin"-Büchern, die in Richtung Intelligent Design gehen, war der Ausgangspunkt der Entwicklung hier keine ominöse Richtunggebung, sondern ein ungeplantes Ereignis - Evolution at its best also. Oder worst, je nachdem wie man die globalen Veränderungen bewerten will.
Dies war die letzte Rundschau für 2008 - das neue Jahr wird mit Riesenwürmern beginnen, die überraschenderweise nicht aus der Wüste, sondern aus dem Schlamm hervorgekrochen kommen. (Josefson)