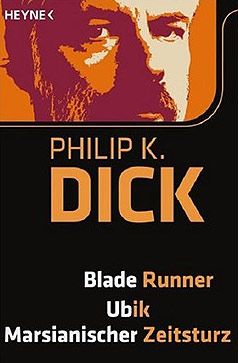
Philip K. Dick: "Blade Runner / Ubik / Marsianischer Zeitsturz"
Broschiert, 847 Seiten, € 14,40, Heyne 2009.
Nachdem Heyne über die Nuller Jahre hinweg eine umfassende Philip K. Dick-Bibliothek - darunter auch die drei hier zusammengefassten Romane - wiederveröffentlicht hat, kommen nun die Schnäppchenjäger zum Zuge. Respektive diejenigen, die bei den dezent aufgemachten Einzelbänden noch gezögert haben. Zu derart hochgradig kanonischen Werken überhaupt noch etwas zu sagen, erübrigt sich fast - nur eine Frage bleibt wieder offen: Nämlich ob man "Blade Runner" ("Do Androids Dream of Electric Sheep?", 1968) wirklich einen Gefallen tut, wenn man den Titel der Verfilmung anstatt des bis dahin verwendeten "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" darübersetzt. Immerhin unterscheidet sich Ridley Scotts Klassiker - den wohl mehr Menschen gesehen als das Buch gelesen haben - vom Original beträchtlich.
Androidenjäger Rick Deckard ist hier kein Loner, sondern ein verheirateter und durchaus bürgerlicher Charakter: Die "Zauberflöte" treibt ihm die Tränen in die Augen, und am meisten wurmt es ihn, dass er sich das wichtigste Statussymbol seiner atomar verseuchten Zeit - eine lebendes Tier - nicht leisten kann und bloß eine elektrisches Schaf auf dem Dach stehen hat. Die Androidenjagd sieht er daher auch primär unter dem Gesichtspunkt, sich endlich ein lebendes Schaf - oder vielleicht sogar einen Strauß - leisten zu können. Die satirischen Züge des Romans, der unverkennbar den Atem der 60er Jahre verströmt, kommen in vielen Szenen zu Tage - und wenn Rick und seine Frau Iran mittels einer Stimmungsorgel ihre Gefühle für den Tag festlegen, wirkt das wie ein Weiterspinnen der Wirtschaftswunderträume vom vollautomatischen Haus auf dessen Bewohner und erinnert eher an Doris Day- und Jacques Tati-Filme als an Scotts düsteres Film-L.A. - Und während wir im Film alle mit Deckard rätseln, ob er nun selbst ein Replikant ist, geht es im Roman um die viel grundlegendere Frage, wo die Grenzen der Menschlichkeit an sich zu ziehen sind. (Warum als Androiden Verdächtigte nicht einfach an einem Röntgenschirm vorbeigescheucht werden, anstatt komplizierte Psychotests mit ihnen durchzuführen, bleibt nebenbei bemerkt unbeantwortet - aber um technische Aspekte ging es Dick auch nicht wirklich.) Während die Androiden immer komplexer und intelligenter konstruiert werden, scheint sich die Menschheit in einem Prozess der Rückentwicklung zu befinden. Als Spatzen- und Ameisenhirne bezeichnete geistig eingeschränkte Menschen treten immer häufiger auf, und Manipulationen an der Psyche - siehe Stimmungsorgel - lassen die Grenzen zwischen natürlich und künstlich weiter verschwimmen. Trotzig halten die Romanfiguren an der auf Empathie beruhenden Religion des Mercerismus als untrüglichem Wesensmerkmal der Menschlichkeit fest - doch kauft man ihnen diesen "entscheidenden Unterschied" wirklich noch ab?
Noch absurder ist die Wirtschaftswunderwelt in "Ubik" (1969), wo Türen für ihre Benutzung Münzeinwurf verlangen und Moratorien kurz vor dem Tod stehende Menschen in der Kaltpackung einlagern - gelegentlich taut man sie auf, damit man noch mit ihnen sprechen kann. Das seinem Namen entsprechend allgegenwärtige "Ubik" (Salatdressing? Putzmittel? Haarfestiger? jedenfalls ungefährlich ... wenn nach Vorschrift verwendet) wird zur Einleitung jedes Kapitels beworben und Anti-Psi-Schutzgesellschaften bieten ihre Dienstleistungen feil, da Telepathen und "Präkogs" Unternehmen unterwandern. Glen Runciter ist der Leiter einer solchen Schutzgesellschaft und fliegt mit einem grell gekleideten Einsatzkommando auf den Mond, um seinen Erzfeind auszuschalten. Der Einsatz geht jedoch schief, Runciter kommt zu Tode und die Überlebenden um Joe Chip kehren nach Hause zurück ... nur um zu erleben, wie sich rings um sie die Realität aufzulösen beginnt: Gegenstände verfallen, die Gegenwart scheint der Vergangenheit zu weichen und die Welt in die 30er Jahre zurückzustürzen. Im folgenden Katz-und-Maus-Spiel rätseln sie, von wessen Psi-Kräften sie hier manipuliert werden - während in Reklametexten Botschaften des verstorbenen Runciter auftauchen. Viel stärker noch als in "Blade Runner" werden die Romanfiguren hier mit einer klassischen Philip K. Dick-Frage konfrontiert: Befinde ich mich noch in der Realität? Und wenn ja ... in welcher?
"Marsianischer Zeitsturz" schließlich ("Martian Time-Slip", 1964) versetzt seine ProtagonistInnen auf einen Mars, der zwar trocken und trostlos ist, aber dennoch nach Wildwest-Manier kolonisiert wird: Staaten und Privatorganisationen stampfen Siedlungen aus dem Boden, die einheimischen Bleichmänner wurden von den "Marskanälen" in die Ödnis verdrängt oder dürfen für menschliche Dienstgeber schuften (ähnlich der Rolle der Androiden-Sklaven in "Blade Runner": "...kommen die herrlichen Zeiten der Südstaaten vor dem Bürgerkrieg wieder!" tönte da die Werbung). Und es sind ökonomische Motive, die die meisten Protagonisten antreiben: Sei es der Lebensmittelhändler Norbert Steiner oder der Psychiater Milton Glaub (wie in "Simulacra" spielt psychologische Forschung alten Zuschnitts hier eine große Rolle): sie alle versuchen sich am american way of life und scheitern. Der Chef der Kanalarbeitergilde Arnie Kott wiederum hat schon ein großes Stück vom Kuchen, hätte aber gern noch ein größeres. Als er hört, dass der "Autismus" eines Jungen (die psychologischen Zuordnungen würden heutigen Diagnosen eher nicht entsprechen) möglicherweise an einem veränderten Zeitempfinden liegt, wittert er darin eine Chance die Zukunft vorherzusehen und so bessere Geschäfte zu machen.
Nur der Mechaniker Jack, die eigentliche Hauptfigur des Romans, jagt nicht allein dem Geld hinterher. Für ihn war der Mars einst Zufluchtsort, nachdem ihn wie so viele andere auch die Arbeits- und Produktionsverhältnisse auf der Erde "schizophren" (wieder eine wackelige psychologische Bezeichnung) gemacht haben. Durch die Begegnung mit dem autistischen Manfred kehrt seine alte Angst aus der Realität herauszufallen zurück - er beginnt erneut Menschen als Dinger aus Drähten zu sehen und fürchtet den gesellschaftlichen Erwartungen nicht mehr entsprechen zu können: "Ich würde alles darum geben, wenn ich darüber hinwegtäuschen und eine Rolle spielen könnte." - Um Missverständnissen vorzubeugen: Das alles soll jetzt nicht bedeuten, dass Dicks Romane primär gesellschaftskritische Satiren sind - sie warten einfach mit einer erstaunlichen Vielzahl von Bedeutungsebenen auf. Und ebenso viele gute Gründe gibt es daher, dieses Buch zu kaufen.
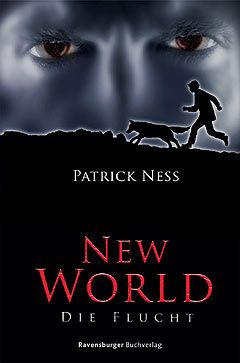
Patrick Ness: "Die Flucht" ("New World" 1)
Gebundene Ausgabe, 538 Seiten, € 17,50, Ravensburger 2009.
Ein beeindruckendes Buch, das mal gleich vorneweg! Im Mittelpunkt steht der Teenager Todd Hewitt, der nur noch einen Monat von der Initiation zum Mann entfernt ist: Der alles bestimmenden Trennlinie in Prentisstown, einer ganze 147 Einwohner zählenden heruntergekommenen Siedlung auf New World. Stagnation und Verfall bestimmen das Leben auf dem abgelegenen Kolonialplaneten, seit in einem biologisch geführten Krieg nicht nur die planetare Urbevölkerung - die Spackle - ausgelöscht wurde, sondern auch die Frauen der menschlichen Siedler. Und noch etwas hat die bakterielle Waffe der Spackle hinterlassen: den Lärm. Jeder kann die Gedanken und Gefühlsregungen jedes anderen lesen - das gilt auch für Tiere, selbst wenn deren Horizont nur irgendwo zwischen Sex Sex Sex und Muss kacken, Todd liegt.
... so jedenfalls wurden Todd die Zusammenhänge erklärt, und da er als Gemeindejüngster und letzter Nicht-Erwachsener außer seinen Adoptivvätern Ben und Cillian keinen Menschen hat, der sich mit ihm abgeben würde, schiebt er ordentlich Frust und zieht mit seinem Hund Manchee durch das die Stadt umgebende Sumpfgebiet. Und dabei stößt er eines Tages auf etwas absolut Ungewöhnliches: Ein bewegliches Loch im Lärm - offenbar ein Wesen, das keine Gedanken aussendet und so nicht zum allgegenwärtigen Hintergrundrauschen (im Text durch einige Layout-Spielereien illustriert) beitragen kann. Bald wird sich dieses Phänomen als das Mädchen Viola entpuppen, einzige Überlebende eines Raumschiffabsturzes - Vorbotin einer neuen Siedlerwelle, von der auf New World niemand etwas ahnt. Doch schon vor dieser Identifizierung wird Todd von seinen Vätern panisch auf die Flucht geschickt - zum ersten aber bei weitem nicht letzten Mal muss er zur Kenntnis nehmen, dass die Dinge auf New World anders liegen, als er sein Leben lang glauben gemacht wurde. Einen Teil des Geheimnisses hört er aus dem Lärm heraus, sträubt sich aber gegen die Erkenntnis und belässt so den Leser im Ungewissen - weitere Aspekte werden sich nach und nach aus der Handlung ergeben und langsam zu einem überaus düsteren Gesamtbild zusammensetzen.
Auf den ersten Blick scheint es eine ungewöhnliche Kombination zu sein: Ein Roman, der - neben einigen anderen - 2008 den James Tiptree, Jr. Award gewonnen hat, einen Preis für Phantastik-Literatur mit Berücksichtigung von Gender-Thematiken - und der erscheint bei einem Jugendbuchverlag. Letztlich zeigt sich damit aber nur, wie relativ der Begriff "Jugendbuch" in Bezug auf die Qualität ist, auch wenn er von vielen erwachsenen LeserInnen gerne entsprechend missinterpretiert wird. - Auf ihrer Flucht begegnen Todd und Viola jedenfalls einer Reihe unterschiedlicher Gesellschaftskonzepte, und während ihnen der irrsinnige christliche Prediger Aaron und die Einwohner von Prentisstown als puren Horror verbreitende Armee auf den Fersen sind, wächst langsam der Eindruck, Todd sei nichtsahnend in der Heimstatt des Bösen aufgewachsen. Umso grausiger, als "Die Flucht" kein Fantasy- oder Horror-Roman ist und das Böse kein Namensschild trägt, sondern allein in seinen Taten erkennbar wird. Auch Todd selbst hat mit seinem Wesen und seiner (Un-)Fähigkeit zu töten zu ringen - nicht grundlos trägt der Roman im Original den Titel "The Knife of Never Letting Go".
Erzählt wird der Roman durchgehend aus Todds Ich-Perspektive und im Präsens, was dem Ganzen Unmittelbarkeit - Ich muss ihn töten. Ich zücke das Messer. Jetzt ist es gezückt. - und verbunden mit den Wendungen der Handlung eine permanente atemlose Spannung verleiht. Die Geschichte selbst ist inhaltlich wie stilistisch außergewöhnlich, gleichermaßen fesselnd wie bedrückend - es ist schlechterdings unmöglich, danach nicht fieberhaft auf die Fortsetzung zu warten. "Das dunkle Paradies" (im Original: "The Ask and the Answer", Teil 2 der Reihe "Chaos Walking"), erscheint im Oktober.
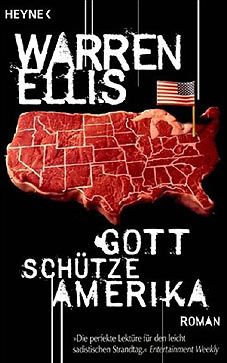
Warren Ellis: "Gott schütze Amerika"
Broschiert, 320 Seiten, € 8,20, Heyne 2009.
Die Stadtteilsanierung hatte wenige Häuser westlich von mir haltgemacht. Die Grenze war deutlich erkennbar. Auf der anderen Seite biafrische Küche, Wohneinheiten mit quietschsauberen Sicherheitsfenstern aus Plastik, Frauen, die Imogen oder Saffron hießen, Männer mit Namen wie Josh und Morgan. Auf meiner Seite Crackhuren, ausgebrannte Autos, Schusslöcher in den Türrahmen und Männer namens Arschloch. - So sieht sie aus, die Welt von Mike McGill, einem mit 30 schon völlig heruntergekommenen Privatdektektiv und Ex-Säufer, der gelegentlich mit einem Telefon-Stimmumwandler von eBay vortäuscht, er könnte sich eine Sekretärin leisten. Den Regeln des Genres und erst recht der Genre-Parodie entsprechend würde man sich nun vielleicht den Auftritt einer geheimnisvollen Schönen erwarten, die die Dinge ins Rollen bringt - statt dessen erscheint in McGills Büro der mumifizierte Stabschef des Weißen Hauses. Und der setzt Mike für ein astronomisches Honorar auf die Spur der anderen Verfassung der USA, ein Geheimdokument, in dem die Gründerväter festhielten, was ihnen für die Vereinigten Staaten wirklich vorschwebte ... ein Buch mit 23 unsichtbaren Verfassungszusätzen, in Alien-Haut gebunden und mit Meteoritenfragmenten verstärkt, die den Leser quasi hypnotisieren. In den 50er Jahren ist dieses Dokument verschwunden, und seitdem ging es mit den USA moralisch rasant bergab ...
Der Brite Warren Ellis, der bislang vor allem Graphic Novels - darunter das gefeierte SF-Comic "Transmetropolitan" und die bemerkenswerte Superhelden-Serie "The Authority" - geschrieben hat, nimmt in seinem Roman-Debüt die Sehnsucht nach den "alten Werten" und dem "einfacheren Leben" ebenso aufs Korn wie die Detektivgeschichte. Und er verarscht (siehe das Zielobjekt) gleich eine ganze Mode-Sparte von Spannungsliteratur, die in Gemälden, Musikstücken, Schachbrettern, Maya-Friesen und weiß der Hugo was nicht allem Wahrheit und Schicksal der Welt enthüllt wähnt. - Dass just der glücklose Mike mit der Mission zur Rettung der USA vor Krankheit und Perversion betraut wird, liegt nicht nur daran, dass der Stabschef ihn für einen "moralischen Mutanten" hält; er ist in erster Linie ein Pechmagnet. Soll heißen: Mike zieht ganz ohne sein Zutun Durchgeknallte aller Art an. Sei es der plauderselige Serienkiller oder die besoffene Stewardess, die an die Flugpassagiere Teppichmesser verteilt - wo auch immer ein Stück Wahnsinn zirkuliert, schwenkt es sofort in eine Umlaufbahn um Mike ein. Und da die Geheimverfassung irgendwo im verkommenen Unterbauch Amerikas verschwunden ist, kann es keinen besseren Spürhund geben als Mike.
So begibt er sich auf die erforderliche Schnitzeljagd, begleitet von der 23-jährigen Trix, die er auf der ersten Station seiner Reise trifft. Trix wird zur perfekten Führerin in die Unterwelt, da sie gerade an ihrer Doktorarbeit über "extreme Formen menschlicher Selbsterfahrung" schreibt. Und von denen lernen sie so einige kennen: Einen Fankreis von Godzilla-Pornos etwa, die Bodybuilder-Variante einer Botox-Party, bei der man sich gegenseitig literweise Salzlösung in die Hoden spritzt (und Mike muss nolens volens mitmachen, um den nächsten Hinweis auf das Ziel seiner Suche zu erhalten), eine ultradekadente Familie texanischer Ölmilliardäre mit präsidialen Ambitionen oder ein Hotel, in dem christliches Sexspielzeug gereicht wird ... zum Beispiel und laut Ellis auf Tatsachen beruhend Analstöpsel in Form des Jesuskindleins. Und während Trix für beinahe alles offen ist, muss Mike erst langsam sein grummeliges Spießertum abbauen. Mehr als einmal taucht die entscheidende Frage des Romans - nämlich was Mainstream sei - auf; und für Mike und Trix erwächst daraus allmählich noch eine ganz andere: Angenommen die Geheimverfassung ist doch eher ein Zauberbuch als nur eine leicht peinliche Antiqität und ihre Suche hat am Ende Erfolg ... wollen sie dann wirklich noch, dass die vermeintliche moralische Mehrheit damit die Zeit zurückdreht?
"Gott schütze Amerika" (im Original: "Crooked Little Vein") glänzt mit dem besten schlechten Geschmack der Saison und ist dementsprechend ausgesprochen unterhaltsam. - "Pink Flamingos"-Regisseur John Waters, der gekrönte Bad-Taste-König aller Zeiten, zählt in seiner verfilmten One-Man-Show "This Filthy World" so einige Dinge auf, bei denen selbst ihm der Appetit vergeht: In "Gott schütze Amerika" könnte er vielleicht noch ein paar Anregungen finden.

George Mann: "The Affinity Bridge"
Broschiert, 416 Seiten, Snowbooks 2008.
Zu den diesjährigen Anwärtern auf den "Sidewise Award" - den bekanntesten Preis für Alternativweltgeschichten - gehört neben Terry Pratchetts "Eine Insel" und einigen Zyklenfortsetzungen auch dieser Roman: Erster einer Reihe von Steampunk-Krimis rund um das Ermittler-Duo Newbury & Hobbes; geschrieben von George Mann, einem britischen Publizisten und Autor von Geschichten, die teilweise Spiele-Bezug haben, teils für sich allein stehen. Das nächste in sich abgeschlossene Abenteuer aus dieser Reihe, "The Osiris Ritual", ist diesen Monat in der gebundenen Ausgabe erschienen.
Wir befinden uns im London des Jahres 1901: Luftschiffe ziehen schwarmweise über den Himmel, Dampfkraftwägen rattern durch die Straßen (darin fährt man laut, stinkend und unbequem ... aber im Takt des Fortschritts) und automatons erledigen Dienstleistungen aller Art: Androiden mit Uhrwerk-Gehirn, die mittels Lochkarten programmiert werden. - Zugleich gehen unheimliche Dinge vor: Eines dieser Luftschiffe stürzt ab, die verkohlten Leichen im Wrack sind mit Fußfesseln an ihre Sitze geschnallt. Ein geisterhaft leuchtender Polizist - der glowing bobby - wird mit einer Mordserie in den weniger noblen Vierteln der Stadt in Verbindung gebracht - und zu allem Überfluss grassiert dort auch noch eine "Zombieseuche", deren Ursprung im reißerischen Prolog geschildert wird. Zwar schlachten die untoten revenants im Nebel brave Bürger ab, doch sieht man das Phänomen mit typischem 19. Jahrhundert-Rationalismus primär unter medizinischen Gesichtspunkten.
... zumindest tut dies Sir Maurice Newbury, seines Zeichens Anthropologe am British Museum und ausgewiesener Experte für Okkultes - zugleich Spezialagent im Direktauftrag Ihrer Majestät Queen Victoria (die zu diesem Datum in unserer Zeitlinie bereits tot wäre, hier jedoch noch lebt ... so einigermaßen jedenfalls). Newbury ist ein ausgemachter Fan des technischen Fortschritts - seine Assistentin Veronica Hobbes sieht dies etwas differenzierter. Fortschritt würde sie sich eher auf gesellschaftlichem Gebiet wünschen, denn immer noch wird eine weibliche Ermittlerin scheel angesehen - und wenn sie als Frau der Tat mal eben eine Tür auftritt, guckt sie sich vorher verstohlen um, ob sie auch niemand dabei beobachtet. Das könnte sich noch zu einer "Mit Schirm, Charme und Melone"-artigen Konstellation entwickeln - zumindest im ersten "Newbury & Hobbes"-Roman ist es aber noch nicht so weit.
Überhaupt muss man konstatieren, dass "The Affinity Bridge" trotz vieler Ideen und einer allseits positiven Aufnahme durch die Kritik immer wieder Chancen vergibt. Zum Beispiel ist Mann bemüht, seinen Charakteren altertümelnd distinguierte Worte in den Mund zu legen, bleibt sprachlich ansonsten aber überschaubar originell ... he smiled/she smiled etwa kommt in inflationärer Weise nahezu in jedem Absatz vor. Vom Esprit, mit dem zum Beispiel Mark Gatiss den Titelhelden seiner "Lucifer Box"-Romane ausgestattet hat, ist das noch ein gutes Stück entfernt. Und auch das Setting könnte noch ein paar Details mehr vertragen: Von Steampunk erwartet man sich einfach eine Atmosphäre so dicht wie in einem plüschverhangenen viktorianischen Bordell. Den dichtesten - und trotz aller anderer Spannungsfaktoren unheimlichsten - Moment schafft Mann in Newburys Begegnung mit dessen Auftraggeberin: In einem abgedunkelten Audienzraum schiebt sich ihm unter keuchenden und pfeifenden Geräuschen Queen Victoria als Cyborg entgegen - nur noch am Leben gehalten von "Dr. Fabians Wundermaschinen", doch klar im Kopf und hart wie Sheffield-Stahl. Da vergisst man für ein paar Seiten sogar das Bild, das 2008 anlässlich einer Versteigerung um die Welt ging: Victorias gigantische Unterhose, in die sie vermutlich mitsamt ihrem Steampunk-Rollstuhl schlüpfen hätte können.
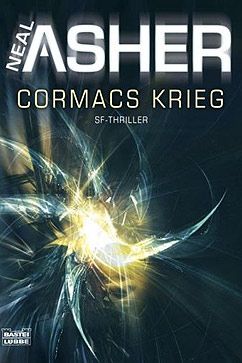
Neal Asher: "Cormacs Krieg"
Broschiert, 619 Seiten, € 9,20, Bastei Lübbe 2009.
Wo es am laufenden Meter und in wachsender Größenordnung qualmt, kracht und explodiert, ist Neal Asher nicht weit - erst recht, wenn der Brite seine vielleicht populärste Schöpfung wieder in den Einsatz schickt: Ian Cormac, Spezialagent der Earth Central Security. "Cormacs Krieg" (im Original: "Line War") bietet Fans von Ashers Polis-Romanen wieder exakt das, was sie sich erhoffen - inklusive ein Wiedersehen mit Figuren aus früheren Romanen wie der Wissenschafterin Mika, dem wirklich niemandem geheuren Golem Mr. Crane oder dem intelligenten Alien-Raumschiff Drache. Verweise auf Ashers "Der Drache von Samarkand", "Der Messingmann" oder "Das Tor der Zeit" gibt es zahlreiche ... doch ist Asher klug genug, diese aus der Handlung heraus zu erklären, sodass NeueinsteigerInnen nicht an mangelndem Vorwissen scheitern können. Dafür stoßen sie an einem entscheidenden Zeitpunkt zur "Cormac"-Reihe, denn "Cormacs Krieg" führt einige lose Enden zusammen. Respektive: er lässt sie in Serien von Detonationen kollidieren.
Die Polis als zahlreiche Sternsysteme umfassende Heimat der Menschen hat längst das Stadium des Posthumanismus erreicht. Regiert wird sie - unter mehr oder weniger allgemeiner Akzeptanz - von hochentwickelten Künstlichen Intelligenzen wie Jerusalem oder Earth Central. KIs beseelen auch Raumschiffe oder Drohnen - sowie die anthropomorphen Golems, ein Versuch, sich dem Dasein als Mensch und dessen Unzulänglichkeiten anzunähern. Und die Menschen kommen ihnen aus der anderen Richtung bereitwillig entgegen: Zerebralverstärkung ist unter der Normalbevölkerung gang und gäbe, Menkis tragen KI-Aspekte in sich (ein Trend, der von den regierenden KIs gefördert wird, damit die Menschen ein Stück weiter aus der Ursuppe herausklettern). Dazu kommen noch Hybridformen, die durch Alien-Technologie entstandenen Drachenmenschen und schließlich Personen, die nach ihrem Tod als upgeloadete Geister in der Maschine durch die Netzwerke wandern und wie unerwünschte Viren von Jäger-Killer-Programmen gehetzt werden ...
... eine reichlich unübersichtliche Lage, die sich auf individueller Ebene fortsetzt. Denn keine der Hauptfiguren weiß noch so recht, auf welcher Sprosse der post-biologischen Evolution sie eigentlich inzwischen steht. Cormac kann seit seinem letzten Abenteuer ohne technische Hilfsmittel in den Subraum sehen, Mika zieht nicht nur mit dem Raumschiff Drache durchs All, sondern glaubt auch, von diesem in subtiler Weise verändert worden zu sein. Und der Messinggolem Mr. Crane, der in den früheren Romanen in mehrfacher Weise manipuliert und verändert wurde, entzieht sich mittlerweile ohnehin jeder Einordnung - durchaus zum Schrecken seiner Gegner. An deren Spitze Erebus steht: Eine abtrünnige KI, die sich an die Eroberung der Polis macht und dafür Dschainatech einsetzt: außerirdische Nanotechnologie, der in den vergangenen Jahrmillionen schon mindestens drei Hochzivilisationen zum Opfer gefallen sind. Solche besitzt auch die Menki Orlandine Taser 5 (ebenfalls eine alte Bekannte) und will sie gegen Erebus zum Einsatz bringen ... vorausgesetzt ihre potenziellen MitstreiterInnen ballern sie nicht in Verkennung der Lage ab, denn wer auf welcher Seite steht, ist den Beteiligten über weite Strecken hinweg unklar. Und über all dem wächst Cormacs Misstrauen gegenüber den KIs, für die er in die Schlacht zieht, und die mit ihrer Verantwortung für das Wohl der Menschheit seltsam leichtfertig umzugehen scheinen.
Fantasievolle High Tech wie Chamäleonware, Runcibles oder Hartfelder, dazu überaus kreative Ideen für zerstörerische Einsatzmöglichkeiten von physikalischen Effekten: "Cormacs Krieg" ist weniger eine klassische Space Opera als eine einzige 600-seitige Materialschlacht, ein Fest für Technophile.
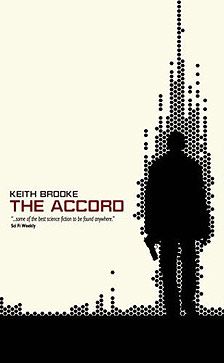
Keith Brooke: "The Accord"
Broschiert, 448 Seiten, Solaris 2009.
Den Postings nach zu urteilen ist das Publikum dieser Rubrik tendenziell männlich und eher unromantisch veranlagt - möglich also, dass sich beim Stichwort "Liebesgeschichte" gleich einigen die Fußnägel aufrollen werden. Aber keine Angst: Erstens wird das Mode-Genre "Geheimnisvolle attraktive Männer erweisen sich als Vampir" hier bis auf weiteres nicht Fuß fassen und zweitens verwendet der Brite Keith Brooke in seinem jüngsten hervorragenden Roman eine unglückliche Liebeskonstellation nur als Tor in eine virtuelle Welt, um dem "Matrix"-Szenario neue dystopische Seiten abzugewinnen.
... und dabei sieht auf den ersten Seiten noch alles nach einer schimmernd schönen Hochglanzwelt aus, als hätte jemand Hugo Gernsbacks Vorstellungen auf den aktuellen informationstechnologischen Stand gebracht. V-space architect Noah Barakh steht vor dem Abschluss seines größten Projekts, mit dem die letzte Grenze überwunden werden soll: The Accord, eine Art nicht-religiöser Himmel für das virtuelle Weiterleben nach dem Tod. Der Accord ist die Summe aller bislang geschaffenen virtuellen Räume, ein evolutionäres und - ganz wichtig! - von niemandem mehr gesteuertes Gebilde, das sich auf eine consenusal reality einpendelt. Diese wird Inkongruenzen selbsttätig beseitigen und für ihre BewohnerInnen nicht minder real sein als die Welt draußen. Um in diesen Himmel aufgenommen zu werden, muss man lediglich snapshots - Persönlichkeitskopien seiner selbst (eine Idee analog zu David Maruseks "The Wedding Album") - anfertigen und in möglichst regelmäßigen Abständen aktualisieren. In diesen Kopien lebt man fortan weiter - und zwar für immer. Und Noah geht als the man who built heaven in die Geschichte ein.
Doch hat man damit erst den unrepräsentativen reichen Ausschnitt der Welt kennengelernt - jenseits seiner Grenzen wirken sich der Klimawandel und dessen Folgen verheerend aus: Millionen von Boat People strömen nach Europa, faschistische Mobs stellen sich ihnen entgegen, die Gesetzgebung verschärft sich. Milliarden von Menschen werden in absehbarer Zeit sterben - humanitäre Soul Harvesters ziehen daher durch die Welt, um snapshots der Mittellosen anzufertigen und ihnen wenigstens ein virtuelles Weiterleben zu ermöglichen. Dennoch können auch sie nicht verhindern, dass Afrika im Accord ein leerer Kontinent sein wird, um den bald heftige Kämpfe ausbrechen. Überhaupt hat man die Rechnung ohne die Demographie gemacht, obwohl Thomas Robert Malthus zum meistzitierten Wissenschafter des Romans wird: Wer im Accord stirbt, wird bald darauf wieder "hochgefahren"; Geburten sind möglich, und dazu kommt noch der ständige Zustrom von der realen Erde - die Probleme verschlimmern sich in exponentieller Weise. Dass der Accord als Spiegelbild der realen Welt angelegt ist, wird erst spät als sein fundamentales Problem erkannt: Heaven should be the place you hope for, not the place you have failed to survive, sinniert die Politikerin Priscilla Burnham.
Die nie wirklich zustande gekommene Affäre zwischen Noah und Priscilla ist es, die sich als menschlicher roter Faden durch den ganzen Roman zieht. Nachdem Priscilla in vorauseilender Eifersucht von ihrem Mann, dem mächtigen Elector Jack Burnham, getötet wurde und Noah ihr in den Accord folgt, entwickelt sich daraus eine Jahre und schließlich Jahrhunderte währende Suche und Verfolgungsjagd unter sich laufend ändernden Rahmenbedingungen. Noah nutzt seine Sonderstellung als Architekt des Accord, um sich Handlungsmöglichkeiten zu sichern, die eigentlich gegen die selbstregulierenden Protokolle des Accord verstoßen. Und er offenbart dabei - obwohl er der Sympathieträger des Romans ist - durchaus skrupellose Züge: Etwa als es um die Rettung des Accord geht, indem man diesen vom überlasteten Netspace in den Quantenraum überträgt und damit in die Struktur des Universums selbst einschreibt. Der Transfer lässt die irdischen Info-Netzwerke zusammenbrechen und beschleunigt damit den Untergang der realen Welt. - Doch in Burnham (trotz seiner Eifersuchtsbesessenheit ebenfalls ein mehrdimensionaler Charakter) erwächst ihm ein ebenbürtiger Gegner, und die beiden liefern sich in der Folge einige Duelle, wie man sie von "Matrix" oder "Otherland" in Erinnerung hat.
Brooke fokussiert aber weniger auf Action als darauf, was die neuartige Lebensweise für Fragen aufwirft. Burnhams Weg illustriert dies in besonders bizarrer Weise: In der realen Welt wird er von einem virtuellen Killer ermordet, der einen menschlichen Körper als sweat bzw. ride steuert. Dieser Killer ist jedoch kein Individuum, sondern aus Fragmenten mehrerer virtueller Kopien zusammengesetzt, darunter sogar eine von Burnham selbst. Als die Polizei in einem Präzendenzfall die eigentlich schuldlosen Originale dieser Fragmente verhaftet, steht Burnham gleichsam für seine eigene Ermordung unter Anklage. In den Accord gelangt er nur über Umwege und wächst sich dort allmählich zu einem unheimlichen Mischwesen aus, das von sich als we spricht. We are a new kind of human being. We are remixed, reblended. We are something new altogether. We are. Wie überhaupt Sätze wie I am, She is, We are laufend wiederkehren und den existenzialistischen Grundzug des Romans auf den Punkt bringen. Philip K. Dick hätte "The Accord" aller Wahrscheinlichkeit nach sehr gefallen.
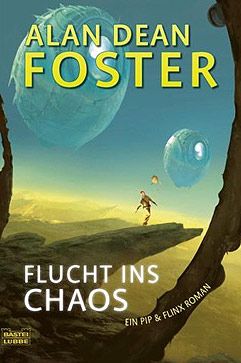
Alan Dean Foster: "Flucht ins Chaos"
Broschiert, 315 Seiten, € 9,20, Bastei Lübbe 2009.
Werfen wir zwischendurch mal wieder einen Blick darauf, was sich bei Pip & Flinx gerade so tut: Sonnyboy Philip Lynx und sein fliegendes, Gift spritzendes Mini-Drachenweibchen, die durch die Weiten des Homanx-Commonwealth im 30. Jahrhundert reisen. Und passend zur Jahreszeit geht es in den Urlaub: Nachdem Flinx in den vorangegangenen Bänden einige Abenteuer bestanden hat, auf die zu Beginn kurz verwiesen wird (danach werden sie keine Rolle mehr spielen), wird ihm von der Künstlichen Intelligenz seines Raumschiffs erklärt: "Sie müssen sich an irgendeinen interessanten Ort begeben und einige Energie mit Nichtstun verbrauchen. Es wäre für Ihre Gesundheit absolut notwendig."
Die Wahl fällt auf Jast, einen unbedeutenden Planeten auf halbem Weg zwischen dem Commonwealth und dem feindlichen AAnn-Imperium. Jast trägt ein Ökosystem, das auf Spezies beruht, die statt Beinen oder Flügeln mit natürlichem Methan gefüllte Blasen zur Fortbewegung nutzen, und Alan Dean Foster lässt es ordentlich schwirren, schweben und summen, um die kunterbunte Vielfalt des Planeten zu beschreiben. Diese Schwelgerei im Biologischen überträgt Foster auch auf die intelligenten Bewohner Jasts, die polypenähnlichen Vssey. Und das kommt nicht ganz so überzeugend daher: Foster gibt sich alle Mühe, die Auswirkungen der Vssey-Biologie auf deren Entwicklungsgeschichte, ihre Soziologie und ihr Verhalten zu schildern - und zwar nicht über externe Beobachter, sondern auch über die Gedanken der Vssey selbst. Das ist so, als dächten wir mindestens einmal pro Tag: "O wie praktisch ist es, einen opponierbaren Daumen zu haben." Oder als würden wir uns laufend vergegenwärtigen, dass wir uns in den Parks unserer Städte deshalb so wohl fühlen, weil sie uns unterschwellig dasselbe Gefühl von Sicherheit (gute Sicht nach allen Seiten, trotzdem ein paar schützende Bäume immer in Reichweite ...) vermitteln wie unseren Vorfahren. Mit anderen Worten: Das ist schriftstellerisch nicht sonderlich überzeugend.
Und mit der Erholung ist's natürlich sowieso nix. Jast steht vor der Übernahme durch das AAnn-Imperium; die Mehrheit der in jeder Beziehung langsamen Vssey nimmt die schleichende Eingliederung hin, eine radikale Minderheit wehrt sich. So gerät Flinx in ein Netz von Intrigen, Bürokratie und Terrorismus - und verliert bei einer Attacke sein Gedächtnis. Für einen Großteil des Romans wird er damit weniger ein selbständiger Charakter als eine Leerstelle bleiben, auf die die unterschiedlichen Fraktionen ihre Vorstellungen projizieren. Vom AAnn-Beamten Takuuna, der sich erst darüber empört, Kindermädchen eines Alien spielen zu müssen, und dann eine regelrechte Besessenheit in Sachen Flinx entwickelt, über die Künstlerkolonie, die den verwirrten Flinx in der Wüste aufliest, bis zum Vssey-Widerstand: Jeder schnitzt sich seinen imaginären Flinx nach seinen Bedürfnissen zurecht.
Pip & Flinx begleiten SF-Veteran Alan Dean Foster bereits seit 1972. "Flucht ins Chaos" (im Original "Sliding Scales") zählt mit Erscheinungsdatum 2004 zu den Spätwerken und auch eindeutig zu den schwächeren Teilen der Reihe. Lobenswert ist, dass jetzt der gesamte Romanzyklus herausgegeben wird - wünschenswert wäre allerdings auch eine einheitliche Übersetzung gewesen: So kommt es bei den Schreibweisen immer wieder zu kleineren Inkongruenzen (wobei das hier durchgängig verwendete Commonwelth einfach ein Fehler ist, zu dem sich leider auch einige andere gesellen). Von der Handlung her ein typischer Lückenfüller, könnte "Flucht ins Chaos" ideal für NeueinsteigerInnen sein, da es außerhalb der Rahmenhandlung um Flinx' Schlüsselrolle für den Fortbestand der Menschheit angesiedelt ist. Allerdings kann Flinx sich hier kaum als der sympathische Filou entfalten, als der er die Reihe so populär gemacht hat - daher doch besser mit einem anderen Band beginnen und den hier als etwaige Ergänzung der Sammlung betrachten. Leichte Sommerlektüre, besseres wird kommen.
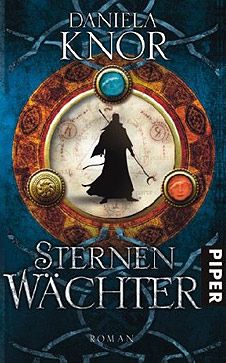
Daniela Knor: "Sternenwächter"
Broschiert, 426 Seiten, € 13,40, Piper 2009.
In der Vielzahl an deutschprachigen Fantasy-Titeln der vergangenen Jahre einer der besseren: "Sternenwächter" baut auf dem Vorjahresroman "Nachtreiter" (hier der Rückblick) auf - und man merkt an allen Ecken und Enden, dass sich Daniela Knor in ihre jüngste Weltschöpfung inzwischen eingeschrieben hat. Konsequent entfaltet Knor dabei die Karte dieser Welt weiter und weiter: Räumlich (es geht ins gebirgige Aldagar, wo Gerüchten nach Riesen hausen ... was sich nur allzubald bewahrheiten wird), aber auch zeitlich: Als der junge Nomadenkrieger Grachann jemandem begegnet, der beiläufig das Zeitalter vor der Steppe erwähnt, erscheint ihm dies unvorstellbar: Für ihn stand die Steppe stets am Beginn der Weltgeschichtsschreibung, ihre Erschaffung ist der früheste Mythos seines Volks. Doch die Kinder der Götter erinnern sich noch viel weiter zurück - erst recht schmerzt es sie, wie das Gedächtnis der Menschheit historische Entwicklungen, die sie selbst erlebt haben, verzerrt hat.
Zunächst muss Grachann eine Gerichtsverhandlung über sich ergehen lassen, der man ohne Kenntnis der Ereignisse in "Nachtreiter" nur schwer folgen kann. Kurzfassung: Grachann war an der Ermordung des Kriegsherrn der phykadonischen Nomaden beteiligt - doch weiß außer ihm und seinen Mitstreitern niemand, dass dieser von einem kriegslüsternen Dämon besessen war. Und ausgerechnet jetzt wird Grachann von seiner Kismegla, der Stammesschamanin, auf eine geheime Queste geschickt, durch die das kriegsverheerte Land der Phykadonier geheilt werden soll. Anstatt seinen Namen endlich reinwaschen zu können, muss er sich widerwillig vom Prozess davonschleichen und weiß, dass er vor seinem Volk umso mehr als Verräter gelten wird.
Nach Nordwesten zeigt der Kompass auch für die übrigen Hauptfiguren des Vorgängerromans: Die Adelige Sava, mittlerweile zur Priesterin Deartas mit Heilkräften geworden, der Ritter Arion, die nicht-ganz-menschliche Anidim und der Söldner Rodan, der stärker denn je darunter leidet, dass er einem geringeren Stand angehört als die ihn begleitenden Ritter ... deren "hohe Geburt" sich in ihrem Verhalten keineswegs widerspiegelt. Die Motive der Reisenden sind ebenso unterschiedlich wie ihre Routen - nur das Ziel wird ein gemeinsames sein: Das Land, wo Riesen und die Kinder der Götter wohnen. - Nur für einen geht es, fast schon symbolisch, in die andere Richtung: Regin, der in sich tief zerrissene Ritter, steht nun im Bann desselben Dämons, der zuvor Phykadonien in den Krieg trieb. Noch schneller als in Teil 1 zappt Knor zwischen all diesen Charakteren hin und her - glücklicherweise erzählt sie aber stets in der dritten Person, sonst würde man vom beständigen Umschalten irgendwann ziemlich wuschig im Kopf.
Der eingangs erwähnte Boom an deutschsprachiger Fantasy ist natürlich ein geförderter, denn in der Regel kommt es einen Verlag günstiger, AutorInnen in Landessprache zu veröffentlichen, als das Kostenpaket einer Übersetzung auf sich zu nehmen. Was uns unter anderem eine Welle an "Völkerromanen" beschert hat, die durchaus gut geschrieben und mit wunderschön klingenden Namen versehen sein können. Die aber andererseits so tief in der Tolkien-Motivik drinhängen, dass sie auf die Frage "Und warum soll ich das jetzt auch noch lesen?" nur selten eine befriedigende Antwort liefern. Dann doch lieber eine Eigenschöpfung von Grund auf. Natürlich hat auch Knors phykadonische Nomaden-Kultur ihre Parallelen - man denke nur an Joy Chants Welt der Khentorei in "Roter Mond und Schwarzer Berg" und dessen Folgeromanen -, doch ist die Palette an gesellschaftlichen Entwicklungsständen in der High Fantasy eben begrenzt ...

Sergej Lukianenko: "Das Schlangenschwert"
Broschiert, 648 Seiten, € 9,20, Heyne 2009.
Es war der Tag, an dem sich meine Eltern für den Tod entschieden. Das Sterberecht wird ihnen durch unsere Verfassung garantiert. Ich war ahnungslos. - Beinhart endet für den Romanhelden, den 13-jährigen Tikkirej, die Kindheit: Weil sich seine Eltern die Lebenserhaltungssysteme, für die man auf dem Bergbauplaneten Karijer zu zahlen hat, nicht mehr leisten können, scheiden sie freiwillig aus dem Leben, damit ihr Sohn länger vom Restbetrag zehren kann. Mit der "Abschiedsprämie" wird jemand finanziert, der Tikki jedes Jahr ein Geburtstagsessen zubereiten soll, herzlichen Glückwunsch! So bitterböse beginnt der 2001 veröffentlichte Roman, der erstmals 2007 bei Beltz auf Deutsch erschien und nun im Zuge der großen Lukianenko-Erfolgswelle auch bei Heyne herausgekommen ist.
Aber Tikki hat andere Pläne und einen festen Willen: Er heuert auf einem Raumschiff an, das ihn auf den deutlich lebenswerteren Planeten Neu-Kuweit bringt. Dort lernt er mit dem gleichaltrigen Lion und dem geheimnisvollen Stasj, einem Ritter vom Avalon, zwei neue Freunde kennen, übersteht eine Invasion durch den Nachbarplaneten Inej und rettet sich auf den Avalon, wo neben dem Schulbesuch auch Mithilfe an den Versuchen zur Rückeroberung Neu-Kuweits auf dem Tagesprogramm steht. Soweit ganz normale Stationen eines Abenteuerromans mit jugendlichem Helden, doch löst Lukianenko - der Mann kann eben schreiben - dies immer wieder in originelle Szenen voller Situationskomik auf: Etwa die medizinische Einstiegsuntersuchung vor Tikkis erstem Raumflug oder später seine naive Panik, sich unterwegs mit der Beulenpest angesteckt zu haben. Und der Ablauf der Invasion ist ebenso ungewöhnlich wie die im menschlichen Imperium praktizierte Raumfahrt-Variante: Als Modul fungierende Menschen lassen sich in ein Quasi-Koma versetzen, damit ihr Gehirn als Datenprozessor fungieren kann; die Langzeitfolgen eines Jobs als Gehirn in der Flasche freilich sind nicht ohne.
Wie immer würzt Lukianenko die Action mit Sinn für Humor. So schwingen die Ritter vom Avalon statt Laser- eben Schlangenschwerter (die offizielle Bezeichnung ist Plasmapeitsche) und räumen auch ein, dass Effekthascherei durchaus zu den beabsichtigten Wirkungen der ungewöhnlichen Waffe gehört - doch Dshedai werden sie gar nicht gerne genannt. Und Stasj räsoniert zwar über die beklagenswerte männliche Dominanz im Imperium - doch weint er der dunklen Epoche des Matriarchats, die dem Raumfahrtzeitalter voranging (da haben wir was verpasst!), keine Träne nach.
Sergej Lukianenko entspinnt seine Romanhandlungen gerne um Männer in mittleren Jahren, die das tun, was eben zu tun ist, trotzdem einen Hang zur Sentimentalität haben (spezielll unter Alkoholeinfluss), und dann auch redselig und philosophisch werden. - Die gibt's auch hier, doch nur als Einflussfaktoren auf Tikki, und Lukianenko versteht es recht gut, sich in die Perspektive eines 13-Jährigen zu versetzen und dessen (mangelnde) Erfahrungen, Prioritäten und vor allem dessen große Ernsthaftigkeit glaubhaft zu schildern. - Als logischer Schwachpunkt erscheint hingegen, dass mit Tikki und Lion zwei Halbwüchsige in einen gefährlichen Spionageeinsatz geschickt werden. Erscheint deshalb, weil es dafür nachträglich eine bessere Erklärung geben wird als die doch etwas bemühte Handlungskonstruktion, mit der die beiden (und der Leser) auf die Reise geschickt werden. Bis zu dieser Aufklärung im etwas überhasteten Schluss kann da schon streckenweise der Eindruck aufkommen, man verfolge Wesley Crusher im Einsatz - erst recht als Tikki und Lion auf eine Truppe ebenfalls 13-jähriger Neo-Partisaninnen (vormals das Hip-Hop-Ensemble "Lustige Tollkirschen" ...) trifft.
Ach ja, und angesichts der im Roman vorkommenden Namen suggeriert Lukianenko einmal mehr, der Weltraum wurde primär von Russen kolonisiert. Andererseits wundern wir uns ja auch nie, dass angloamerikanische Autoren ihrerseits meist nach dem gleichen Prinzip vorgehen; also passt das schon so, wie's ist. Insgesamt ist "Das Schlangenschwert" keines von Lukianenkos größten Werken, aber es hat seine Momente. Nicht zuletzt Überraschungsmomente.

Greg Keyes: "Die Schatten Gottes"
Broschiert, 477 Seiten, € 9,20, Blanvalet 2009.
Alles geht einmal zu Ende, sogar Greg Keyes' epische Saga vom "Bund der Alchemisten". Dass der abschließende vierte Band endgültig nichts mehr für NeueinsteigerInnen ist, war auch dem Autor klar, weshalb er umsichtigerweise dem Text ein sechsseitiges "Was bisher geschah" vorangestellt hat. Das kann zwar nicht das komplexe Beziehungs- und Konfliktgeflecht zwischen den unzähligen ProtagonistInnen wiedergeben, aber immerhin einen guten Überblick über die Weltlage in einem frühen 18. Jahrhundert, das zum Glück nie war, bieten. (Einen weiteren Rückblick zum vorangegangen Teil finden Sie hier.)
Alle Hauptfiguren bewegen sich nun mit ihren Teams auf den Schauplatz der entscheidenden Schlacht zwischen den freien Menschen und den Armeen der Äther-Bewohner, der Malakim, zu. Da ist zum einen Benjamin Franklin, der wegen seiner Erfindungen als der Zauberer von Amerika gilt, inzwischen aber vor allem Staatsmann ist – und zwar einer in Kriegszeiten. Seine Suche nach Allianzpartnern führt ihn zum französischen Exil-König nach New Orleans (respektive New Paris), das zwar eine Melange aus versifftem Kaff und Versailles-Travestie ist, zugleich aber auch die letzte Hoffnung auf Verbündete. – Einer der Reize am "Bund der Alchemisten" ist, dass er in einer Epoche spielt, da Nordamerika auch in unserer Zeitlinie noch ein mulitikultureller Flickenteppich war. Englische, spanische und französische Kolonien in unterschiedlichen Graden der Unabhängigkeit, dazu die Gebiete der Ureinwohner, die damals noch ein Jahrhundert vom "Pfad der Tränen" – der Vertreibung über den Mississippi – entfernt waren: Leicht hätte in dieser heterogenen Ansammlung die Geschichte einen anderen Verlauf nehmen können ... wenn auch keinen so exotischen wie hier.
Die zur Meisteralchemistin aufgestiegene Adrienne de Mornay de Montchevreuil wiederum schlägt sich nicht nur mit ihrem Gefolge von JungwissenschafterInnen durchs kriegsverheerte Gelände. Sie nähert sich auch langsam dem wahren Wesen der Malakim an, indem sie die ätherischen Muster hinter der Maske der Materie zu erkennen beginnt (wobei der Äther nicht den Himmel, sondern die subatomare Ebene meint). Immer wieder muss man sich in Erinnerung rufen, dass im Konflikt zwischen Wissenschaft und Magie hier die Alchemie die Rolle der vom Menschen praktizierten – und funktionierenden – Wissenschaft spielt. "Magie" hingegen ist es, wenn die Malakim die Kräfte des Äther an die Menschen verleihen, um diese von sich abhängig zu machen und dumm zu halten: Eine Strategie, die in der geplanten Ausrottung der Menschheit gipfeln soll. Adrienne und ihre Gefährten erkennen nicht nur, dass hinter dem monumentalen Konflikt lediglich zwei Entitäten stecken .... so ganz nebenbei entwickeln sie zum Vergnügen des Lesers auch alchemistische Entsprechungen von Quantenmechanik und String-Theorie. Überhaupt spielt Keyes wieder viel mit Theorien, Philosophien und politischen Ideologien. Und zwischen all dem Offensichtlichen zieht sich die gnostische Weltanschauung, dass nicht Gott, sondern von ihm ernannte Stellvertreter die Welt gestaltet haben, ebenso durch die gesamte Tetralogie wie die Vorstellung, dass die Ereignisse im Mikrokosmos und die im Makrokosmos einander widerspiegeln.
... was nicht heißen soll, dass die Action zu kurz käme – schließlich herrscht Krieg und zimperlichen Umgang mit Gewalt kann man keinem/r der Beteiligten mehr attestieren. – "The board is set. The pieces are moving", wie Gandalf schon sagte. Zwei alles entscheidende Figuren haben ihre Seite jedoch noch nicht gewählt: Adriennes von den Malakim entführter Sohn Nicolas, der nun als Sonnenjunge deren Heer anführt. Und Franklins einstiger Weggefährte, der junge Choctaw-Schamane Red Shoes, der seit Teil 3 einen Dämon in sich trägt und vor einem Dilemma steht: Ich bin ein verfluchtes Wesen, das versucht, Gutes zu tun, bevor seine Seele sich auflöst und keine Wahl mehr hat. Der Ausgang ist ungewiss, der Einsatz das Überleben der Menschheit.
Ein wenig schade ist, dass nicht mehr zu den europäischen Schauplätzen zurückgekehrt wird – andererseits bestimmten diese die ersten beiden Teile der Tetralogie; die Konzentration auf Übersee in Teil 3 und 4 bildet somit im Grunde das ausgleichende Gegengewicht in einer Rahmenhandlung, die auf globaler Ebene stattfindet. Und es lässt sich konstatieren, dass die fantastische Saga insgesamt zu einem runden Ende gebracht wird. Natürlich kommt das eine oder andere dabei zu kurz – aber das ist ja auch kein Wunder, wenn erst mal so viele Fässer aufgemacht wurden. Die Macher von "Lost" werden davon noch ein Lied singen können.
In der nächsten Rundschau herrscht erhöhter Flugverkehr: Dunkle Schwingen, Superhelden mit flatternden Capes und diverse Raumschiffe. Kopf einziehen! (Josefson)