
Sean Williams: "Die Spiegelzwillinge"
Broschiert, 575 Seiten, € 15,95, Otherworld 2009.
Huiuiui, hab ich da falsch gelegen. Aus irgendwelchen Gründen kam ich auf die Idee, dass dies hier ein Jugendbuch wäre. Stattdessen handelt es sich um einen in jeder Beziehung fantastischen Trip, der in höchste Höhen und tiefste Tiefen führt wie Moebius' "Incal"-Reihe, der er auch in der Vorliebe für Dualitäten ähnelt - und der in ein gleichermaßen die Realität umstülpendes Finale münden wird. Ein trotz abgeschlossener Handlung vorläufiges Finale, immerhin ist dies "nur" der Auftakt einer Tetralogie, der "Bücher des Kataklysmus": Das bislang aufwändigste Werk des australischen Autors Sean Williams, der es in relativ kurzer Zeit zu einer Reihe von Auszeichnungen und einem erstaunlich umfangreichen Schaffen gebracht hat; selbst wenn man seine Beiträge zum "Star Wars"-Universum nur halb rechnet. Hier ist Williams jedenfalls zur Hochform aufgelaufen.
Im Brennpunkt aller Ereignisse steht ein junges Zwillingspaar, Seth und Hadrian Castillo. Sie sind eineiige, aber seitenverkehrte "Spiegelzwillinge" - eine Variante, die nur ganz genauen Betrachtern oder einem Anatomen auffallen würde; bei Hadrian sitzt sogar das Herz auf der rechten Seite. Als Rucksacktouristen trampen die beiden jungen Aussies durch Europa. Unterwegs haben sie die gleichaltrige Ellis, ebenfalls aus Australien, aufgegabelt, was eine Dreierkonstellation von einiger zwischenmenschlicher Brisanz (und noch ungeahnter Bedeutung) ergibt. Viel wichtiger zunächst aber derjenige, der die drei seit einiger Zeit verfolgt und sie in Stockholm schließlich stellt. Dessen Worte bleiben seltsamerweise unübersetzt - für alle diejenigen, die nicht zufällig am Polarkreis studiert haben: Der entscheidende Satz, als der Fremde Seth tötet, bedeutet "Das macht für Yod keinen Unterschied!". Trost wäre das aber ohnehin für keinen aus der nun gesprengten Trinität. Was sie noch nicht wissen, ist, dass der Mord einen lange erwarteten Mechanismus in Gang gesetzt hat: Der Kataklysmus beginnt.
Hadrian, beim Attentat ebenfalls verletzt, wacht im Krankenhaus auf und wird von einem sehr seltsamen Ermittler befragt. Vage Eindrücke von Stromausfällen und Verkehrszusammenbrüchen schaffen eine bedrohliche Atmosphäre: Randerscheinungen der anstehenden Umwälzung. Den eigentlichen Untergang verschläft er wie vor ihm Jim in "28 Days Later" und vor diesem William Masen in den "Triffids". Schon ab dem nächsten Erwachen ist panische Flucht angesagt - ein gnomenhaftes Wesen namens Pukje wird dabei zu Hadrians erstem Führer durch eine menschenleere Stadt und Welt. Später schließt sich ihm sogar eine veritable Gottheit der Antike an, die mit der Moderne bislang aber recht gut zurecht kam: Als Göttin der Urbanität kurvt Kybele in einem Boliden, der aus Aphex Twins "Windowlicker" entsprungen sein könnte, durch die Straßen dessen, was nicht länger Stockholm oder Rio oder Peking ist, sondern eher ein Jungscher Archetypus der Stadt an sich. Die herkömmliche Geografie löst sich auf, der Kataklysmus schreitet voran.
Auch für den getöteten Seth ist die Reise aber noch lange nicht zu Ende: Durch die Leere zu treiben lässt sich mit seinen Vorstellungen vom Jenseits noch vereinbaren - nicht aber, auf eine kopfunter hängende Ruinenlandschaft voller metallischer Dämonen zu prallen, die sich in der Folge als die "Außenseite" einer fantasmagorischen Hohlwelt entpuppen wird: Das Zweite Reich, wie Seth erfahren wird, denn auch er erhält in Form des Stachel- und Klingen-bewehrten Xol, der einst ein Mensch war, einen kundigen Führer zur Seite gestellt. Von nun an laufen die Wege der beiden Brüder in den beiden Welten parallel; ihr gemeinsames Ziel muss es sein, den großen Plan, für den ihre Trennung Mittel zum Zweck war, zu durchkreuzen.
Die surrealen Welten, die Williams in beeindruckender Bildhaftigkeit heraufbeschwört, können sich mit denen eines R. A. Lafferty oder Christopher Priest messen - und dabei erweckt nichts den Eindruck, als wäre es reiner Willkür (oder der Imagination eines planlosen Autors) entsprungen. Stattdessen handelt es sich um ein Spiel mit komplexen Regeln, die anfangs noch unverständlich wirken mögen, dann aber immer deutlicher das dahintersteckende überaus exakte Gerüst erkennen lassen und sich schließlich zu einem hermetischen Ganzen vereinigen werden. Jede Person, jede Gruppierung, jede Handlung und jeder Gegenstand - alles ist bedeutungsbeladen und in einen Kontext eingepasst. Konsequent setzt Williams dabei von Anfang an auf Mythologisierung: Er baut ganze Ethnologien und Hierarchien mythologischer Wesen auf. Teilweise greift er dabei griechisch-römische, hinduistische, mesoamerikanische und unzählige andere Mythologien auf, teilweise erschafft er im Stil von Clive Barker oder H. P. Lovecraft eigene und verschmilzt beides zu einem erstaunlich stimmigen Ganzen. "Studiert denn heute niemand mehr Altphilologie?" wird Williams einmal aus dem Mund Kybeles seufzen, als Hadrian im Getümmel übernatürlicher Wesen die Übersicht verliert.
Apropos Lovecraft: Mit dessen Werken verbindet "Die Spiegelzwillinge" (im Original: "The Crooked Letter") nicht nur der oberflächliche Umstand, dass es um das Eindringen eines archaischen Gottmonsters namens Yod in unsere Welt geht, die Gemeinsamkeiten reichen tiefer. Denn soviele Gottheiten auch im Spiel sein mögen, religiös ist die Grundausrichtung des Romans nicht. Wenn Kybele von den Göttern und deren Plänen erzählt, dann tut sie dies mit dem Vokabular der Biologie, spricht von Nahrungsketten, Wettbewerb, Artenvielfalt und den wiederkehrenden Mustern des Lebens, denen auch überirdische Wesenheiten unterworfen sind. Wie bei Lovecraft ist hier keine lenkende (und schon gar keine gütige) Hand im Hintergrund zu erkennen, es geht ganz darwinistisch um die Evolution immer neuer Generationen von Wesen und ihren erbarmungslosen Kampf um Ressourcen: "Wenn man stillsteht und auf einen Heiligenschein wartet, wird man gefressen." - Ein beeindruckender Auftakt; der nächste Band wird im September unter dem Titel "Die Blutschuld" erscheinen.
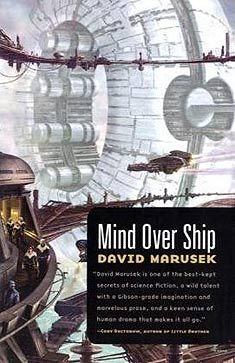
David Marusek: "Mind Over Ship"
Broschiert, 320 Seiten, Tor Books 2010.
"We live in a boutique economy now. Energy is abundant and cheap. Mentars and robotic labor make and manage everything. So who needs people? People are so much dead weight. (...) I think we can all agree that Corporation Earth is in need of a serious downsizing." - Und genauso herzlos wie hier geäußert wird die Wirtschaft in den United Democracies der Erde auch gesteuert. Wie schon in seinem Roman "Counting Heads" (hier der Rückblick) zeichnet der großartige David Marusek auch in der Fortsetzung "Mind Over Ship" ein überwältigendes Panorama der Welt im Jahr 2135 - oder besser gesagt Welten, Plural: Der der superreichen affs, ihrer Pläne und Intrigen - und der der geklonten iterants, die sämtliche Dienstleistungsarbeiten erledigen und die Auswirkungen dieser Pläne am eigenen Leib zu spüren bekommen: Das "Upstairs, Downstairs"-System, angewandt auf die Science Fiction.
Marusek zwingt den Leser zu ständiger Umorientierung, wo die "eigentliche" Haupthandlung verläuft. Wie ein Wirtschaftskrimi aus der High Society liest es sich, wenn die Besitzerin des Klon-Konzerns Applied People ihre Marktanteile an den Konkurrenten Capias World verliert. Ein Gesicht bekommt das Ganze aber erst, wenn der altgediente Sicherheitsspezialist Fred Londenstane aus der Applied People-Klon-Linie der russes einen Job auf einer Raumstation antritt, wo ihm die neue Capias-Konkurrenz der donalds - besser für Arbeiten in der Schwerelosigkeit adaptiert und gleichzeitig ein Stückchen weiter vom herkömmlichen menschlichen Erscheinungsbild abgerückt - einen wahren Spießrutenlauf in Form eines Spucke-Regens beschert: Es sind solche kleinen Szenen, die die großen im Roman beschriebenen Trends anschaulich machen und betonen, dass Marusek stets eine sehr, sehr menschliche Perspektive einnimmt. Was bei einem derart fortgeschrittenen Grad an Transhumanität eine Leistung für sich ist: Siehe etwa das nanotechnologische nitwork - man stelle sich einfach vor, von der Darmflora bis zur omnipräsenten Feinstaubbelastung wäre alles Bestandteil eines weltumspannenden Kommunikationsnetzwerks. Nicht zu vergessen die im vorigen Band zu Tode gekommene Unternehmerin Eleanor Starke, die nun als wahrhaft transhumane Existenz weiterlebt - in einer Form, die man so g-a-r-a-n-t-i-e-r-t noch nicht gelesen hat. Auch wenn ihr selbst die neue Existenzform nur ein nüchternes "I am alive but currently between bodies" entlockt.
Eine ganz andere Gegenüberstellung als die zwischen Ober- und Unterschicht bietet gleich zu Beginn eine Passage in ebenso zynischer wie wunderschön durchgeführter Weise. Ein neu hergestellter mentar, also eine künstliche Intelligenz, muss zu sich finden: Lyra. Die Klon-evangeline Mary und einige Krankenschwestern unterstützen Lyra dabei und betonen, wie wichtig eigene Entscheidungen für die Persönlichkeitsentfaltung sind. Gleich darauf werden sie von einem Arzt instruiert, wie sie mit ihrer menschlichen Patientin Ellen - Eleanor Starkes Tochter, die beinahe demselben Unfall zum Opfer fiel wie ihre Mutter - zu verfahren haben: Unerwünschte Gedankengänge in Ellens sich neu "verdrahtendem" Gehirn sollen unterbunden werden. Dazu drückt man den Schwestern kleine clickers in die Hand, die sie bei jeder falschen Äußerung Ellens betätigen müssen. Ganz wie im Hunde-Training.
Den großen Rahmen für die Handlung von "Mind Over Ship" liefert das bereits im Vorgänger-Roman erwähnte Garden Earth Project, das der Wiederbegrünung der übervölkerten Erde dienen soll: Im Austausch für Land erhalten dessen EigentümerInnen Platz auf Kolonieschiffen, die in andere Sternensysteme geschickt werden sollen ... bis es sich die Projekt-TeilhaberInnen anders überlegen, weil orbitale Weltraumhabitate mehr Kohle einbringen könnten. GEO-Mitbegründer Merrill Meewee hat in der Folge alle Hände voll zu tun: Zum einen mit der totgeglaubten Eleanor, die ihm aus ihrer nicht zu fassen kriegenden neuen Existenzform ständig geisterhafte Botschaften übermittelt. Und zum anderen damit, KolonistInnen in spe gegen den Vertragsbruch seiner GEO-PartnerInnen zu mobilisieren. Ein bunter Haufen kommt da zusammen: Eines der Schiffe hat eine Sekte gebucht, ein anderes eine Ansammlung von Klonen prominenter affs, die als deren Organspender oder Bodydoubles vorgesehen waren, durch technisches Missgeschick aber zu eigenem Bewusstsein gelangten.
Einmal mehr erweist sich hier Maruseks Vermögen, eine Grundidee bis zu ihren bizarrsten Folgeerscheinungen weiterzudenken. Und das gilt sogar für die Ideen anderer: Die hehren Visionen eines Hugo Gernsback werden hier zur Karikatur, wenn sich auf den automatischen Laufbändern zwischen den urbanen Gigatowers eine kleine Fehlfunktion einschleicht und tausende PassantInnen zu einem rotierenden Chaos zusammengequetscht werden, das fliegende Roboter mit Sedativa besprühen. Schlicht unüberbietbar aber bleibt die von Marusek ersonnene Möglichkeitenpalette an körperlichen und in den Realraum projizierten virtuellen Existenzformen, die einander so durchdringen, dass sie eine vollkommene Neudefinition des Ortssinnes erfordern.
Alles ist möglich? Nicht ganz. Wer "Counting Heads" gelesen hat und sich nun wundert, wo die dritte Handlungsebene um die charterists abgeblieben ist: Marusek hat sie kurzerhand gestrichen. Ursprünglich aus einem rein erzählerischen Dilemma heraus, dann jedoch mit Vorsatz, wie er in einem Interview erklärte. Charterists sind der dritte Zweig der Menschheit; weder superreich noch geklonte DienstleisterInnen, verkörperten sie die Mittelschicht - und für die ist in der sich weiter und weiter wandelnden Gesellschaft einfach kein Platz mehr. Mary bringt es auf den Punkt: Capitalism was a marvel, as long as you were a capitalist. - Übrigens ist beim neugegründeten Golkonda-Verlag eine Übersetzung von David Maruseks früheren Werken ins Deutsche angedacht. Wird spannend sein zu sehen, wie da die Fülle an Neologismen gehandhabt wird, die Marusek mit größter Selbstverständlichkeit verwendet und die entscheidend zu dem ungeheuer authentischen Eindruck beitragen, den die von ihm entworfene Welt vermittelt. Alle, die sich von Englisch nicht einschüchtern lassen, können "Mind Over Ship" derweil immerhin in der günstigeren Paperback-Version erwerben, die vor einem Monat erschienen ist. Einmal mehr: Großer Autor, große Empfehlung!
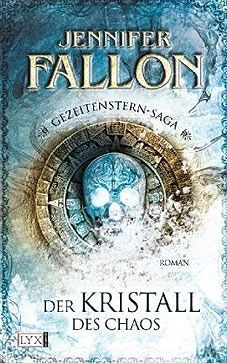
Jennifer Fallon: "Gezeitenstern-Saga 4: Der Kristall des Chaos"
Broschiert, 569 Seiten, € 15,40, Lyx 2010.
Ewig schade, die "Gezeitenstern"-Saga ist nun tatsächlich zu Ende gegangen. Dazu ist es hier angebracht, sowohl vor- als auch zurückzuschauen: Letzteres über die Links zu den Rezensionen von Teil 1, Teil 2 und Teil 3, ersteres in Form einer Warnung: Leute, lest bei einer etwaigen Online-Bestellung bloß nicht die Amazon-Bewertungen. Da haben sich nämlich gleich einige Kamikaze-KritikerInnen, die mit dem - fraglos diskussionswürdigen - Ende der Tetralogie nicht einverstanden sind, ihren Frust in Form von Totalspoilern von der schwarzen Seele geschrieben. Scheiße, sowas.
Für alle, die nun zum ersten Mal vom "Gezeitenstern" lesen, hier noch einmal kurz die Prämisse: Es geht um eine Gruppe Unsterblicher, die sich Jahrtausende lang inkognito in den diversen Königreichen der Welt Amyrantha herumgedrückt haben. Mit dem Einsetzen der kosmischen Flut, die ihnen nach langer Durststrecke wieder Zugang zur Gezeitenmagie verschafft, erlangen sie auch ihre zusätzlichen - und reichlich weltzerstörerischen - Fähigkeiten zurück und können endlich mal wieder so richtig die Sau rauslassen. Man stelle sich in etwa vor, die Ewings wären von der Southfork Ranch auf den Olymp übersiedelt und hätten dabei die Manieren der Flodders mitgebracht. Denn für die sterblichen BewohnerInnen Amyranthas mögen die Gezeitenfürsten ja eine einheitliche Bedrohung darstellen - untereinander präsentieren sie sich als zerstrittener, intriganter, hämischer Sauhaufen (so die Selbsteinschätzung), der nichts lieber tut, als sich wechselseitig das unsterbliche Leben schwer zu machen: Die Kuh der Zicke, die Schlampe dem Scheusal und so weiter. Als Kollateralschaden lösen ihre Streitigkeiten globale Katastrophen aus - und es ist genau diese Diskrepanz zwischen welterschütternden Ereignissen und salopper Sprache, die den Erzählton prägt und Jennifer Fallons Reihe über fast 2.400 Seiten hinweg so unterhaltsam machte.
Ein wenig drängt sich der Eindruck auf, die Autorin, die sich in den Vorgängerbänden als Königin der Cliffhanger erwiesen hat, hätte ihren letzten - den zwischen Band 3 ("Palast der verlorenen Träume") und dem "Kristall des Chaos" - an der falschen Stelle gesetzt. Zuvor ließ Fallon die LeserInnen am Romanende stets mit umwälzenden Neuigkeiten zurück - am Ende des "Palasts" erfuhr lediglich die Protagonistin Arkady Desean, dass ihr lange totgeglaubter Vater noch am Leben ist. Big Deal. Dafür kommt's nun gleich zu Beginn von "The Chaos Crystal" (im Original 2008 erschienen) knüppeldick: Erst wird bekannt, dass die ältesten Unsterblichen nicht tausende, sondern Millionen Jahre auf dem Buckel haben und nicht nur von der Welt schmarotzen, sondern sie weitgehend auch erschaffen haben. Und kaum hat die Unsterbliche Maralyce die Bombe platzen lassen, dass sie und ein paar andere gar nicht von Amyrantha stammen, da geht auch schon die nächste hoch: Jetzt wollen sie nämlich auf den nächsten Planeten weiterziehen. Der Haken an der Sache: Wenn sie ihr kosmisches Portal erst einmal durchschritten haben, bleibt von Amyrantha erfahrungsgemäß "nicht mehr viel Welt übrig". Nicht dass sie das groß scheren würde.
In der Folge werden also Arkady und ihr ehemaliger Jugendfreund Declan Hawkes, der inzwischen durch einen Unfall selbst zum Unsterblichen wurde und sich zunehmend im seelischen Zwiespalt befindet, alle Hände voll zu tun haben, um den anstehenden Weltuntergang aufzuhalten. Ein erstes Scharmützel zwischen verfeindeten Gezeitenfürsten, das eigentlich nur der Verhinderung einer noch größeren Schlacht dient, bläst schon mal ein paar zehntausend Lebenslichter aus: Ein erster Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen mögen. Währenddessen werden unwahrscheinliche Allianzen geschmiedet, Intrigen gesponnen, Triebe befriedigt, Wortgefechte ausgetragen, Demütigungen genossen und Machtspiele betrieben, als gäb's kein Morgen ... was ja durchaus der Fall sein könnte. Fallon führt dafür noch einmal das gesamte umfangreiche Personal der vorangegangenen Bände zusammen, und wie von ihr zu erhoffen hält sie auch noch einen Extra-Twist parat: Denn letztlich ist der Anlass aller Aktivitäten ein ganz anderer als gedacht. Nicht immer geht es gut, wenn eine Geschichte in ihren Sequels nachträglich zurechtgebogen oder gleich über den Haufen geworfen wird, um noch einmal einen Überraschungseffekt zusammenzukrampfen (siehe etwa die "Scream"-Reihe). Anders sieht es aus, wenn eine Geschichte von Anfang an als Mehrteiler geplant ist und die Puzzleteile für eine spätere Umdeutung sorgsam ausgelegt werden können. Hier wird jedenfalls eine - großzügig ausgedrückt - "Nebenfigur" der vorigen drei Bände plötzlich ganz unvermutet im Zentrum stehen. Da dürfen jetzt alle mal hübsch raten.
Tja, und dann wie gesagt das Ende. Aber selbst Klassiker der Phantastik sind ja nicht vor einem Schluss gefeit, der als umstritten oder enttäuschend oder zumindest seltsam in die Annalen eingeht - siehe etwa Philip K. Dicks "Orakel vom Berge" oder Margaret Atwoods "Report der Magd" (von der "Matrix"-Trilogie ganz zu schweigen ...). Fallons Finale ist gleichermaßen lustig und traurig, übertrieben und unbefriedigend, erwartet und überraschend, unpassend und angemessen - das muss jeder für sich bewerten. Und was auch immer man davon halten mag - davor standen tausende Seiten purer Unterhaltung. Das lässt sich über High Fantasy-Serien heutzutage bei weitem nicht immer sagen.
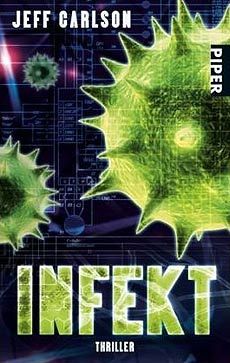
Jeff Carlson: "Infekt"
Broschiert, 407 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
Dabei hätte alles so schön sein können ... oder wenigstens so schön es halt geht, drei Jahre nach dem globalen Ausbruch eines Nano-Virus, das den größten Teil der Menschheit und mit ihr alle Säugetiere und Vögel unterhalb von Hochgebirgslagen ausgelöscht hat. Die überlebenden ProtagonistInnen der beiden Vorgängerromane (hier der Rückblick) haben sich jedenfalls mit den Umständen arrangiert. Cam Najarro und Ruth Goldman leben nun in einer Siedlung mit ein paar Dutzend Menschen im Hinterland von Colorado. Man ist zwar von Kopf bis Fuß zernarbt und verliert schon mal ein Gewächshaus oder auch einen Nachbarn an das Eindringen eines gefräßigen Insektenschwarms - aber alles in allem ist endlich ein kleines bisschen Ruhe eingekehrt. Cam hat sogar eine Frau gefunden und steht kurz davor Papa zu werden.
... da klopft auch schon die nächste Welle der Seuche an die Tür. Wieder hat jemand einen neuen Nano entwickelt - diese Version (Gehirnseuche wird man sie bald nennen) treibt ihre hirntoten Opfer dazu, andere Menschen zu suchen und zu infizieren. Nüchtern gesagt: Carlson gelingt es damit, etwas Zombie-Motivik ins Spiel zu bringen. Einmal mehr müssen Cam und Ruth also eine vorübergehende Sicherheit aufgeben und sich wieder ins Gewirr militärischer Machtkämpfe vorwagen. Das von der US-Regierung verwaltete Gebiet ist zu dieser Zeit nur noch eine lose Ansammlung von Hoheitsgebieten und Stadtstaaten, regiert von Generälen, Farmern und Ingenieuren sowie dem einen oder anderen selbst ernannten Messias. Nicht zu vergessen die Gebiete im Westen, die mittlerweile in der Hand chinesischer und russischer Invasoren sind. Dort liegt auch der Ausgangspunkt der Gehirnseuche, und mit dem rücksichtslos karrierebewussten Oberst Jia Yuanjun baut Jeff Carlson einen interessanten Gegenspieler auf, der zu differenziert dargestellt wird, um als bloßer "Schurke" schubladisiert zu werden. Zwar versteigt sich der Autor beim Entwurf geheimer schwuler Seilschaften in der chinesischen Armee zu reichlich befremdlichem Gender-Psychologisieren, aber sei's drum.
"Infekt" (im Original: "Plague Zone") bietet fraglos reichlich Spannung, vor allem unter Military-Aspekten. Die eindringlichsten Passagen sind aber diejenigen, wo es ums nackte Überleben in einer Umwelt geht, die genauso hässlich, deprimierend und gefährlich ist wie die in Peter Watts' "Rifters"-Trilogie. "Wenn du atmest, stirbst du", fasst Cam die omnipräsente Nano-Bedrohung einmal anschaulich zusammen. Und liest man, wie sich Ruth in ihrem Zelt verbissen ebenso aufwändigen wie unzulänglichen Dekontaminierungsprozeduren unterzieht, bildet sich einem unweigerlich ein Kloß im Hals.
Allerdings lässt sich auch der Eindruck nicht ganz verwischen, dass hier einiges an Chancen vergeben wurde. Carlson konzentriert sich hauptsächlich auf die offenbar nicht enden wollenden Nachfolgekriege der Nano-Katastrophe. Genozid versus Gegengenozid scheint mittlerweile zum einzigen Mittel der Kriegsführung geworden zu sein; auf jeden Fall aber zu einem System, das sich verselbstständigt hat (ein paar Atomschläge hier und da sind da fast schon Randerscheinungen). Wenig wird auf die ökologischen Aspekte eingegangen. Carlson erwähnt einmal, dass sich die massiven Veränderungen in der Tierwelt auf den Pflanzenbewuchs ausgewirkt haben, was wiederum eine kontinentweite Erosion auslöste und das halbe Tiefland in Wüsten oder Sümpfe verwandelte. Aber das bleibt bei einer kurzen Anmerkung - dabei wären zum Abschluss einer Trilogie Aspekte, die der Zukunft und dem möglichen Überleben darin zugewandt sind, auch nicht ganz irrelevant.
Im Nachwort stellt Carlson noch einmal ausdrücklich fest, dass es sich um eine Trilogie handle. Da wäre aber schon ein Abschluss zu erwarten, der alle Handlungsfäden zusammenführt und für's große Finale noch einmal eins drauf setzt - siehe etwa die "Gezeitenstern"-Reihe auf der vorigen Seite. Stattdessen weist "Infekt" einen Handlungsablauf auf, der im Wesentlichen dem Schema von Teil 2 folgt: Eine neue Nano-Welle breitet sich aus. Es muss zu einem Labor mit möglichen Impfstoffen vorgedrungen werden. Ein Krieg mit unübersichtlichen Konfliktlinien erschwert das Vorgehen. Und die Figuren sind hin- und hergerissen zwischen Humanität und Feindabwehr mit allen Mitteln ... was letztlich irgendwie doch immer damit endet, dass man wieder einen neuen Killer-Nano konstruiert (an einer Stelle spielt Ruth sogar kurz mit dem Gedanken, alles menschliche Leben einfach auszulöschen, damit endlich Ruhe ist). Diesen Ablauf kennt man schon aus Teil 2, von einem klaren, neue Verhältnisse schaffenden, Abschluss kann nicht wirklich gesprochen werden. Im Prinzip könnte Carlson nach diesem Schema einen Roman nach dem anderen dranhängen.
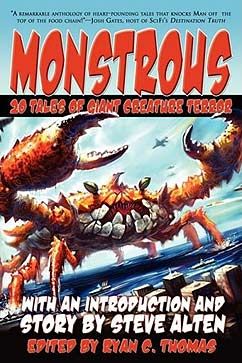
Ryan C. Thomas (Hrsg.): "Monstrous"
Broschiert, 268 Seiten, Permuted Press 2009.
Kein Mann rede sich etwas anderes ein: Size obviously matters, wie im Vorwort der Anthologie "Monstrous" klargestellt wird, die mit 20 Kurzgeschichten der guten alten Pulp-Tradition huldigt. Dieses Vorwort stammt von Steve Alten und wird werbewirksam schon am Cover angepriesen - immerhin hat es Alten mit seiner reißerischen "MEG"-Reihe über den (fast! nur fast!) ausgestorbenen Riesenhai Megalodon zu großer Popularität gebracht. (Stop. Reißerisch? Das beschreibt es nicht einmal annähernd. Immerhin wird in Teil 1 der Held verschlungen, um sich dann - mit einem abgebrochenen Haizahn!!! - aus dem Magen quer durchs Innere des Tiers durchzuschneiden und diesem schließlich mit bloßen Händen das Herz herauszureißen. HA! Das soll erst mal jemand überbieten.) Parallel zu "MEG" ist Alten übrigens der aktuellen Apokalypsen-Mode gefolgt und macht in Maya. Sein Anthologie-Beitrag "Lost in Time" ist abgesehen davon, dass er die Menschen als die eigentlichen Monster darstellt, weniger bemerkenswert; andere können denn doch besser schreiben. Zum Beispiel Nate Kenyon, der in "Keeping Watch" Lovecraftsche Beklemmungen hervorruft.
Überhaupt ist Größe relativ zu verstehen. Bei Filzläusen reichen ja auch schon Medizinball-Dimensionen, um für ordentlich Schreck und Graus zu sorgen: Das erfahren sowohl die Protagonisten von Randy Chandlers "Cooties" als auch die Weltkriegssoldaten in Patrick Rutiglianos ekeligem Beitrag "The Enemy Of My Enemy" am eigenen Leib. So spielt sich denn auch einiges an Monströsem in einem Bereich ab, für den es im Englischen den schönen Begriff Creepy Crawlies gibt - mit nach oben offenen Grenzen. Schreibtischgröße erreichen die zangenbewehrten Käfer, die in Aaron A. Polsons "A Plague From The Mud" aus den Urwäldern Oregons hervorbrechen, Kuhgröße die nicht minder schnippelfreudigen Meeresfrüchte in "Crabs" von Guy N. Smith. Das ist übrigens der einzige ältere Beitrag zur Anthologie und ein willkommenes Wiederlesen: Smith zählt zur guten alten Schule des britischen Tier-Horrors und veröffentlichte ab den 70ern einige Romane, in denen Killerkrabben britische Badestrände in blutigen Brei verwandeln - schundig, aber mit Kultstatus. Dieser Serien-Nachtrag aus dem Jahr 1992 besticht als eine aufs Notwendigste beschränkte Momentaufnahme und braucht nur einen einzigen Schauplatz: eine Strandkabine aus vermeintlich sicherem Beton.
Überhaupt setzen die meisten Autoren dieser Anthologie auf klaustrophobische Settings wie Höhlen, Schützengräben - oder ein unterirdisches Habitat: Hierhin haben sich in James Thomas Jeans' "Nirvana" die Überlebenden einer weltweiten Katastrophe geflüchtet, die durch Zombies - eindeutig das meistpublizierte Thema des Permuted Press-Verlags - ausgelöst wurde. Jeans beschreibt das Paradebeispiel einer good idea gone bad, die Generationen von bioinvasionsgeplagten AustralierInnen kollektiv aufseufzen ließe. Denn womit bekämpft man Leichen, auch wandelnde, am besten? Richtig, mit großen Maden ...
Unbedingt erwähnt werden sollten auch die Beiträge mit etwas anderem Zugang: Paul Stuart gewinnt in "The Long Dark Submission" der Begegnung von Unterwasserfarmern mit Tiefsee-Giganten poetischere Aspekte ab als ein einfaches Wir-gegen-sie-Szenario. Und besonders bemerkenswert "Extinction" von Evan Dicken: Für sein Debüt entwirft der Autor eine alternative Steampunk-Vergangenheit, in der Kriege mittels der von einer Gilde gezüchteten warbeasts ausgetragen werden. Doch diese Ära neigt sich nun dem Ende zu. Als Erich seinen Riesenbären ins letzte Gefecht lenkt, trifft er auf einen Vorboten des kommenden Zeitalters: eine Kampfmaschine. Die finale Begegnung mit einem Ritter - Vertreter einer noch länger zurückliegenden Epoche, die nur noch als Folklore erhalten geblieben ist - führt Erich vor Augen, wie seine eigene Zukunft aussehen wird, und unterstreicht den melancholischen Charakter der Geschichte. Hoffentlich macht Dicken daraus mal einen Roman.
Nur die Minderzahl der Beiträge wagt sich in Dimensionen vor, die jedem Gesetz von Körperstatik, Energieversorgung oder Aerodynamik spotten - nicht von ungefähr sind es die humorigen. In James A. Moores "Whatever Became Of Randy" schlurpt ein räuberisches Riesengehirn durch die Gegend wie die Wandertitte in Woody Allens "Was Sie schon immer über Sex wissen wollten", in Jeff Strands "The Big Bite" wird ein Vampir dummerweise in eine Gefängniszelle mit Blick aufs Atomkraftwerk gesteckt, bis er zu einer Größe anschwillt, für die man einfach keine Pfähle mehr auftreiben kann. Das soll natürlich an den 50er-Jahre-Klassiker "Attack of the 50 Foot Woman" erinnern, der unter anderem ein Remake mit Daryl Hannah und ein cooles Kylie Minogue-Video nach sich zog. Aber eine noch viel bessere Hommage ist in der Anthologie ebenfalls enthalten, kommt von Steven Shrewsbury und heißt "Attack of the 500-Foot Porn Star": Womanizer Howard hat diesmal die Falsche sitzen lassen, nämlich die rachsüchtige Enkelin eines Area 51-Forschers. So wacht er eines Tages auf und muss feststellen, dass er seinem Künstlernamen Miles Long zum ersten Mal wirklich gerecht wird. Unbeholfen trampelt er durch die Stadt, schlägt mit seiner 30-Meter-Erektion Dächer ein und wird vom Militär einem Grande Finale entgegen getrieben.
Pulp ist nicht Bizarro, auch wenn das Genre im frühen 20. Jahrhundert vielleicht eine ähnliche Rolle gespielt haben mag. Im Lauf der Zeit ist es jedoch zu einem eigenen Genre mit eigener Motivgeschichte ... und einem eigenen Regelwerk geworden. Sehr schön illustrierte dies der Verlag Subterranean Press, als er auf eine ähnliche Anthologie mit dem Titel "Retro Pulp Tales" nicht einfach "... 2" folgen ließ, sondern die Fortsetzung in einer Demonstration überragenden Stilbewusstseins "Son of Retro Pulp Tales" betitelte. Die völlige erzählerische Freiheit, die das Bizarro-Genre bietet, nutzt jedoch auch einer der hier vertretenen Autoren, Cody Goodfellow in "The Island of Dr. Otaku". Mit herkömmlichen Kaijū, also den typisch japanischen Riesenmonstern, setzt sich hier überhaupt erst alles in Gang; sehr hübsch etwa der biomechanische Killerwal, mit dem Greenpeace die japanische Fangflotte versenkt. Danach aber wird es erst so richtig abgefahren: Dr. Otaku erschafft metaphysische Monster als Kondensat kollektiver Ängste - in einem bildgewaltigen Feuerwerk fiesen Humors erleben wir unter anderem mit, wie lachende tibetische Mönche auf einem Riesenyeti Peking plattwalzen, ein gigantischer Stalin Putin verschluckt (und wieder ausspuckt) oder ganz Tokio sich in eine fliegende Riesenqualle verwandelt, die mit ihren Tentakeln die Weltwirtschaft an sich reißt. Sprache stößt hier an ihre Grenzen: Diese Geschichte sollte als Anime verfilmt werden - und das müsste man sich dann mindestens dreimal ansehen, um kein Detail zu verpassen. Hirnzerschmetternd und einfach großartig!
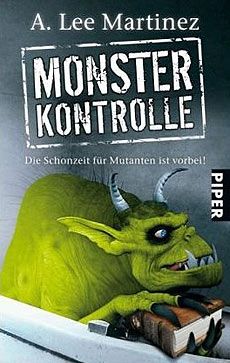
A. Lee Martinez: "Monsterkontrolle"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
Für den Großteil der im vorangegangenen Buch aufgeworfenen Probleme käme hier die Lösung angestapft: Und zwar in Form von Mr. Dionysus vulgo "Monster" (so auch der Originaltitel des Romans), eines Mitarbeiters des Kryptobiologischen Rettungsdienstes, der als eine Art magischer Kammerjäger mythologische Spezies einsammelt und die von ihnen angerichteten Verwüstungen eindämmt. - Der Texaner A. Lee Martinez hat sich in der Funny Fantasy mittlerweile einen Namen gemacht und springt dabei vergnügt durch die diversen Subgenres der Phantastik; siehe etwa "Die Kompanie der Oger" oder "Der automatische Detektiv". Wer Letzteres gelesen hat (hier der Rückblick), wird auch einige Facetten von dessen robotischem Protagonisten Mack Megaton im brummigen Mr. Dionysus wiedererkennen.
Der hat's ja auch nicht leicht: Notorisch klamm, ist er überdies mit der jähzornigen Höllendämonin Liz als Freundin geschlagen, die er über eine Annonce kennengelernt hat und die auf Erfüllung der vertraglich festgeschriebenen Sexquote pocht, während der Durchführung des Akts allerdings in der "Cosmo" blättert; der leidenschaftsloseste Sukkubus der Literaturgeschichte. Bei einem Routinejob - einer Yeti-Attacke auf die Speiseeisvorräte eines Supermarkts - lernt Monster dafür jemanden kennen, der zu ihm wie die Faust aufs Auge passt: Judy jobbt in der Nachtschicht, fühlt sich ganz generell als Versagerin und wird in ihrer Griesgrämigkeit zu Monsters kongenialer Partnerin. Er hält sie für eine Zicke, sie ihn für einen Arsch, da stimmt einfach die Chemie. Als Katalysator fungiert Monsters Sidekick Chester, ein höheres Wesen aus einer anderen Dimension, das sich als gestaltwandelnde Origami-Figur manifestiert und Menschen als möglicherweise empfindungsfähiges Protoplasma betrachtet.
Einen Gegenspieler braucht's - weniger der Logik als des Aufbaus eines Spannungsbogens wegen - natürlich auch. Diese Rolle übernimmt Mrs. Lotus, ein magisches Muttchen, das sich als älter als das Universum (und dessen Vorgänger) entpuppt und mit allen Mitteln eine Entwicklung verhindern will, in deren Mittelpunkt Judy zu stehen scheint. Das aber wie gesagt nur, um alles zusammenzuhalten - die eigentliche Handlung besteht natürlich aus den absurden Situationen, in die unser wackeres Trio der Reihe nach gerät, wenn sie Trollen, feuerspeienden Katzen, Chimären und was nicht allem begegnen. Kryptos schwärmen jedenfalls ein wie Wespen zu einer Grillparty und hinterlassen meist eine verwüstete Immobilie - und zwischendurch setzt es einige echte Brüller: Etwa wenn Chester ein übernatürliches Wesen heraufbeschwören will, aber nur auf dessen Anrufbeantworter stößt.
Martinez' Komik fußt ganz wesentlich darauf, dass er die höchst banalen Ärgernisse des Berufslebens 1:1 auf Sparten der ungewöhnlicheren Art überträgt. Denn ökonomische Zwänge machen auch vor der Welt des Übernatürlichen nicht Halt. Man nehme nur Liz, die als Sexarbeiterin aus der Hölle emporgestiegen ist, nun im harten Konkurrenzkampf des Verführens zur Sünde steckt und nur allzu gerne die dämonische Karriereleiter hinaufklettern würde. Wofür man schon mal ein stilvolles Businesskostüm bräuchte, das der notorisch auf Nachtschicht weilende Gatte einfach nicht zur Reinigung bringen will. Genau diese Nachtschichten - lange Strecken Langeweile, unterbrochen durch kurze Momente des Grauens - neidet ihm Judy: Sie schuftet ja zur selben Unzeit, aber er wenigstens mit Drachen. Und selbst Chester ist im Prinzip nichts anderes als ein Gastarbeiter, der die bei seinen Einsätzen gewonnene Energie in seine Heimatdimension zur hungrigen Familie pumpt. In einem Punkt sind sich daher alle einig: "Arbeit ist ätzend."

Walter Jon Williams: "Der Fall des Imperiums"
Broschiert, 623 Seiten, € 16,50, Heyne 2010.
Eine epische Weltraum-Saga beginnt mit dem Ende einer Ära: Siegesgewissheit ergibt sich nach unzähligen Jahrtausenden dem Tode; er war der Letzte aus dem Volk der Shaa, das einst das feudale Imperium aufgebaut hat, dem auch die Menschheit einverleibt wurde. Analog zum Römischen Reich oder dem Britischen Empire herrschten die Shaa mit überlegener Kriegstechnik und dem unbedingten Willen diese auch einzusetzen über "ihren" Teil der Galaxis. Wo der Hammer hängt, haben sie ihre Untertanen nie vergessen lassen - Menschen dürfen beispielsweise auf Kriegsschiffen Dienst leisten, die schöne Namen wie Bombardierung von Los Angeles tragen. Aber so recht zum Abschluss konnten die Shaa ihr großspuriges Projekt der Universalherrschaft - sie selbst verwendeten schönfärberische Metaphern wie "den Garten gestalten" - nicht bringen. Und wie sich nach Siegesgewissheits pompöser Beisetzung recht bald zeigen wird, stand das Imperium längst auf tönernen Füßen.
Als ProtagonistInnen wählt der Autor zwei Figuren, die beide Kreaturen des Systems und damit auch (noch) recht weit von jeder Heldenrolle entfernt sind. Leutnant Gareth Martinez stammt aus provinzadeligen Verhältnissen und wird in der Hackordnung des imperialen Zentrums nicht einmal ignoriert. All sein Denken und Tun kreist deshalb um seine Karriere: Als er seinen Vorgesetzten davon abhalten will, in bedingungsloser Loyalität zusammen mit Siegesgewissheit in den Tod zu gehen, geschieht dies nicht etwa aus Mitgefühl, sondern weil er Angst hat, beruflich den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die eigenen Schwestern strategisch zu verheiraten fällt in dieselbe Kategorie. Bei einem Rettungseinsatz lernt Gareth die begnadete Pilotin Caroline Sula kennen und wirft trotz ihrer dubiosen Vergangenheit ein Auge auf sie. Carolines dunkles Geheimnis wird später zwar in einen Plot-Twist münden, den man schon meilenweit gegen den Wind riechen kann - aber ihre Erinnerungen geben einen guten Einblick in das Leben der weniger begüterten BürgerInnen, in die Halbwelt und den Alltag derer, die sich nur mit Tricks über Wasser halten können. Den ökonomischen Zwängen können die beiden Hauptfiguren zwar nicht entrinnen, aber ein wenig Distanz haben sie sich bewahrt. Da das Geschehen jeweils durch ihre Wahrnehmung gefiltert erzählt wird, ergibt sich somit ein durchgängiger Ton von leisem Sarkasmus, der den Roman zu einem recht vergnüglichen Leseerlebnis macht.
Klappentexte neigen zum Nivellieren. Hier ist die Rede davon, dass eines der imperialen Völker das Machtvakuum für eine Revolte nützt und dass Gareth zu den wenigen gehört, die den Plan der Umstürzler durchschauen; gigantische Gefechte werden angekündigt ... jaja, stimmt schon alles, kommt auch alles. Aber darauf liegt nicht der Schwerpunkt des Romans, und das ist auch gut so. "Der Fall des Imperiums" ist mehr gesellschaftliches Panorama als Space Opera, man möchte ja auch erst einmal erfassen, was hier zu Fall gebracht wird. Und so nach und nach schält sich dabei heraus, was für ein hohles Gebilde das Imperium eigentlich ist: Die einstige Expansion ist längst ins Stocken geraten, die gefürchtete Flotte der Shaa hat keine Kampferfahrung mehr (was zu Raumschlachten führen wird, in denen auf beiden Seiten ziemlich unprofessionell agiert wird: eine reizvolle Idee). In den Kreisen der adeligen Peers dreht sich alles nur um Postenschacher, Konkurrenzdenken, Neid und Dünkel - und um private Vorlieben. So hat beispielsweise der Kommandant des Schiffs, auf das Gareth abkommandiert wird, seine Besatzung nicht nach Kompetenz, sondern nach deren fußballerischer Leistung ausgesucht. Williams muss das Wort Dekadenz nie aussprechen; er illustriert es dafür in vielfältigster Weise.
Am bezeichnendsten aber ist die Praxis genannte Philosophie der Shaa, die das Imperium seit Jahrtausenden zusammenhält. Unwesentlich ist sie nicht, immerhin hat sie's sogar in den Originaltitel des Romans ("Dread Empire's Fall: The Praxis") geschafft, doch erfährt man von ihrem Inhalt ... nichts. Außer ihrer anfangs zitierten Präambel "Alles Wichtige ist bereits bekannt", also einem Manifest der Ignoranz, bleibt das vermeintliche Um und Auf des Imperiums ein Phantom. Nur eine Reihe von Verboten, die mit eiserner Hand durchgesetzt werden, wird erwähnt: Künstliche Intelligenz, Gentechnik, transhumane Existenzen und Materieveränderungen auf atomarer Ebene (sowie sämtliche Versuche die Unsterblichkeit zu erlangen: Gruß von den Vorlonen) sind untersagt. Ist doch immer wieder spannend zu lesen, durch welche in der Handlung begründete Schlupflöcher ältere AutorInnen den neuen transhumanen Standards der Hard SF entwischen wollen. Hard SF bleibt es nichtsdestotrotz, wie die ausführlich beschriebenen Unterlichtflüge und Swingby-Manöver zeigen; nur eben Marke Good Ol' SF. Und ein Bündel an Verboten macht ohnehin noch keine Philosophie aus - viel eher scheint es, dass der einzige Inhalt der absolutistischen Shaa-Ethik ihre Durchsetzung ist.
Der 1953 geborene US-Autor Walter Jon Williams ist mehrfacher Nebula-Preisträger und vielfacher Nebula- und Hugo-Nominierter. Man kann also getrost darauf vertrauen, dass jedes Abweichen von der vermeintlich optimalen Space Opera-Formel ganz gezielt durchgeführt wurde und einen wohldurchdachten Hintergrund hat. Wer Romane ausschließlich nach der Action-Quote misst, wird sich hier bis in die zweite Hälfte gedulden müssen - aber der tiefe Fall des Imperiums ist ja auch noch lange nicht zu Ende: Auf den vielversprechenden Auftakt soll im August mit "Sternendämmerung" Teil 2 der Trilogie folgen.

Sarah Moss: "Cold Earth"
Broschiert, 280 Seiten, Granta Books 2009.
Was für eine beängstigende Qualität doch Schlagzeilen bekommen, wenn man die geliebten Menschen daheim, die von diesen Nachrichten direkt betroffen sind, nicht erreichen kann. So sinniert die Oxforder Studentin Nina, als sie mit einer Gruppe von DoktorandInnen in der grönländischen Einöde festsitzt, um eine alte Wikinger-Siedlung zu erforschen. Und die Nachrichten selbst, die drehen sich um the virus thing: Eine neue Infektionskrankheit, die an der Ostküste der USA ausgebrochen ist und möglicherweise von Vögeln übertragen wird ... Genaues weiß man nicht. Von Beginn an geistert das Thema, erst noch ganz sachte, der ArchäologInnengruppe durch die Hinterköpfe und wird sich im Verlauf des Romans immer stärker in den Vordergrund drängen - je mehr sich die sechs Menschen abgeschnitten und hilflos fühlen.
Ihren Debütroman erzählt die Britin Sarah Moss in Form von Tagebucheinträgen beziehungsweise unabgeschickten Briefen der sechs ProtagonistInnen an ihre Lieben daheim. Nina ist eigentlich Literaturstudentin; ihr Forschungsstipendium hat sie nur bekommen, weil sie Expeditionsleiter Yianni kennt. Dass sie daher nur als ungelernte Aushilfskraft an den Grabungen teilnehmen kann und sich entsprechend unsicher fühlt, scheint sie durch Verbreitung banaler Klischees zu kompensieren. Die im Grunde extrem spießige Nina wäre die perfekte Autorin von "lustiger" Reiseliteratur à la "Zehn Gründe, warum Sie Italien meiden sollten", die einem im direkten Gespräch wahnsinnig schnell auf die Nerven ginge. Ganz anders als die New Yorkerin Ruth, die ihren Partner bei einem Unfall verloren hat, ihre Trauer hinter bitteren Bemerkungen versteckt und einfach die unendlich interessantere Erzählerin abgibt. Zusammen mit der des gutherzigen und relativ schlichten Amerikaners Jim machen diese beiden Perspektiven mit insgesamt 250 Seiten den Löwenanteil des Romans aus, die übrigen drei Personen kommen nur kurz zu Wort.
Auf sich selbst zurückgeworfen, wie sie sind, haben die ForscherInnen jede Menge Zeit dafür gedankliche Verknüpfungen herzustellen - etwa zwischen der immer noch ungeklärten Ursache für das einstige Verschwinden der grönländischen Wikinger und dem möglichen Ende der globalen Zivilisation der Gegenwart. Nina, die mit Medikamenten gegen Panikattacken ankämpft (und trotzdem ein uninteressantes Persönchen bleibt) glaubt gar Visionen aus der Epoche der Wikingersiedlung zu haben. Erst rollen die anderen mit den Augen ... aber langsam beginnen auch sie "Dinge" zu sehen und zu hören. Der Einblick in die Psyche der ProtagonistInnen lässt Innen- und Außenwelt mehrfach verschmelzen: Berührend etwa die Passage, in der Ruth den bestatteten Leichnam eines ehemaligen Siedlers freilegt und sich parallel dazu Schicht um Schicht an den Körper ihres verunglückten Partners erinnert.
"Cold Earth" bietet weder spektakuläre Action noch Schockmomente, sondern setzt auf leises Grauen, das jedoch beständig zunimmt. Dass Yianni die Benutzung ihres Satelliten-Links - die einzige Kontaktmöglichkeit zur Außenwelt - aus ökonomischen Gründen begrenzt, ist den anderen fünf von Anfang an ein Dorn im Auge. Die nächste Stufe der Eskalation wird erreicht, als sie den Kontakt zur Außenwelt ganz verlieren: Es gehen keine Emails mehr ein, abgerufene Websites wurden offenbar seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert - was ist da draußen nur los? Gruppeninterne Konflikte kommen zum Ausbruch. Und Paranoia: Als ein Seehund vor der Küste seinen Kopf aus dem Wasser hebt, wirkt das nicht mehr idyllisch - stattdessen drängt sich plötzlich die Frage auf, ob er wohl das Virus auf die Insel tragen könnte. Und während sich langsam der arktische Sommer dem Ende zuneigt und die Lebensmittelvorräte zu Ende gehen, zweifeln die sechs immer mehr daran, dass wirklich wie ausgemacht ein Flugzeug kommen wird, um sie ins lange vermisste Menschengewühl daheim zurückzubringen. If crowds are something people are still prepared to risk. If airports are still open. If there are still enough people to make crowds, wie Jim in seinem Brief grübelt.
"Cold Earth" lässt sich nicht wirklich einem bestimmten Genre zuordnen. Es verbindet Elemente romantischer Schauerliteratur im Stil etwa von Algernon Blackwoods "Die Weiden" mit denen eines psychologischen Dramas, einer Survival-Geschichte und eines Endzeit-Romans. Dass Moss das Geschehen nicht auktorial, sondern ausschließlich gefiltert durch die Perspektiven und Interpretationen ihrer Figuren erzählt, lässt dieses so unmittelbar erscheinen, dass es einem beim Lesen unwillkürlich eine grönländische Gänsehaut aufzieht. Bleibt als einziger Minuspunkt des Romans, dass die Stimme, der am meisten Platz eingeräumt wird, einer ausgemachten Trulla gehört.
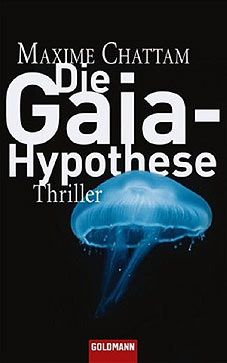
Maxime Chattam: "Die Gaia-Hypothese"
Broschiert, 446 Seiten, € 9,20, Goldmann 2010.
Wie gut, dass James Lovelock noch am Leben ist. Erstens überhaupt und zweitens, weil er jetzt nicht in seinem Grab wie ein Bohrkopf Richtung Erdkern rotieren muss, wenn er sieht, was der französische Autor Maxime Chattam aus seiner Gaia-Hypothese gemacht hat. Die von Lovelock und der Biologin Lynn Margulis in den 60ern postulierte Hypothese dreht sich kurz gesagt darum, die irdische Biosphäre als ein System von Rückkopplungsmechanismen zu betrachten, das sich selbst organisiert und stabilisiert. Wie eng oder weit diese Fähigkeit zur Selbstaufrechterhaltung zu interpretieren ist, bleibt eine philosophische Frage - bis hin zu der bekanntesten und großzügigsten Auslegung, die Biosphäre respektive "Gaia" als ein einziges allumfassendes Lebewesen zu betrachten. Der Science Fiction-Autor David Brin hat sich in seinem Roman "Erde" ("Earth") ausführlich mit den möglichen Aspekten Gaias beschäftigt; Bestseller-Autor Maxime Chattam ("Das Pentagramm", "Die Teufelsformel") tut dies in "La Théorie Gaïa" auf etwas andere Weise. Am Cover steht ja auch Thriller.
Die Europäische Union in der nahen Zukunft: Ein verschwägertes Wissenschaftstrio wird im Auftrag der EU-Kommission auf die Spur eines Forschungsprojekts gesetzt, das aus einem illegalen Budget finanziert zu werden scheint: Peter DeVonck ist Biologe und Genetiker, seine Frau Emma eine Paläoanthropologin mit umstrittenen Ideen, Emmas Bruder Ben Clarin ein Verhaltensforscher. Peter und Ben reisen in Begleitung eines undurchsichtigen EU-Beamten zu einem Observatorium in den Pyrenäen. Doch die Astronomen, die dort rechtens wohnen und arbeiten, sind längst nicht mehr Herren im eigenen Haus. Ein großer Teil der Anlage ist für sie gesperrt worden und dient nun medizinischen Forschungen - recht eigentümlichen, wie Peter und Ben rasch herausfinden. Sie entdecken Massen von historischen und soziologischen Akten zum Thema Serienkiller; die Studienobjekte wurden überdies in nicht sonderlich seriös klingende Kategorien wie "Vampire", "Werwölfe", "Frankensteins" und "Dämonen" eingeteilt.
Emma muss indessen allein auf die abgelegene Pazifikinsel Fatu Hiva, wohin ebenfalls abgezweigte EU-Gelder geflossen sind. Als sie mit dem Skipper Tim das abweisende Felseneiland ansteuert, ist ihr erster Eindruck, sie wäre auf der Insel von King Kong gelandet. Emma ist eifrige Thriller-Leserin - dass ihr laufend Szenarien von Crichton, Koontz & King durch den Kopf schießen, charakterisiert aber nicht nur sie, sondern gibt auch einen Hinweis darauf, wo Chattam seinen Roman in etwa angesiedelt hat. Bald finden Emma und Tim Spuren eines Massakers und kurz darauf werden sie von Unbekannten - möglicherweise von Menschen, aber vielleicht auch nicht - attackiert. Damit sind jetzt alle drei im Klappentext erwähnten Elemente ins Spiel gebracht: Eine menschenleere Insel, Serienkiller und die Gaia-Theorie - kluge Köpfe haben eine gute Chance, bereits vor Lesen des Buches auszubaldowern, worauf das Ganze hinauslaufen wird.
"Plakativ" wäre das Wort, das den Roman am besten zusammenfasst. Beginnend bereits mit dem Vorwort, das sich um die aktuelle (angebliche) Zunahme an Naturkatastrophen dreht und - "Das Schlimmste steht uns also noch bevor." - einer Pro7-Event-Doku entsprungen sein könnte. Die Mahnungen - "Dieser Kampf gegen die Uhr hat schon seit Langem begonnen." - setzen sich in später folgenden Kapitel-Intros fort; formuliert sind diese als "Zeitungsartikel", "Blog-Eintrag" oder "Auszug aus der Rede eines Bürgers vor den Vereinten Nationen": Das erinnert an Autoren wie David Brin (im oben genannten "Erde"), John Brunner (in "Schafe blicken auf") oder auch Tad Williams ("Otherland"), die mit dergleichen Vielstimmigkeit das Romanthema und die beschriebene Zukunftsgesellschaft facettenreich illustrierten; auch wenn es Chattam weniger elegant und dafür mit viel ausgestrecktem Zeigefinger macht. An ominösen Sätzen à la "Zum Wohle der Menschheit werden wir vernichten, was vernichtet werden muss." mangelt es nicht, und einmal mehr dreht sich alles um eine Wahrheit, die augenblicklich Anarchie ausbrechen ließe, geriete sie ans Licht der Öffentlichkeit.
"Die Gaia-Hypothese" kommt als Amalgam aus Wissenschaftskrimi, Horror und Untergangsszenario daher - ein paar Worte muss man allerdings zum Thema Wissenschaft verlieren, wenn Chattam sie schon aufgreift. Plakative Verkürzung und Verzerrung erleben hier nicht nur die Ideen von James Lovelock oder Allan C. Wilson, mehrfach drängt sich schon der Eindruck auf, dass Chattam seine wissenschaftlichen Quellen ganz einfach nicht verstanden hat. Da werden etwa mit Blick auf eines der größten Massensterben der Erdgeschichte die geschätzten 30 Milliarden Spezies, die seit dem Kambrium gelebt haben, mit der Artenvielfalt während dieser Epoche verwechselt; ein nicht ganz unbedeutender Unterschied, die eine oder andere neue Art soll sich in der Zwischenzeit ja auch entwickelt haben. Und wie immer, wenn ein Autor dem Öko-Schädling Mensch mit der Strafe Massentod droht und als "Beleg" das Aussterben der Dinosaurier heranzieht, fragt man sich, wo die gemeinsame Variable zwischen denen und uns liegt: Die Umwelt haben die Dinos jedenfalls nicht zerstört, genausowenig wie sie Ski gelaufen sind oder GZSZ geguckt haben. Ganz sicher aber würde eine echte Wissenschafterin nicht Worte wie primitive Jäger, animalisch und von Instinkten geleitet in den Mund nehmen, um nicht-sesshafte Kulturen der Vergangenheit zu beschreiben, wie es hier Emma tut. - Überall, wo die Wissenschaft ins Spiel gebracht wird, kommt Chattams Roman also heftig ins Schwimmen. Übrig bleibt ein mit Massen von Cliffhangern versehener, durchaus spannender Krimi.

Brian Moreland: "Schattenkrieger"
Gebundene Ausgabe, 461 Seiten, € 19,95, Otherworld 2010.
Dreieinhalb Seiten Danksagungen am Romanbeginn, das wäre eines Hollywood-Abspanns würdig. "Schattenkrieger" (im Original: "Shadows in the Mist") lechzt ja auch geradezu nach einer Verfilmung, und der Texaner Brian Moreland hat überdies im Filmgeschäft gearbeitet; dies ist sein Debüt als Romancier. "Hellboy" drängt sich als Bezug auf, immerhin geht es hier einmal mehr um höllische Umtriebe von Nazi-Wissenschaftern. Schon spannend, wie die seinerzeitige "Wunderwaffen"-Propaganda langfristig gegriffen hat, zumindest in der Unterhaltungsindustrie. Vielleicht steckt hinter dem furchtsamen Respekt, der der vermeintlichen Genialität der NS-Wissenschaft hier entgegengebracht wird, ja der verdrängte wahre Horror vor der Banalität einer Welt, in der Kriege durch nüchterne Logistik (und manchmal sogar durch Zufälle) entschieden werden - da lässt sich's doch leichter mit Schrecken fertig werden, die man mit Händen greifen kann. Und meistens greifen sie auch zurück. Morelands Danksagungsserie endet mit treuherzigen Grüßen an die Familie: Ich bin so glücklich, diesen Traum mit euch und allen, die ich kenne, zu teilen. Selbstverständlich ist es ein Albtraum.
Zunächst führt der Roman zwei zeitliche Ebenen ein: Eine im Jahr 1944, wo sich US-Colonel Jack Chambers im Zuge des Weltkriegs mit seiner Truppe an die deutsch-belgische Grenze vorgekämpft hat und nun vor der Aufgabe steht, in den gefürchteten Hürtgenwald vorzudringen. Die zweite in der Gegenwart: Hier bittet der greise Jack seinen Enkel Sean, sein altes Kriegstagebuch zu einem befreundeten US-General nach Heidelberg zu bringen. Der lästige Rabbi Jacob Goldstein, ein ehemaliger Kriegskamerad Jacks, versucht Sean vergeblich davon abzuhalten. Als das Objekt übergeben ist und der General umgehend Ausgrabungen in der Region veranlasst, scheint sich zunächst eine Handlungsstruktur à la Stephen Kings "Es" abzuzeichnen: Also eine parallele Annäherung an das Mysterium in Vergangenheit und Gegenwart. Moreland hat sich jedoch anders entschieden und verbleibt für den weiteren Verlauf im Jahr 1944. Da geht dafür die Post ab.
Jacks Truppe nennt sich Die Glücklichen Sieben: Seit der Landung in Sizilien sind sie zusammen und haben jedes Gefecht überstanden. Nun rechnen sie mit einem längst verdienten Fronturlaub - stattdessen schickt man sie zusammen mit einem dubiosen Geheimkommando in den schwer umkämpften, dauernebligen Hürtgenwald, der unter Soldaten nur der Fleischwolf genannt wird. Und wo außer Deutschen und Amerikanern offenbar noch jemand - oder etwas - auf der Jagd ist; darauf lassen jedenfalls die verstümmelten Leichen von Deutschen schließen, die im Wald gefunden werden. Von einer Geheimwaffe wird gemunkelt und das Wort Schattensoldaten macht die Runde. Zugleich schleichen sich paranormale Aktivitäten ein: Träume und Visionen, von denen einige Figuren buchstäblich gezeichnet werden. "Schattenkrieger" entwickelt sich damit zu einer Genremischung aus Kriegsroman, Horror und Mystery, wobei die Mystery-Elemente gegen das anhaltende Ra-ta-ta-ta-tat! der Maschinengewehre kaum anstinken können.
Tiefgründige Charakterisierung oder messerscharfe Differenzierung sind Morelands Sache nicht. Bei den Glücklichen Sieben handelt es sich oberflächlich betrachtet zwar um eine heterogene Gruppe - allerdings eine mit recht austauschbaren Charakteren, ganz wie man es aus Kriegsfilmen gewohnt ist; auch der obligatorische Psycho mit Gewaltpotenzial wird sich als tickende Zeitbombe noch dazugesellen. Deutsche und Nazis werden synonym verwendet und dieselbe Augenfarbe, die bei einem Deutschen selbstverständlich als arisch schubladisiert wird, schimmert bei einem sterbenden G.I. wie der Frühlingshimmel. Die Rollen von Gut und Böse sind also klar verteilt - andererseits: Werden höllische Nazi-Mystiker heraufbeschworen, muss man ja auch nicht mehr pseudomäßig auf Grauschattierungen machen. Der Roman lebt von seiner Spannung, eine eigene erzählerische Stimme ist noch nicht wirklich auszumachen. Eher sieht es danach aus, dass Moreland, der in seiner Bio auch "Motivationstrainer für Autoren" stehen hat, eifrig die Strukturen von Bestsellern studiert hat und das gewonnene Wissen nun effektiv in die Praxis umsetzt.
Abschließend noch zur Aufklärung des Mysteriums: 70 Seiten bevor das entscheidende Wort fällt, sollte eine Szene bereits klarmachen, womit man es zu tun hat. Hier wird sich der eine oder andere vermutlich aufs Hirn klatschen, weil er nicht schon früher daran gedacht hat (denn Indizien gab's, und ob!). Die zweite Reaktion wird eine anerkennende Verbeugung vor Morelands nachgerade pervers zynischer Idee sein ... obwohl: So singulär ist die bei genauerer Überlegung gar nicht. Ein Landsmann des Autors hat mit einer vergleichbaren Motivverknüpfung seine Weltkarriere untermauert. Einmal mehr zeigt sich damit: Moreland weiß, wo Erfolgsstoffe zu finden sind. Ein neuer Profi der Spannungsliteratur hat die Bühne betreten.
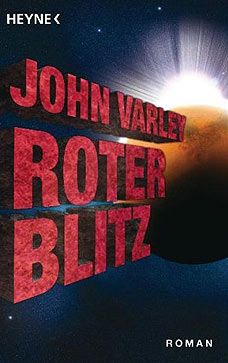
John Varley: "Roter Blitz"
Broschiert, 479 Seiten, € 9,20, Heyne 2010.
"Der Mars ist echt beschissen", lautet der Eröffnungssatz in John Varleys Sequel zu seinem Roman "Roter Donner" (hier der Rückblick). Es wird sich in der Folge noch zeigen, dass er nicht ganz ernst gemeint ist; die Erde wäre schließlich ein noch viel schlimmerer Ort zum Leben. Eher schon soll damit der Ton etabliert werden, in dem "Roter Blitz" erzählt wird; ganz wie sein Vorgänger auch. - Um diese Fortführung zu gewährleisten, springt Varley kurzerhand eine Generation weiter: Manny, Kelly & Co, die ProtagonistInnen von "Roter Donner", die einst den Mars in einem selbstgebastelten Raumschiff erreicht haben, das dem bruchgelandeten Kübel von Alf alle Ehre gemacht hätte, sind erwachsen geworden und haben den Mars kolonisiert. Ein raues, aber von viel hemdsärmeligem Pioniergeist durchdrungenes Stück Zivilisation ist geschaffen worden. Jay Garcia, der Sohn von Manny und Kelly, ist hier aufgewachsen und mittlerweile im selben Alter wie seine Eltern in Teil 1. Mit großmäuligem Jugendsprech fungiert er als die neue Hauptfigur und lässt damit Teil 2 trotz zeitlichen Abstands nahtlos ans bisherige Geschehen anschließen.
Vom Mars aus erlebt Jay den Wo-warst-du-als-es-passierte-Augenblick seiner Generation: Ein unbekanntes Objekt schlägt auf der Erde ein und löst eine gigantische Flutwelle aus. Weil Oma Garcia als einzige der Familie in der alten Heimat Florida geblieben ist, entschließt man sich zu einer Rettungsmission. Die Einreise auf der Erde wird aber nicht nur in Sachen erhöhte Schwerkraft zur Herausforderung, die Garcias werden auch mit längst ungewohnt gewordenen (und durch die Katastrophe verschärften) bürokratischen Rahmenbedingungen konfrontiert. Gelegenheit für Varley, ein paar satirische Spitzen anzubringen - etwa die Warteschlange vor dem Airport-Schalter, an dem sich Passagiere ihre vorausgeschickten Waffen abholen können. "Wir sind hier nicht auf dem Mars. Wir sind auf der Erde, und was noch schlimmer ist: in Amerika." Wirres US-Katastrophenmanagement und behördliche Versuche, das Ausmaß der Katastrophe zu verschleiern: Im Nachwort wird Varley erzählen, wie sein Roman (2006 als "Red Lightning" veröffentlicht) parallel zu Ereignissen wie Katrina oder dem Tsunami im Indischen Ozean entstand und wie er sich veranlasst fühlte, den Text aufgrund der realen Geschehnisse zu modifizieren.
Der notorisch unverwüstliche Garcia-Clan meistert zunächst einmal alle Herausforderungen mit Willensstärke und Optimismus, auch wenn ihnen der Humor im Überschwemmungsgebiet vorübergehend verloren geht. Das ist aber nur das Vorspiel für Unannehmlichkeiten anderer Art, in Gang gesetzt, als ihr alter Kumpel Jubal von seinem Labor/Exil/Gefängnis auf den Falkland-Inseln ausbüxt. Wir erinnern uns: Jubal ist jenes verschrobene Genie, das den sämtlicher Physik trotzenden Drücker erfand, der unbegrenzt Energie liefert und letztlich auch die bemannte Raumfahrt und die Besiedelung des Mars ermöglichte. Jubals Verschwinden versetzt die Mächte der Erde in Aufruhr - vorbeugend starten sie eine Invasion des Mars, wo ja Jubals alte Spießgesellen leben, und in der Folge wird die Geschichte einen etwas anderen Charakter annehmen. Die US-Historie und "Total Recall" lassen grüßen, wenn es nun um die Unabhängigkeit des Mars geht.
... und leider verliert der Roman damit auch etwas an Charme. Naivität ist eine Sache, wenn es um das Zusammenbasteln eines unwahrscheinlichen Raumschiffs geht, aus dem heraus man der milliardenschweren NASA eine lange Nase drehen kann. Auch dass die notorisch mit den Obrigkeiten im Clinch liegenden Garcias an einer Stelle den feierlichen Eid ablegen, die Gesetze der USA zu respektieren, "solange sie uns nicht daran hindern, das zu tun, was wir tun wollen", ist noch witzig - aber was werden sie wohl tun, wenn sie selbst erst im wahrsten Sinne des Wortes am Drücker sind? Vom tolldreisten Abenteuer einiger IndividualistInnen zur Wir-wissen-was-gut-für-euch-ist-Mentalität ist der Sprung offenbar recht kurz. Und dass die Mars-Invasoren anonym bleiben, entbindet letztlich auch von jeglicher Notwendigkeit zu differenzieren. Speziell "Onkel" Travis schert sämtliche Erdis gerne über einen Kamm. Stark drängt sich der Eindruck auf, dass die mehrfach geäußerte Enttäuschung über die alten USA Hand in Hand mit einer ebenso undifferenzierten Glorifizierung der New Frontier geht, der neuen Neuen Welt auf dem Mars - die Attitüde bleibt dieselbe, nur die Referenzpunkte haben getauscht. "Roter Blitz", das nebenbei bemerkt ruhig noch eine Ehrenrunde im Korrektorat drehen hätte können, ist zwar immer noch sehr unterhaltsam, aber nicht mehr ganz das unbeschwerte Vergnügen wie "Roter Donner".
Die nächste Rundschau wird übrigens ebenfalls noch im Mai erscheinen, nachdem ich mit dieser die Monatsgrenze knapp überschreiten musste. Dann besuchen wir unter anderem ein Naturparadies mit höllischen Abwehrkräften und erleben die dramatische Vollendung einer royalen Geschlechtsumwandlung. Außerdem wird entweder der heurige "Nebula"-Gewinner enthalten sein ... oder einer der hoffnungsvollen Verlierer. (Josefson)