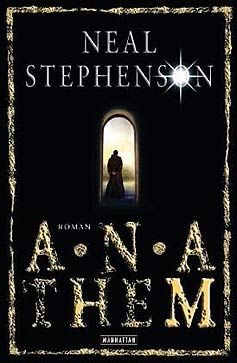
Neal Stephenson: "Anathem"
Gebundene Ausgabe, 1023 Seiten, € 30,80, Manhattan 2010.
Wenn man sich zwischendurch keine Notizen gemacht hat - und wer außer einem Rezensenten sollte das auch tun -, hätte man am Ende der über 1.000 Seiten von Neal Stephensons jüngstem Werk möglicherweise schon vergessen, was man zwischendurch alles erlebt hat: Eine Polüberquerung, einen Angriff aus dem All, einen pyroklastischen Strom, Martial-Arts-Einlagen, eine ausgesprochen ungewöhnliche Raumfahrt und nicht zuletzt eine quantenphysikalische Verschiebung der Realität. Das klingt nach Stoff für eine ganze Reihe von Büchern und hält sich hier doch nur am Rande dessen auf, wo die eigentliche Action abläuft: in Gesprächen mit Erkenntnisgewinn. Der US-Autor mit dem Ruf wie Donnerhall hat sich bereits in seinem "Barock-Zyklus" mit der Wissenschaftsgeschichte befasst und tut dies in "Anathem" aufs neue - diesmal im Rahmen einer fiktiven Welt mit anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Die geänderten Rahmenbedingungen dienen aber nicht einfach exotistischen "Was wäre wenn"-Gedankenspielen: Die Welt Arbre ist im Rahmen eines faszinierenden Multiversum- (bzw. hier: Polykosmos-)Modells mit der unseren verbunden, was seinerseits zur Erkenntnisfindung anregt.
Auf dem Planeten Arbre leben zwei weitgehend getrennte Gesellschaftsformen parallel nebeneinander: Die säkulare Welt und die der Theoren. Und hier lauert auch schon die erste Falle, denn "säkular" umfasst auf Arbre auch sämtliche Religionen, die - gesellschaftlichen Moden unterworfen, wie sie sind - von den Theoren als genauso flüchtig (und substanzlos) betrachtet werden wie alle anderen Phänomene der Außenwelt auch. Die Theore mögen zwar Mönchen gleich in Klostra und Konzenten leben, Kontemplation betreiben und sich einem strikten Regelwerk unterordnen - an Gottheiten glauben jedoch die wenigsten von ihnen. Ihre Beschäftigung gilt dem, was zeitlose Gültigkeit hat: Philosophie, Mathematik und theoretische Physik. Nur wenn eine sogenannte Apert ansteht, öffnen sie - je nach Gemeinschaft alle zehn, hundert oder gar tausend Jahre - für ein paar Tage ihre Tore zur Außenwelt.
In einer witzigen Szene schildert Stephenson, wie ein Theor einen Besucher mittels jahrhundertealtem Fragebogen knochentrocken darauf abklopft, was für ein Gesellschaftssystem da draußen gerade en vogue ist. Dinge, die dem mangelnden Geschichtsbewusstsein der säkularen Menschen als Selbstverständlichkeiten erscheinen, sind für die Theore nur befristete Phänomene in einem sich laufend verändernden und damit zugleich seltsam stillstehenden System. Sie sind es gewohnt, dass vor ihren Mauern abwechselnd Bürowolkenkratzer aufgetürmt werden und Bauern mit Eselskarren durch ödes Brachland ziehen. Alles vergeht und kehrt wieder - mit den Loriten gibt es sogar einen eigenen Theoren-Zweig, der es sich zur Aufgabe gesetzt hat darauf hinzuweisen, was an vermeintlich Innovativem alles schon einmal dagewesen ist. Der Unterschied zwischen dem säkularen und dem theorischen Zeitbegriff klafft mindestens so weit wie der zwischen den Unsterblichen und den "Wandelzivilisationen" in Alastair Reynolds' "Das Haus der Sonnen".
Die Handlung des Romans entspinnt sich entlang des Wegs eines jungen Theoren namens Erasmas, der sein Konzent verlässt. Seine Queste quer über Arbre und schließlich in den Weltraum hinauf wird zum räumlichen Ausdruck seiner inneren Reifung - und "Anathem" ist damit vom Kernplot her eine klassische Coming of Age-Geschichte. Was angesichts von Stephensons Schwerpunktsetzung auf philosophische Gespräche allerdings genauso wie die oben angesprochenen "Action-Elemente" fast untergeht. Bezeichnend der systemisch-soziologische Blick, mit dem Erasmas noch die buntesten Facetten der säkularen Welt betrachtet. Und auch was sich nach dem eigentlichen Anlass seines Aufbruchs - Erasmas' langjähriger Mentor Orolo wird aus dem Konzent überraschend abberufen - tut, folgt nicht gewohnten Erzählabläufen. Orolo hatte sich mit Astronomie beschäftigt - langsam kreisen nun seine SchülerInnen die vermutliche Ursache seiner Verbannung ein. Aus verschiedensten Blickwinkeln - von Camera obscura-Aufnahmen bis zu theoretischer Betrachtung der Möglichkeit, wie man mit hypothetischen Aliens kommunizieren könnte - leiten sie schließlich die unwiderlegbare Gewissheit ab, dass im Orbit über Arbre ein fremdes Raumschiff kreisen muss und ihnen dies von der säkularen Obrigkeit verschwiegen wird. Während in den meisten SF-Romanen das Ding zur Untersuchung mehr oder weniger sofort betatscht werden kann, läuft hier sehr viel über indirekte Nachweise: Ganz so, wie es in der realen Wissenschaft - speziell in den meisten Gebieten der Astronomie - auch der Fall ist.
Kaum vorstellbar, mit welchen Mengen von Dateien oder Karteizetteln Stephenson hier gearbeitet haben muss. Immerhin tut er nichts weniger als eine komplette mehrtausendjährige Wissenschaftsgeschichte - inklusive Akteuren, Schismen-artigen Abspaltungsbewegungen und vor allem Fachtermini - zu erfinden. Dazu noch ein praktischer Tipp: Ich war doof genug, das Glossar, das fast (leider nicht ganz!) am Ende steht, zu übersehen und mich mit dessen Auszügen zu begnügen, die an den Kapitelanfängen eingestreut sind. Ja, man kann sich die unzähligen Neologismen, die einen vor allem zu Beginn förmlich erschlagen, mit der Zeit aus dem Kontext heraus erschließen. Und vermutlich wäre das sogar der Hyläische Weg, der jeden Theor erfreuen würde (so biegt man sich seine eigene Unfähigkeit zurecht ...). Aber einfacher ist's doch, ein Lesezeichen im ausführlichen Glossar zu platzieren und gleich nachschlagen zu können. Auch wenn man die arbrischen Entsprechungen von Platos Höhlengleichnis, Ockhams Rasiermesser oder des Pythagoräischen Lehrsatzes ohne Hilfe erkennen kann - es gibt noch genug anderes zu entdecken, und "Anathem" ist nicht zuletzt ein Stück wissenschaftliche Detektivarbeit.
Eines lässt sich freilich ganz nüchtern konstatieren: Den Beweis, dass eine Geschichte 1.000 Seiten braucht, um erzählt werden zu können, kann auch Neal Stephenson nicht erbringen. Andererseits dürften die LeserInnen durch Stephensons bisheriges Schaffen ausreichend vorgewarnt sein - unter einer gewissen Länge macht der's einfach nicht. Überdies ist "Anathem" - ganz der in den theorischen Schulen geförderten geistigen Frische entsprechend - von einer optimistischen Grundhaltung und immer wieder auch von feinem Humor durchzogen. Bei aller Intellektualität des Stoffs bleibt das Ganze damit angenehm unverkrampft - so hätte man sich den Mathe- und Philo-Unterricht in der Schule gewünscht. Wer Spaß am Vorgang des Denkens an sich hat, der wird ihn auch an "Anathem" finden.
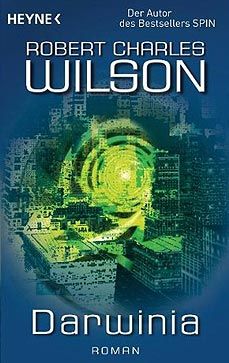
Robert Charles Wilson: "Darwinia"
Broschiert, 397 Seiten, € 9,20, Heyne 2010.
Eine kluge Entscheidung des Verlags, dieses Buch noch einmal herauszugeben. "Darwinia", 1998 geschrieben, erschien 2002 zum ersten Mal auf Deutsch - das war vier Jahre vor dem Rummel um "Spin", der den Namen Robert Charles Wilson per se verkaufsträchtig machte. Zugreifen, wer es bislang noch nicht getan hat: "Darwinia" ist im oberen Drittel des mittlerweile beeindruckenden Schaffens des Autors anzusiedeln: Es reicht vielleicht nicht ganz an die Meisterwerke "Spin" oder "Julian Comstock" heran, hält aber locker mit beispielsweise "Quarantäne" oder "Die Chronolithen" mit.
Im Jahr 1912 sind die Erinnerungen an das Tunguska-Ereignis und den Durchzug des Halleyschen Kometen noch frisch, als schon wieder ein mysteriöser Lichtschein den Nachthimmel erhellt. Gebannt blicken die Menschen in den USA nach Osten: "Es sieht aus wie das Ende der Welt", befindet die Mutter des Romanhelden Guilford Law. Guilford selbst hingegen, zu dem Zeitpunkt erst 14, glaubt eher, dass es der Anfang von etwas Neuem sein könnte - eine wichtige Charakterisierung, die sich in seinem späteren Handeln immer wieder äußern wird. Erst einmal müssen die Menschen aber verdauen, dass der transatlantische Telegrafenverkehr nach Europa abgerissen ist - sie finden sich gewissermaßen im Komplementärszenario zu John Birminghams jüngst veröffentlichtem "Der Effekt" wieder ... außer dass "Darwinia" das um viele Klassen bessere Buch ist. Nach und nach enthüllen zurückkehrende Schiffsexpeditionen das Ausmaß des Mysteriums: Von Island bis nach Nordafrika und in die russische Steppe hinein ist die vertraute Alte Welt verschwunden. Küstenverläufe, Gebirge und Flüsse sind unverkennbar dieselben geblieben, doch gibt es keine Spuren der bisherigen Besiedelung, und mit den Menschen sind auch alle Tiere und Pflanzen verschwunden - stattdessen überzieht ein exotischer Dschungel die Region. Als habe man ein Stück des Planeten herausgeschnitten und ihm irgendeinen fremdartigen Organismus aufgepfropft.
Acht Jahre später, als Guilford als Fotograf an einer Expedition in die Neue Alte Welt teilnimmt, der Spötter den Namen Darwinia verpassten, hat das Ereignis in den Vereinigten Staaten gesellschaftliche Spuren hinterlassen. Das Eintreten eines absolut unerklärlichen, offensichtlichen "Wunders" hat der ersten Blüte des Wissenschaftszeitalters etwas den Wind aus den Segeln genommen und religiöse Strömungen gestärkt - sehr zum Verdruss altgedienter Intellektueller, die noch im Geiste der Aufklärung sozialisiert wurden. "Soll Gott doch die Sodomiten heimsuchen. Die Belgier heimzusuchen ist irgendwie lächerlich", ätzt beispielsweise der Smithsonian-Forscher Eugene Randall, während Expeditionsleiter Preston Finch danach trachtet, Belege für seine kreationistischen Theorien zu finden. Guilford selbst findet radikalen Atheismus zwar eher abschreckend, kann sich das Denken aber nicht verkneifen: Er registriert, dass die "neuen Pflanzen" mehr Jahresringe haben, als seit dem Ereignis an Jahren verstrichen ist, und dass sie Samen produzieren. Ergo Erbgut haben müssen, was wiederum ein Beleg für Evolution ist. - Diese Konfliktlinie zwischen wissenschaftlichem Denken und religiösem Wunderglauben zieht sich durch den ganzen Roman; ganz ähnlich wie in "Julian Comstock", wenn auch mit etwas weniger verhärteten Fronten (aber "Darwinia" stammt ja auch noch aus den vergleichsweise unbeschwerten 90ern). Und die eigentliche Konfliktlinie verläuft ohnehin ganz woanders ...
... es wäre schließlich nicht Robert Charles Wilson, wenn wir es mit einem Fantasyroman zu tun hätten. Verschiedene Andeutungen werden bald eingestreut: Die Expeditionsteilnehmer träumen davon, dass sie in den Schützengräben eines unbekannten großen Krieges gestorben sind. Und der Scharlatan Elias Vale entwickelt plötzlich echte seherische Fähigkeiten, als er in Kontakt zu einer insektoiden "Gottheit" tritt, die ihm einerseits Unsterblichkeit verheißt und andererseits eröffnet, dass er bereits tot sei. Am Ende des ersten von mehreren Büchern, in die sich der Roman gliedert, wird es einen Perspektivenwechsel (und zwar einen ordentlichen) geben, der den Hintergrund vergleichsweise früh offenlegt. Dazu sei hier natürlich trotzdem nichts gesagt, aber ein Hinweis gegeben: Durch einen Satzfehler werden dort die Zahlen 109 und 103 auftauchen, wo eigentlich 109 und 103 stehen müsste. Macht was draus!
Ein anderer Perspektivenwechsel macht einen wesentlichen Teil des Vergnügens an "Darwinia" aus: Plötzlich ist Europa seinerseits zum Dunklen Kontinent geworden, der als Projektionsfläche für allerlei Fantasien herhalten muss. Edgar Rice Burroughs siedelt seine reißerischen Pulp-Geschichten nun nicht mehr im "finsteren Herz" Afrikas an, sondern in der darwinischen Wildnis, die Entdecker Finch mit Tropenhelm durchmisst und wo sich das neugebaute London als Western-artiges Pionierstädtchen präsentiert. Weniger lustig, aber ebenso treffend die Umkehrung der globalen Machtverhältnisse: Europa, das den Kolonialismus einst erfunden hat, ist nun per US-Doktrin zur allgemeinen Besiedelung freigegeben - ein wildes Gerangel um Rohstofflagerstätten und nutzbare Flächen setzt ein. - All das würde für einen guten Roman schon reichen, erhält durch die zunächst noch unbekannte Rahmenhandlung aber eine weitere Ebene. Möglich, dass Wilson, dessen schriftstellerisches Vermögen sich über die Jahre zusehends gesteigert hat, heute einen subtileren Handlungsaufbau wählen würde. Wodurch es in der zweiten Romanhälfte nicht nur um den Ausgang des epischen Kampfes im Hintergrund gehen würde, sondern man auch noch etwas länger über dessen Bedeutung rätseln müsste. Dann wäre "Darwinia" ein großartiger Roman geworden - so ist es aber immer noch ein sehr, sehr guter geblieben.
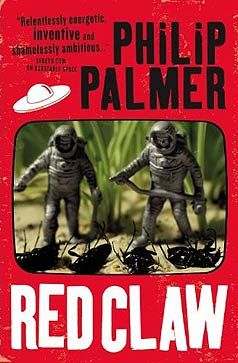
Philip Palmer: "Red Claw"
Broschiert, 464 Seiten, Orbit 2009.
Und wenn wir schon im Dschungel stecken, bleiben wir doch gleich da. Der hier liegt auf dem Planeten New Amazon, one mean mother of a place, wie der Biologe Hugo Baal als Mitglied eines menschlichen Expeditionsteams in seinen Blogs vermerkt. Philip Palmer, der mit "Debatable Space" (deutsch: "Zone") für seine ausgefallenen Ideen bekannt gewordene - und die Geschmäcker scheidende - britische Autor, tobt sich hier nach Herzenslust aus. Auf New Amazon wimmelt es von bizarren Spezies, die weder Tieren noch Pflanzen zuzuordnen sind (auch wenn Baal sich redlich abrackert, immer absurder werdende Klassifikationsschemata zu erstellen): Seien es Flesh-Webs, "Godzillas", ein Horde genannter Regen tödlicher Pollen oder die in die Stratosphäre reichenden "Aldiss-Bäume": Letzteres eine Verbeugung vor Brian Aldiss' Klassiker "Der lange Nachmittag der Erde", der in einer fernen Zukunft spielt, in der mobile Pflanzen die Tiere verdrängt und ihre Ranken bis zum Mond geflochten haben. Daneben nehmen sich Palmers Ideen dann fast (fast!) schon wieder konventionell aus - auch wenn er aus allen floralen Rohren feuert.
Apropos absurde biologische Taxonomien: Das dem Text vorangestellte Schema aus der chinesischen Kaiserzeit ist an Lächerlichkeit zwar nicht zu überbieten, aber Hugo gibt sich zumindest alle Mühe. Selbst dann noch, als sich rings um ihn längst die Leichen stapeln und Monster und Killer-Roboter ein Blutbad nach dem anderen anrichten, geht der sozial inkompetente Super-Geek seinen eitlen Befindlichkeiten nach. Wie es auch die übrigen Wissenschaftsdiven tun, deren Leben (und größtenteils auch Sterben) innerhalb eines Monats "Red Claw" zum Inhalt hat: Ben Kirkham etwa, den seine Psychopillen zwar zu einem ausgesprochen unsympathischen Zeitgenossen machen, die ihn aber wenigstens davon abhalten, zu einem - dann wieder freundlichen - Serienmörder zu werden. Oder Chefwissenschafter Richard Helms, der eine äußerst undurchsichtige Rolle spielt (weswegen man auch - anders als zuvor bei "Anathem" - die Appendizes erst nach dem Roman lesen sollte). Und mittendrin Major Sorcha Molloy, die man sich in etwa wie Hellga (mit Doppel-L), die famose Muskelwalküre aus "American Gladiators", ausmalen darf. Sie hasst WissenschafterInnen ebenso sehr wie außerirdische Lebensformen, findet sich aber wider Willen in einer Liaison mit Helms wieder. Schimpfend und schießend bahnen sie sich ihren Weg durch die grüne Hölle: "Perhaps it's a different species which mimics the Godzilla form." - "Or a later state in the creature's life cycle." - "Or just different." - "Let's take it down."
Das Pulp-Cover und der Rückseiten-Text - Space Marines and Science Heroes! Gryphons and Godzillas! - rücken "Red Claw" gezielt auf die Trash- und Exploitation-Schiene, mit der LiteraturkritikerInnen viel mehr Schwierigkeiten zu haben scheinen als ihre KollegInnen aus dem Filmbereich. Dabei wird hier nur bis ins Comichafte gesteigert, was zahllose Romane (von Ursula K. LeGuins "The Word for World is Forest" bis Alan Dean Fosters "Midworld") und Filme (zuletzt natürlich "Avatar") in gemäßigterem Ton vorerzählt haben: Das Vordringen HighTech-bewehrter Menschen, die - Achtung Botschaft - am Arsenal der Natur scheitern. Entsprechend auf die Spitze getrieben auch die Ausbeuter-Motivation von Palmers Expedition: Sie sollen nicht einfach plündern und etwaige Kollateralschäden an der Ökologie ignorieren. Sinn und Zweck ihrer ganzen Mission ist es, Proben zu sammeln und anschließend in irgendeinen galaktischen Zoo zu verfrachten, ehe die routinemäßige "Terraformierung" New Amazons einsetzt. Soll heißen: Die komplette Auslöschung des planetaren Bioms; etwaige Intelligenzformen wären ohne Belang. Denn als Hintergrund zeichnet Palmer in Form der Galactic Corporation eine zutiefst unmenschliche Gesellschaft, die Kasten und Sklaven kennt, und in der das Leben Einzelner (oder bei Aliens: aller) keine Relevanz hat. Bezeichnend daher: Als die Forschungsstation mitsamt eines Großteils ihrer Besatzung ausgelöscht wird, malen sich die Überlebenden die möglichen Gründe aus. Vielleicht wurde beschlossen, dass die wissenschaftliche Voruntersuchung New Amazons vor dem planetaren Genozid entfallen kann, wodurch das Forschungsteam nicht mehr gebraucht würde. Oder es haben sich einfach ein paar Online-Gamer aus der Erd-Elite einen Spaß daraus gemacht ein Gemetzel zu inszenieren ...
Sorgsamer Handlungsaufbau, tiefreichende Charakterisierungen und subtiles Andeuten - all das lässt sich in "Red Claw" nicht finden, statt dessen herrschen Atemlosigkeit, hoher Gore-Faktor und schwarzer Humor vor: Etwa wenn eine Nebenfigur erstmals Einblicke in ihre Psyche und Vorgeschichte gewährt - um gleich im nächsten Satz umgenietet zu werden. Oder wenn die Überlebenden in ihren Schutzanzügen lebendig begraben werden und sich das Warten in der Finsternis mit "Ich sehe was, was du nicht siehst" vertreiben wollen. Unterhaltsam ist "Red Claw" trotz aller Untiefen auf jeden Fall - und wem Palmers Art, vermeintlich Unvereinbares zusammenzustopfen und anschließend explodieren zu lassen, nicht gefällt, dem richten seine ProtagonistInnen folgendes aus: "I'll cut out your intestines. I'll eat them in front of you. I'll shit them back out again. Then I'll make you eat them. You got that?"
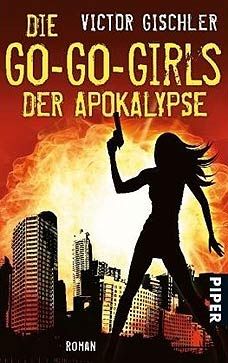
Victor Gischler: "Die Go-Go-Girls der Apokalypse"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
Die menschliche Gesellschaft hat ihn wieder, aber Liebe auf den ersten Blick ist es nicht, was zwischen den beiden entsteht. Er, das ist der ehemalige Versicherungsvertreter Mortimer Tate, und die ersten drei Menschen, denen er nach neun Jahren Eremitentum begegnet, erschießt er wegen eines Missverständnisses. Nummer 5, der zuvor Nummer 4 vergewaltigt hat, hackt dem armen Mortimer einen Finger ab und wird kurz darauf von Nummer 6 erschossen: So können Erstkontakte in einer postapokalyptischen Welt aussehen. Vielleicht wäre Mortimer doch besser in seiner lauschigen Höhle mit Fließendwasser und reich bestücktem Waffenarsenal geblieben - andererseits sind ihm der Kaffee und noch so ein paar Annehmlichkeiten ausgegangen. Und außerdem: Irgendwie neugierig wird man ja schon, was aus der Welt geworden ist, deren schleichenden Untergang Mortimer per Funk mitverfolgt hat, während er sich eigentlich auf der Flucht vor einem Scheidungsverfahren in seiner Einsiedelei einrichtete.
Und Überraschung: In ihren Grundzügen ist die Welt gar nicht so verändert, lediglich auf ein niedrigeres Technik-Level gesunken und etwas entvölkert. Aber im nächstgelegenen Städtchen Spring City, Tennessee, wo einst die Filialen der üblichen Fastfood-Ketten standen wie in jeder anderen US-amerikanischen Stadt auch, prangt nun "Joey Armageddons Sassy A-Go-Go" als Handels- und Vergnügungszentrum mit Monopolcharakter. Und das hat auch schon Ableger in den übrigen Siedlungen der Region gegründet: Die Namen haben sich geändert, die urbane Uniformität ist erhalten geblieben. Und noch eine Parallele gibt es: Das Verscherbeln seiner hochbegehrten Alkohol-Vorräte bringt Mortimer die Armageddon-Platinkarte ein (auf dem Logo steigt ein Atompilz zwischen Brüsten auf ...) - bezahlt kann damit nur in anderen Läden der Kette werden. WalMart entlohnt seine MitarbeiterInnen schon heute zum Teil mit Gutscheinen, die nur intern eingelöst werden können: Der Kapitalismus des 19. Jahrhunderts lässt grüßen.
... und dessen Pioniergeist auch. Der aus dem amerikanischen Süden stammende Autor Victor Gischler, der zuvor einige Krimis geschrieben hat und auch an der Comicreihe "The Punisher" beteiligt ist, entleiht für seinen ersten Ausflug in die Zukunft einige Motive aus dem Wilden Westen: Im Goldrush-Stil wird der Wert von Mortimers angeschleppten Besitztümern geschätzt, Banditen starten einen Zugüberfall - und oben genannte Nummer 6, Mortimers Lebensretter und fortan Wegbegleiter, läuft unter dem Namen Buffalo Bill durch die Gegend. Frauen indessen haben im wesentlichen eine einzige berufliche Option: strippende Saloon-Tänzerin. Die hat auch Mortimers (Ex-)Frau Anne gewählt, welche zu seiner Überraschung noch lebt und per Franchising-System an eine andere Go-Go-Filiale verkauft wurde. Aus einem etwas unausgegorenen Gefühl der Verbundenheit heraus beschließt Mortimer ihr nachzureisen und lernt so die neue alte Weltordnung kennen.
Ungeplantermaßen (vermutlich zumindest) wird einer von Mortimers Träumen zu einer Schlüsselstelle. In einem wilden Strudel des Science Fiction-Namedroppings nennt Gischler in diesem Traum auch "Logan's Run" - wer sich nicht erinnert: Das war jener Film, der auf Deutsch unter dem absurden Titel "Flucht ins 23. Jahrhundert" lief und in dem Michael York und Jenny Agutter mit blinkender Lebensuhr in der Handfläche aus ihrem unterirdischen Utopia flohen. Auf den Film folgte in den USA eine kurzlebige und reichlich trashige TV-Serie, in der die ProtagonistInnen durch eine bunte postapokalyptische Welt voller autonomer Klein-Soziotope stolpern, die sich irgendwie nebeneinander entwickeln konnten. Ganz so auch bei Gischler, wo Westernstädtchen ebenso existieren wie ein Kannibalenrevier oder eine unter einer Glaskuppel abgeschottete Frauenkommune.
2008 gelang Gischler mit "Go-Go-Girls of the Apocalypse" fraglos einer der Titel des Jahres - dass der Inhalt da nicht ganz mithalten kann, wird niemanden groß überraschen. Der Roman ist nicht wirklich eine Satire und schon gar kein unter die Haut gehender Überlebensbericht nach der großen Katastrophe, sondern einfach ein buntes Abenteuer. Gewürzt mit viel Blut, einer Prise Sex und einer kräftigen Dosis Humor. Wenn sich etwa zwei Kannibalinnen darüber unterhalten, dass sie das ganze Menschenfleisch und fermentierte Blut durchaus mal gegen einen schönen grünen Salat tauschen würden, hat das beinahe schon Gary Larson-Qualitäten. Gesamtbewertung des Romans: Nichts, das einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird; aber es macht Spaß, solange es anhält.

Oliver Plaschka: "Die Magier von Montparnasse"
Gebundene Ausgabe, 427 Seiten, € 22,60, Klett-Cotta 2010.
Uff. Für einen kurzen panischen Moment dachte ich schon, ich wäre bei der Buchbestellung einer Totalumnachtung zum Opfer gefallen: Erst prangt mir am Buchrücken das unsägliche V-Wort entgegen und dann lese ich noch - der Zufall kann echt boshaft sein - an der ersten willkürlich aufgeschlagenen Stelle was von "Malen am Hals". Aber Entwarnung: Die Vampire dienten nur für einen Vergleich und die Male stammen (juhu!) von einer Strangulation; ganz ohne nervenzerfetzend öde Blutsaugerei. Doppelt erleichternd, weil der Deutsche Oliver Plaschka mit dem Paris der 20er Jahre eines der Settings gewählt hat, in denen andere AutorInnen bevorzugt ihre humanoiden Zecken absetzen würden. Ironie am Rande: Demnächst wird die Stephenie Meyer-Parodie "Nightlight" der Satirezeitschrift Harvard Lampoon auf Deutsch erscheinen - übersetzt von Plaschka.
Es ist Sonntag, der 26. September 1926, als der Zauberkünstler Ravi am Ende eines einwöchigen Engagements noch einmal seinen spektakulären ägyptischen Entfesselungstrick aufführt. Doch diesmal geht etwas schief und Ravi kann sich und seine Assistentin Blanche nur durch den Einsatz echter Magie retten. Die beiden wissen, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird, denn die geheimnisvolle Société Silencieuse wacht aufmerksam über jede Anwendung von Magie. Ravis ironische Tarnung als Bühnenzauberer ist aufgeflogen - und dass Blanche am Ende des Tages ein Ritual vollzieht, dessen Bedeutung erst ganz am Schluss einer überraschenden Erklärung zugeführt wird, weckt erst recht Aufmerksamkeit. Die Konsequenzen zeigen sich schon am nächsten Tag: Der ist nämlich wieder der 26. September, ebenso wie der danach und der danach. Zumindest alle weltlichen EinwohnerInnen von Paris sind von nun an in einer Zeitschleife gefangen, ohne es zu wissen - sie spüren nur, wie sich eine Tag für Tag schlimmer werdende Trübnis über die Stadt legt.
Im Aufbau zeigt "Die Magier von Montparnasse" einige erstaunliche Parallelen zu "Lost". Als Insel fungiert hier das kleine Hotel "Le Jardin", das vom Ehepaar Alphonse und Esmée betrieben wird und in dem die junge Justine - einst von einem Verehrer sitzen gelassen - als Kellnerin gestrandet ist. Ravi und Blanche sind hier vor einer Woche abgestiegen, und nach und nach finden sich weitere Charaktere ein: Der britische Magier Barneby, die sphinxhafte karibische Zauberin Céleste und, ganz weltlich, der junge Schriftsteller Gaspard, der sein Manuskript so gerne Hemingway in die Hand drücken würde. All diese Figuren werden abwechselnd zu Ich-ErzählerInnen, aus deren überlappenden Perspektiven sich das Geschehen zusammensetzt. Wie wir nach und nach erfahren, sind die ProtagonistInnen durch ihre Vorgeschichten auf vielfältige Weise miteinander verwoben - teilweise lange vor den Zeitschleifen-Bann zurückreichend, noch einmal verstärkt aber durch die folgenden Tage, die sich nicht identisch, sondern stets mit Abweichungen wiederholen. Beziehungen und Ereignisse scheinen sich selbst zu bedingen, Erinnerungsfragmente an vermeintlich nie Erlebtes lassen das Kausalitätsgefühl der Beteiligten verschwimmen. Und selbst die vom Effekt nicht betroffenen MagierInnen haben an Rätseln zu kauen: Wer ist für die Zeitschleife letztlich verantwortlich und was bezweckt er damit? Wer steht in diesem Spiel der Täuschungen und Möglichkeiten auf welcher Seite? Und wer hat den anfangs erwähnten Mord begangen, bei dem ausgerechnet die Figur zum Opfer wurde, die von allen am gefährlichsten zu sein schien?
Eine hilfreiche Mäuseschar, eine Frau, die zugleich eine Katze ist, ein in Ungnade gefallener Engel und sein gnomenhafter Begleiter, schließlich sogar der Leibhaftige selbst beziehen Stellung im großen Spiel - wobei Plaschka stets sehr geschickt über den Grat zwischen Andeutung und Erklärung wandelt, mit wem die LeserInnen es jeweils zu tun haben. Mit spielerischer Leichtigkeit platziert er auch einige mehrfach symbolbeladene Gegenstände auf dem Brett - allen voran den Apfel, den Blanche für ihr Ritual verwendete und der sie in einen nicht enden wollenden Schlaf schickte: Schließlich ist Blanche-Neige der französische Name für Schneewittchen - zugleich verweist der Apfel aber auch auf die metaphorische Frucht vom Baum der Erkenntnis, was ebenfalls eine Rolle spielen wird. All dies sind Aspekte eines großen Rätsels, und an dessen Rand tummelt sich - ebenfalls wie bei "Lost" - auch eine Reihe kleiner privater Geheimnisse, die es zu entschlüsseln, und Schicksale, die es zu erfüllen gilt. Die gute Nachricht: Es wird auf nichts vergessen werden.
Wenn im allerersten Satz von "Die Magier von Montparnasse" die Ereignisse rückblickend als ein solches Tohuwabohu beschrieben werden, ist von Anfang an klar, dass es nicht allzu schlimm kommen wird. Der Roman lebt weniger von der Action an sich als von seiner Atmosphäre des Magic Realism, in Szene gesetzt an einem der dafür wohl geeignetsten Schauplätze überhaupt. Und wenn man sich dabei gelegentlich weniger im realen Paris der Vergangenheit wähnt als in einem, wie es ein altes Film-Musical zeigen würde - ein armer Maler hier, amerikanische Matrosen im Straßencafé da -, dann stört das deshalb nicht, weil es die unwirkliche Stimmung unterstreicht, die sich mit dem Bann über die Stadt legt. Das Aufdröseln eines komplizierten Handlungsknotens kann - siehe Gordon Dahlquists "Glasbücher"-Reihe - bei aller Ehrfurcht vor der schreiberischen Leistung durchaus zur Lesearbeit werden; so schwebend leicht, wie es hier geschieht, bereitet es auch Vergnügen.

Christian Endres: "Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes"
Broschiert, 230 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.
Vorneweg der Ehrlichkeit halber ein Bekenntnis: Ich bin kein Krimi-Fan und daher auch kein Holmes-Experte. Möglich, dass die 23 hier enthaltenen Erzählungen voller raffinierter Anspielungen auf das kanonische Werk von Arthur Conan Doyle stecken - allein: Solange es nicht um den Auftritt eines Professor Moriarty oder eines sehr großen Hundes geht, würde ich sie nicht entdecken. Aber das ist ja auch nur die halbe Miete: Der deutsche Autor Christian Endres setzt seine Holmes-Faszination in Form des Crossovers um: Ein eigenes Genre mit eigenen Plot-Anforderungen und einem eigenen Fankreis. Die fiktive Welt des Sherlock Holmes, die schon rückwirkend den Vorläufern des Steampunk einverleibt wurde, ist in der Vergangenheit immer wieder in Werke aus dem Bereich Phantastik eingeflossen; im Vorwort wird eine Reihe davon genannt. So auch hier, wo sich Ich-Erzähler Dr. Watson all die Dinge von der Seele schreibt, die in "offizielle" Aufzeichnungen bislang nicht eingehen durften. Übernatürliche Dinge.
"Folgen Sie dem Boten. Überallhin." wird Holmes in "Pelz und Kokain" als Nachricht überbracht - ein Auftakt, der stellvertretend für einige der hier versammelten Episoden steht und der Holmes unter anderem nach Oz, aufs Meer hinaus zu den Sirenen oder hinab in die Londoner Unterwelt zu Ghulen und anderen finsteren Gestalten führt. Werwölfe und Allvater Odin werden auf die eine oder andere Art ebenso eingebracht wie Radagast (der Braune), Michael Jackson (der Weiße), Falco oder Edward mit den Scherenhänden. Das Rätselspiel mit Zitaten, Anspielungen und Insider-Gags ist einerseits dem Detektiv-Thema ausgesprochen angemessen und auch vergnüglich. Andererseits lässt sich aber auch unmöglich prognostizieren, wie es auf die einzelnen LeserInnen wirkt.
Zwei Beispiele: Wenn sich in "Ratten im Gemäuer" nicht nur das Motiv des Rattenfängers von Hameln wiederfindet, sondern beim Erklingen der hypnotisierenden Musik plötzlich auch noch seltsames Farbenspiel am Himmel sichtbar wird, dann wird es bei Lovecraft-LeserInnen schnell *klick* machen. Andere werden dem kurz darauf eingestreuten Namen Erich Zann hinterhergoogeln müssen, um eventuell einen Zusammenhang herzustellen. Zweiter Fall: Wenn in "Das Geschenk der Freiheit" ein Schiff mit Namen "Molly Grue" im Hafen anlegt, werden Fans von Peter S. Beagle sofort nach einem Einhorn Ausschau halten - lange bevor es auftaucht. Es wird Holmes übrigens nicht seinen Kopf in den Schoß legen; das wäre doch mal eine Aussage gewesen. Fast könnte man angesichts der sexuellen Ambivalenz, die Holmes spätestens seit Billy Wilder angehängt wird, glauben, dass Endres hier eine Chance verpasst hat, dem Mysterium noch eine weitere Schraubenwindung zu verpassen - aber halt, geht ja nicht: Da gibt es ja auch noch Holmes' attraktive Widersacherin Irene Adler (doch noch ein Motiv, das mir aus Nebeln der Erinnerung auftaucht). Die kehrt hier ebenfalls wieder. Hat sich also was mit Jungfräulichkeit.
Die etwas mechanische Wirkung, die das Crossovern hat, lässt eher Technik- als Kürpunkte zu; verstärkt noch dadurch, dass die Episoden mehrheitlich sehr kurz sind. Zu kurz auch, um - außer bei der mit dreißig Seiten längsten Geschichte "Das Uhrwerk des Todes" - Spannung im herkömmlichen Sinne aufkommen zu lassen, wofür man eine sich langsam aufbauende Atmosphäre bräuchte. Im Vordergrund steht daher eher der kluge Witz. Und aus demselben Grund gehören einige superkurze Episoden, die gar nichts mit Detektivarbeit zu tun haben, sondern sich um Holmes' Allüren oder das Spiel zwischen Holmes und Watson drehen, zu den lesenswertesten. Bis hin zu einer auf Handlung verzichtenden surrealen Szene, in der sich alle Sherlock Holmes-Darsteller der Filmgeschichte in einem Raum versammeln. Oder fast alle. Robert Downey, Jr. ist noch nicht dabei: Da sieht man, wie populär die Figur ist - man kann mit den Wiederbearbeitungen des Stoffs einfach nicht Schritt halten.
Noch mehr als sonst gilt hier die goldene Kurzgeschichtenregel: Portionieren. Nicht in einem durch lesen, sondern sich die Episoden besser einzeln als vergnügliches Häppchen gönnen. Zum Beispiel als leichte Aufmunterung am Ende einer Leseetappe, mit der man wieder mal einem monströsen Wälzer ein paar hundert Seiten abgerungen hat.
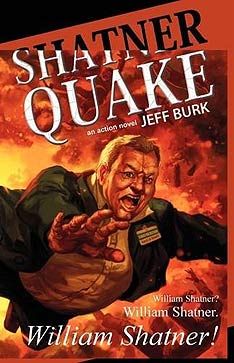
Jeff Burk: "Shatnerquake"
Broschiert, 100 Seiten, Eraserhead/Swallowdown Press 2009.
"Was ist die älteste Masse, die um die Sonne kreist?" wurde Fran Fine mal in einer "Nanny"-Folge gefragt; ihre Antwort lag auf der Hand. Dabei hat William Shatner nicht nur den raumfahrenden Womanizer James T. Kirk - im wahrsten Sinne des Wortes - verkörpert. Der Mann hat, ganz ohne Spiegeluniversum, noch viele, viele Facetten mehr. Den altgedienten Polizisten in "T.J. Hooker", den Denny Crane in der Anwaltserie "Boston Legal", den Moderator der Realityshow "Rescue 911", und und und. Schauspieler, Autor, Schöpfer seiner eigenen Marke und nicht zuletzt Sänger (letzteres file under: special interest). All diese Inkarnationen lässt der junge Bizarro-Autor Jeff Burk aus Oregon in "Shatnerquake" aufeinander treffen. Und Amok laufen. Im sympathischen Vorwort heißt es daher nicht ohne Grund: Dear William Shatner, this work is a tribute to you. Please don't sue me.
Zynisch kommentiert Shatner - der "reale" - aus seiner Limousine die kostümierten Fans, die zum großen ShatnerCon in ein futuristisches Megaplex-Zentrum strömen, wo er natürlich als Stargast auftreten soll. Drinnen wird er dann aus dem Staunen nicht mehr rauskommen - spätestens wenn er durch die Memorabilia-Sammlung irrt, mit der sein Leben geehrt wird und in der unter anderem seine gebrauchten Kondome ausgestellt werden. Und erst recht, nachdem die Campbellians - Anhänger von Genre-Ikone Bruce Campbell und Todfeinde aller Shatner-Fans - eine Fiction Bomb gezündet haben, die Shatners diversen Leinwand- und Mattscheiben-Charakteren Zutritt zur Realität verschafft. Zornig erkennen sie, dass sie nur Schatten des Einen sind und starten einen Rachefeldzug. Kirk killt als Klingonen kostümierte Trekker, Panik breitet sich aus - und immer wenn jemand von übergewichtigen SF-Fans zu Tode getrampelt wird oder sonstwie unschön zu Tode kommt, steht der Shatner aus "Rescue 911" bereit, um deren Ableben live zu kommentieren. Hilflos müssen die drei Campbellians Bruce, Bruce & Bruce (eineR davon weiblich) mitansehen, was sie da angerichtet haben.
"Shatnerquake" ist nicht einfach nur ein echter Brüller, sondern auch noch ausgesprochen intelligent: Zugeschneidert auf eine Popkultur, die inzwischen einen bemerkenswerten Grad an Selbstreferenzialität erreicht hat. Erst kürzlich wurde Ian McKellen bei einem seriösen CNN-Interview gefragt, auf wen er bei einem Zweikampf zwischen Gandalf und Magneto setzen würde. Und die Campbellians hat Burk auch nicht zufällig ausgewählt: 2007 machte Bruce Campbell sich selbst in der Action-Komödie "My Name is Bruce" zum Meta-Charakter seiner eigenen Filmkarriere. Überhaupt orientieren sich die AutorInnen des Bizarro-Genres gerne am Film, der das weite Land zwischen Exploitation, Surrealismus und "schlechtem" Geschmack schon viel länger auslotet. Nicht von ungefähr hat sich einer der wichtigsten Bizarro-Verlage nach David Lynchs "Eraserhead" benannt. Im Bizarro-Manifest werden die inhaltlichen Eckpfeiler - von weird über goofy und bloody bis borderline pornographic - bereitwillig dargelegt, plus ein entscheidender Satz: Bizarro often contains a certain cartoon logic that, when applied to the real world, creates an unstable universe where the bizarre becomes the norm and absurdities are made flesh. Diese Cartoon-Logik manifestiert sich nicht zuletzt auch im fließenden Übergang zwischen schreibenden und zeichnenden Angehörigen des Genres - und in der unschlagbaren Bildhaftigkeit, in der man sich das Geschehen ausmalen kann. Schließlich ist Bizarro, above all, fun to read.
Mit einer Art Happy End wartet Burks Novelle übrigens auch auf: Auf der letzten Seite präsentiert sich der Autor auf einem Autogramm-Foto mit der (äußerst gefälscht aussehenden) Unterschrift "To Jeff, Love the Book. William Shatner" - wollen wir's ihm wünschen, dass es wirklich so ist. Dann kann Jeff Burk nicht nur sein nächstes Projekt "HomoBomb" (keine falschen Assoziationen: es geht um eine Bombe, die nur auf ihresgleichen abzielt) verwirklichen, sondern auch die angedachten Fortsetzungen "Shatnerquest" und "Shatnerpocalypse".
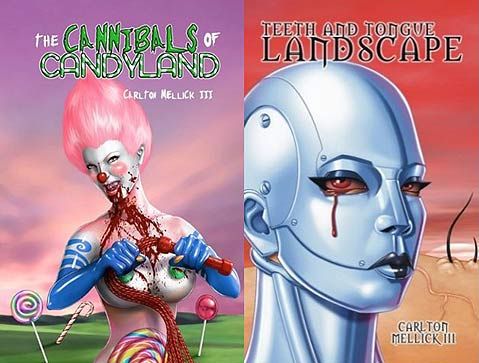
Carlton Mellick III: "The Cannibals of Candyland" + "Teeth and Tongue Landscape"
Broschiert, 151 bzw. 112 Seiten, Eraserhead/Swallowdown Press 2009 bzw. 2006.
Wir drehen noch eine Ehrenrunde im Genre: Carlton Mellick III - aus dem amerikanischen Südwesten ins Bizarro-Mekka Portland, Oregon, eingewandert - ist der wohl produktivste und auch erfolgreichste Autor seiner Zunft. Zugleich ist er derjenige, der das Spiel mit Trash- und Exploitation-Verweisen in der Titelgebung am professionellsten beherrscht. Bekannt geworden mit "Satan Burger", hat er bereits poetische Perlen wie "Electric Jesus Corpse", "The Menstruating Mall" oder "Adolf in Wonderland" erdacht. In der internen Abstimmung der Eraserhead-Gemeinde konnte er unlängst mit "The Haunted Vagina" den Sieg im Titel-Contest verbuchen - wenn auch nur ex aequo, denn an Cameron Pierces "Ass Goblins of Auschwitz" gab's heuer wirklich gar kein Vorbeikommen.
Im Mittelpunkt von "The Cannibals of Candyland" steht der Loser Franklin - aufgrund der genretypischen Extremophilie und Romankürze schnell und überraschend effektiv charakterisiert: Auf der Straße mobben ihn Schulkinder, zuhause treiben's seine wives (Frau und Schwiegermutter) mit Fremden, während Franklin sich in einer Kabine verkriecht, die er sich mitten im Wohnzimmer aus Spanplatten zusammengezimmert hat. Und dort arbeitet er an seinem Lebensprojekt: Zu beweisen, dass es die aus Zuckerzeug bestehenden Candy People, die in den Straßen auf Kinderfang gehen, wirklich gibt. Einst hat eine Frau mit Zuckerwattehaar, Reißzähnen und betäubendem Erdbeerduft - das Titelbild gibt sie äußerst exakt wieder - seine drei Geschwister aufgefressen. Dass er dieses Jugendtrauma als Erwachsener aufarbeitet, indem er in die Unterwelt hinabsteigt, um sich dem Monster seiner Vergangenheit erneut zu stellen, weckt unwillkürlich Erinnerungen an "Es" ... wenngleich Stephen King irgendwie nie einkalkuliert hat, seine Helden könnten auch mal Lust auf Sex mit dem Clown Pennywise verspüren. Denn für Franklin kommt alles ganz anders, als er sich das in seinen Racheplänen ausgemalt hat. Erst rettet ihn die Mörderin seiner Geschwister - Jujube ihr Name - vor einer Horde fresswütiger Kaugummi-Pacmans, dann schleppt sie ihn in ihre Hütte und betrachtet ihn als ihr Eigentum. Womit zu "Es" auch noch "Misery" kommt.
Situationskomik wirkt umso stärker, je komplizierter die emotionale Gemengelage zwischen den Beteiligten ist - und die hier lässt sich schwerlich überbieten. Als Franklin erwacht, nagt Jujube gerade an seinem abgesägten Bein. Beiläufig merkt sie an, dass Kinderfleisch zarter schmeckt - und erschrickt, weil sie ihn damit vielleicht beleidigt haben könnte. Also isst sie das Bein aus Höflichkeit brav auf. Es wird der Beginn einer wunderbaren Beziehung, und der Rest ist Geschichte. Eine ziemlich gute obendrein.
Die zwei hier vorgestellten Kurzromane sind aus Mellicks umfangreichem Schaffen relativ beliebig herausgegriffen - in beiden äußert sich aber seine Liebe zur Landschaftsarchitektur. Die "Cannibals" basieren auf dem hierzulande kaum bekannten US-amerikanischen Brettspiel "Candy Land": Eine pastellfarbene Kitschwelt von Lollipopbäumen und Honigflüsschen, die hier zum Schauplatz eines Gore-Spektakels wird. Analog dazu hat sich übrigens Bizarro-Kollege Lotus Rose der ähnlich gestrickten Welt von "My Little Pony" in seiner Novelle "MachoPoni" angenommen; und irgendwo dreht wohl auch gerade jemand "Hello Kitty" durch die Mangel. - Ganz anders das Panorama in der "Teeth and Tongue Landscape": Die Erde ist hier ein lebender Organismus mit Haaren (und streckenweise großflächigem Herpes), aus dem die Menschen mit Bulldozern Fleisch abbauen und aus dessen unterirdischen Arterien sie Blut hochpumpen: Ihre Diät gleicht also weitestgehend derjenigen der Candy People - aber außer ein paar halbmechanischen Tieren, die niemand schmecken, fehlen in dieser Welt aus Fleisch ja auch die Alternativen.
Humorvoll ist der Ton hier nicht. Gegliedert in drei Akte zu jeweils 20 Szenen entfaltet sich ein im Grunde todtrauriges Drama um einen nicht namentlich genannten Protagonisten, der eines Tages von einem Ausflug zurückkehrt und seine Heimatstadt - soweit er weiß zugleich die letzte Stadt auf "Erden" - leer vorfindet. Auf seiner Suche nach Gesellschaft trifft er auf Maschinenwesen, Engel, die sich nach dem französischen Skandalfilm "Themroc" benannt haben, und einen resignierten Gott; und, zugegeben, der Ekel-Faktor ist bisweilen spektakulär. All diese bizarren Versatzstücke verblassen aber angesichts des Schicksals von einem, den sein tiefes Bedürfnis, in eine Gemeinschaft integriert zu sein, zu allem bereit macht: Widersprüchliche Regeln zu befolgen, vollkommen sinnlose Arbeiten zu erledigen (und davon gibt es in einer so extrem surrealen Welt eine Menge) ... und letztlich auch Verrat zu begehen. - Angesichts des Umstands, dass Bücher - auch diese beiden hier - heute nur noch ein paar Amazon-Klicks entfernt sind, erscheint es absurd, von "literarischem Underground" zu sprechen. Aber viel näher wird man dem Begriff nicht kommen können.
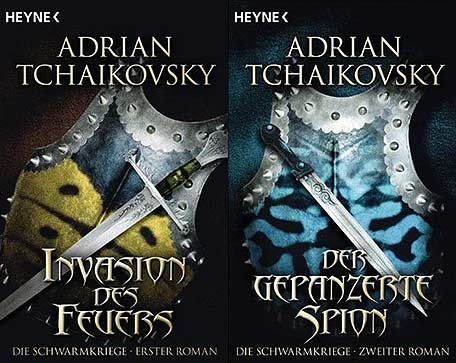
Adrian Tchaikovsky: "Invasion des Feuers" + "Der gepanzerte Spion" ("Die Schwarmkriege" 1 + 2)
Broschiert, 446 bzw. 447 Seiten, jeweils € 9,20, Heyne 2010.
Achtung, diese beiden sind als ein Buch zu betrachten. Denn gemeinsam bilden sie den Originalroman "Empire in Black and Gold" (was leicht teutonische Assoziationen wecken könnte und in Zeiten der neuen schwarz-gelben Koalition vielleicht doppelt seltsam rüberkäme: der Titelwechsel leuchtet also durchaus ein ...). Mit diesem Band startete der Brite Adrian Tchaikovsky 2008 seine Reihe "Shadows of the Apt", die auf Deutsch nun als "Die Schwarmkriege" erscheint. "Invasion des Feuers" endet jedenfalls mitten im Geschehen - darum nur gemeinsam mit "Der gepanzerte Spion" kaufen!
Ziehen wir das Ganze wie ein Rollenspiel auf und beginnen mit der Kampagnenwelt: Die ist an der Grenze von Fantasy und Steampunk angesiedelt. Die industrielle Revolution ist noch recht jung und hat auch noch nicht alle Länder dieser Welt erfasst - aber immerhin schon Luftschiffe, Automotiven und erste Experimente mit mechanischen Dienern hervorgebracht. Vorangetrieben wird die Entwicklung von den Menschenvölkern, die - daher der Originaltitel der Reihe - als die Geeigneten bezeichnet werden: Wissenschaft und Mechanik liegt Käfern, Ameisen & Co gewissermaßen im Blut, während andere wie Libellen oder Spinnen keine Armbrust bedienen könnten, wenn ihr Leben davon abhinge. Und damit sind wir schon bei der zweiten und eigentlichen Besonderheit der Reihe: Benannt sind die einzelnen Völker nach Insektengattungen - oder genauer gesagt Arthropoden. Immerhin sind auch Spinnen und Skorpione dabei, und Tchaikovsky würde als gelernter Zoologe wohl die Stirn runzeln, wenn man mit den Taxa herumschlampt. Bemerkung am Rande: Gelegentlich muss man sich beim Lesen in Erinnerung rufen, dass hier nicht das Biene Maja-Ensemble agiert - es sind Menschen mit allenfalls minimalen körperlichen Besonderheiten.
Was das beschriebene Setting so rollenspielkompatibel macht, ist der Umstand, dass jedes Volk über eine oder mehrere Künste verfügt: Während die Käfer die MacGyvers ihrer Welt sind, können Spinnen den Geist anderer manipulieren, Wespen eine "Stachel" genannte Flamme abfeuern und Ameisen sind untereinander telepathisch verbunden; gleichzeitig hat jedes Volk seine Defizite. Man sieht also förmlich die Talentpunkte-Karten vor sich liegen. Grundmentalitäten sind auch gleich mitfestgelegt: Die Käfer sind fleißig, Fangschrecken von Rache besessen, Spinnen tückisch und verschlagen, wie es ihrer Art entsprach. - Das klingt zunächst einmal ziemlich plump - doch so leicht lässt sich Tchaikovsky zum Glück nicht auf rassistische Simpelei festlegen: Konstrukte sind die volksspezifischen Eigenschaftenbündel nämlich nicht nur in Hinblick auf den Handlungsrahmen, sondern auch für jeden einzelnen Akteur. In einer vorerst nur angedeuteten fernen Vergangenheit, als die Welt noch von Rieseninsekten beherrscht war, konnte sich die Menschheit das Überleben nur sichern, indem sie tierische Eigenschaften annahm. Eine Reihe von Idealgestalten - manifestiert in der jeweiligen Volksbezeichnung - wurde geschaffen. Und während manchen ihre Rolle leichtfällt, müssen andere sie sich hart erarbeiten. Niemand weiß das besser als das Käfermädchen Ju, das nicht nur darunter leidet, dass ihr Name voll ausgeschrieben "Jubelgut" lautet, sondern auch dass sich ihre Kunst nicht einstellen will. In Meditationen rackert sie sich daher ab, um sich der geforderten Idealgestalt anzunähern.
Ju ist die Nichte Stenwold Werkers, der in den "Schwarmkriegen" eine Gandalf-ähnliche Rolle einnimmt: Vor zwei Jahrzehnten erlebte er vor Ort mit, wie die unabhängige Stadt Myna vom aufstrebenden Wespen-Imperium erobert wurde. Seitdem agiert er in den heimatlichen Tieflanden als Mahner in der Wüste, der vor der Ausbreitung des schwarz-gelben Faschismus im Osten warnt, und wird doch nur als peinliches Ärgernis wahrgenommen. Seine Funktion als Lehrmeister an der Akademie des Stadtstaats Collegium nutzt er daher dafür, ausgewählte Studierende zu AgentInnen auszubilden. Zur Kerngruppe, die den Kreis seiner einstigen KampfgefährtInnen widerspiegelt und die zu diesem mehr Anknüpfungspunkte hat, als zunächst zu erahnen ist, gehören neben Ju das Halbblut Totho, die Spinne Tynisa und der Libellenprinz Salma. "Invasion des Feuers" schildert ihre Mission, die sie sukzessive Richtung Osten führt und die für sie zugleich - ganz fantasytypisch - zum Anlass für Charakterbildung und innere Reifung wird: Playboy Salma beginnt sich für die Belange anderer zu interessieren; Totho wiederum, den seine Mischlingsherkunft normalerweise zu einem Sklavenstatus verdammen würde, entdeckt seine Begabung als Tüftler und damit seinen Wert als Individuum. Und Tynisa ringt zunehmend mit der braven Käfermoral, unter der sie als Stenwolds Adoptivtochter erzogen wurde, als sie bemerkt, dass ihr das Töten liegt. Sogar am Herzen.
Ein paar Worte noch zu "Der gepanzerte Spion", das die Handlung von Teil 1 mit gesteigerter Mantel-und-Degen-Quote in Form von Fechtkämpfen in Verliesen, Kellern und Korridoren nahtlos fortführt: Bisherige Nebenfiguren werden in ihrer Rolle ausgebaut, vielversprechend dabei die des Wespenoffiziers Thalric. Als treuer Diener des Imperiums wird er zur Nemesis der GefährtInnen, zeigt aber einige interessante Bruchlinien: Geradezu idealistisch nimmt sich sein Führerglaube aus - während unter der Oberfläche ein eigentümlicher Groll auf sich selbst und möglicherweise auch auf das kriegerische Wesen seiner Heimat brodelt. Mal sehen, wie das weitergeht - "Empire in Black and Gold" reißt jedenfalls ein großangelegtes Abenteuer-Szenario an, das noch viele Möglichkeiten bieten könnte.
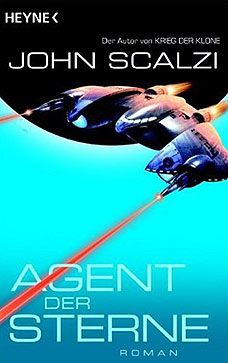
John Scalzi: "Agent der Sterne"
Broschiert, 446 Seiten, € 9,20, Heyne 2010.
"Wenn man einfach gut ist, ist man einfach gut." So lautet das Credo von Tom Stein, 28, Single, Beruf: Hollywood-Agent. Einer aus der - noch - zweiten Reihe, aber bereits mit einem waschechten Star in seiner Klientenschar und daher auf dem aufsteigenden Ast. Genau der richtige Mann also für seinen Boss, um ihm einen ganz speziellen Kunden mit "Imageproblem" vorzustellen: Eine Aquariumfüllung stinkenden Gelees, die auf den Namen Joshua hört und dem außerirdischen Volk der Yherajk angehört. Die haben sich zum Erstkontakt mit der Menschheit entschlossen, sind sich aber der Bedeutung des ersten Eindrucks nur zu bewusst. "Wir sehen aus wie ein Haufen Rotz", räumt Joshua gänzlich uneitel ein. Und dass die Yherajk untereinander mit Düften - genauer gesagt: Gestänken - kommunizieren, dürfte ihre Aufnahme in der Öffentlichkeit auch nicht eben erleichtern.
Im Grunde greift John Scalzi damit in komödiantischer Form ein ganz altes Motiv der SF wieder auf: Die Overlords aus Arthur C. Clarkes "Die letzte Generation" lösten ihr Problem, dass sie exakt wie Satan persönlich aussahen, kurzerhand damit, dass sie eben keine Bildübertragung zuließen. Aber das waren die 50er, und heute kann sich außer Thomas Pynchon niemand mehr leisten, gar kein Image zu haben. Daher also die Idee mit dem PR-Berater - der Originaltitel "Agent to the Stars" trifft's auf den Punkt. Ironie am Rande: Den in SF-Filmen zur Tradition gewordenen Einstandsbesuch beim US-Präsidenten lehnen die Aliens hier ab, weil der ja nicht für den ganzen Planeten spreche - amerikanische Filme hingegen schon. Wenn der Autor aus Ohio da mal nicht einen Stuhl weiter derselben Selbsttäuschung aufgesessen ist wie zahllose Filmregisseure vor ihm; aber sei's drum. Irgendwo muss man ja anfangen und als tanzender Bollywood-Akteur hätten's die formlosen Aliens vermutlich auch nicht leichter. Joshua kann jedenfalls fließend Yoda zitieren und die Ähnlichkeit zwischen seinesgleichen und dem Blob würdigen. Überhaupt finden die Yherajk die Produkte der westlichen Populärkultur viel informativer als die "amüsanten" Kontakt-Versuche von SETI.
Humor mag nicht das erste sein, woran man bei John Scalzi denkt, obwohl auch die Dialoge in seiner erfolgreichen "Old Man's War"/"Krieg der Klone"-Reihe ansatzweise von demselben Sitcom-Humor durchzogen sind, der im Frühwerk "Agent to the Stars" - in den 90ern im Netz publiziert und erst 2005 als Buch gebunden - noch viel stärker präsent ist. Tom hat sich mit Joshua jedenfalls einen WG-Partner eingehandelt, der sich als ebenso witzig wie pflegeleicht erweist: Wäre er kein Protoplasmaklumpen, würde Joshua wohl in T-Shirt und Turnschuhen herumlaufen.
Mit derselben Lässigkeit können auch die außerhäuslichen Herausforderungen angegangen werden: Weniger der Kontakt der Welten - der wird sich später so quasi nebenbei ergeben -, sondern die täglichen Turbulenzen im Filmgeschäft. Toms wichtigste Klientin Michelle Beck, die kürzlich mit einem trashigen SF-Schinken überraschend zum Weltstar mutierte, ist zwar ein Airhead, wie er im Buche steht, hat sich aber dennoch in den Kopf gesetzt, in einem hochseriösen Film eine Holocaust-Überlebende zu spielen ... immerhin hat sie ja inzwischen Hannah Arendts "Eismann in Jerusalem" gelesen ... Tom und seine schlagkräftige Assistentin Miranda müssen hier nicht nur herkulische Überzeugungsarbeit leisten, sondern sich auch noch der hartnäckigen Recherchen von Klatschreporter Jim Van Doren erwehren, der noch gar nicht ahnt, welcher Sensation er da wirklich auf der Spur ist. Joshuas Fähigkeiten als Gestaltwandler bzw. "Körperfresser" werden in der Folge mehr als einmal gefragt sein. - Alf, Mork vom Ork und der Onkel vom Mars lassen grüßen: Dort wie hier geht es in Scalzis unterhaltsamem Frühwerk hauptsächlich um höchst irdische Probleme, bei deren Lösung ein freundliches Alien behilflich ist, das sich im Hinterzimmer versteckt. Fürs erste.

Karl Schroeder: "Planet der Sonnen"
Broschiert, 447 Seiten, € 9,20, Heyne 2010.
Zum Schluss noch ein Kurztipp ohne viel Gedöns: Ebenfalls bei Heyne ist kürzlich Karl Schroeders "Planet der Sonnen" erschienen, erster Roman aus dem "Virga"-Zyklus über ein Konglomerat aus schwebenden Städten und Inseln, das innerhalb einer gigantischen Luftblase durchs All treibt. Das muss ich hier nicht weiter ausführen, der Roman wurde schon anhand der Originalausgabe besprochen (--> "Sun Of Suns"). Wenn sich genug LeserInnen für Schroeders faszinierende Welt ohne Schwerkraft interessieren, werden auch die weiteren Teile auf Deutsch erscheinen und dann auch hier besprochen werden.
In der nächsten Rundschau geht es aber erst einmal um die Frage, wie Polarforscher darauf reagieren, dass ihr letzter Funkkontakt nach Hause vom Untergang der Zivilisation kündet. (Josefson)