
Paolo Bacigalupi: "The Windup Girl"
Broschiert, 300 Seiten, Night Shade Books 2010.
Glück gehabt! Jedes Jahr picke ich mir aus den Nominierungslisten für "Hugo" und "Nebula" ein, zwei thematisch vielversprechend klingende Romane raus – diesmal hab ich endlich den Gewinner erwischt. Und Paolo Bacigalupi, ein junger Autor aus Colorado, hat völlig zu Recht den heurigen "Nebula" abgeräumt. Für den "Hugo" ist er immerhin schon mal nominiert – der September wird zeigen, ob ihm gleich mit seinem Debütroman der Doppelschlag gelingt. Im klaren Stil sowie dem Entwurf eines gewaltigen Panoramas, vor dem glaubwürdige Charaktere agieren, ähnelt "The Windup Girl" den Romanen David Maruseks, mit denen es auch den ungefähren Zeitraum – das späte 22. Jahrhundert – teilt. Außerdem hat auch Bacigalupi seine Welt zuerst in Kurzgeschichten entworfen ("The Calorie Man", "Yellow Card Man"), ehe er sich ans lange Format herantraute. Das Panorama selbst ist jedoch von komplett anderer Art – und wesentlich pessimistischer. Schon nach wenigen Seiten beginnt man zu ahnen, dass das alles selbst im allergünstigsten Fall höchstens auf ein grimmiges Ende hinauslaufen kann.
Schauplatz des Romans ist das Königreich Thailand, einer der wenigen Flecken auf der Welt, die dem europäischen Kolonialismus erfolgreich getrotzt haben. Und auch jetzt hält Thailand an seinem Status als Insel der Autonomie fest, während draußen gleich mehrere Ozeane ansteigen: Einer aus Wasser, Produkt einer klimagewandelten Welt, dem Küstenstädte wie New York oder Mumbai längst zum Opfer gefallen sind. Einer aus Geld, Machtinstrument US-amerikanischer und chinesischer Gentechnik-Konzerne, die die globale Contraction nach dem Ende des Öl-Zeitalters überdauert haben und nun die Globalisierung wieder vorantreiben: Die alte Expansion (so der historische Begriff für unser Zeitalter) erlebt eine Renaissance. Und schließlich ein dritter Ozean aus biologischen Gefahren, ausgebrütet in den Labors ebendieser Konzerne. Bioinvasives Ungeziefer und für den Menschen tödliche Pflanzenkrankheiten wie der blister rust haben die Biosphäre schwerst in Mitleidenschaft gezogen, vor allem aber jede herkömmliche Nahrungsmittelproduktion zum Erliegen gebracht. Es bleibt offen, ob die Gentech-Konzerne, die sogenannten calorie companies, diese Seuchen absichtlich in Umlauf gebracht haben. Klar ist nur, dass diese völlig außer Kontrolle geraten sind. Und dass die calorie companies immer noch ihren Nutzen daraus ziehen. In einer Quarantänezone vor Bangkok lauern die Dependancen von AgriGen, PurCal und Co darauf, dass Thailand in eine Hungersnot abgleitet, um sich mit ihren sterilen Getreidelieferungen einen weiteren Markt zu unterwerfen.
Anderson Lake ist ein Vertreter AgriGens, ein calorie man. Zum Schein betreibt er eine kleine Fabrik in Bangkok, in Wahrheit aber versucht er ein verschwundenes Gentechnik-Genie und – wichtiger noch – jene Samenbank aufzuspüren, die Thailand die Rückzüchtung ausgerotteter Pflanzen wie Tomaten und Tabak ermöglichte und ihm so bislang die Unabhängigkeit garantiert. "Every organism needs a predator", stellt ihm ein Kollege ein nüchternes Charakterzeugnis aus – doch obwohl Lake eigentlich jemand sein sollte, der an den Strippen zieht, wird ihm das Geschehen zunehmend aus den Händen gleiten. – Agieren statt reagieren bis zum Schluss heißt es hingegen für Lakes Assistenten Hock Seng, auch wenn der alte Chinese in allem, was er tut, von den Dämonen der Vergangenheit getrieben wird. Ein paar Jahre zuvor war er noch ein reicher Geschäftsmann in Malaya und entkam nur knapp dem Genozid durch islamische Fundamentalisten. Jetzt lebt er, aus ständiger Furcht paranoid geworden, als yellow card man im thailändischen Exil und versucht sich eine neue Existenz aufzubauen – keine leichte Aufgabe in einem Land, in dem das Umweltministerium für bioinvasive Kreaturen aller Art zuständig ist. Also auch für Flüchtlinge. Im Grunde ein betrügerischer Opportunist, wird Hock Seng durch Bacigalupis menschliche Zeichnung doch irgendwie zum Sympathieträger.
Denn klare Grenzziehungen zwischen richtig und falsch sind hier sowieso weit und breit keine zu finden. Besonders deutlich wird dies am Umweltministerium selbst. Mit seinen heroischen Einsatzkräften – den white shirts – stellte es einst Thailands Rettung vor dem globalen Öko-Kollaps dar. Jetzt ist es von Korruption durchsetzt, die white shirts werden als willkürlich agierende Schlägertruppe verachtet. Nur Jaidee, ein ehemaliger Muay Thai-Kämpfer und als Tiger of Bangkok immer noch Held des Volkes, hält am alten Idealismus fest, wenn er mit seiner Untergebenen Kanya in den Öko-Kampfeinsatz zieht; auch seine Methoden sind aber nicht immer astrein. Damit ist der Boden für ein Machtduell zwischen Umwelt- und Handelsministerium bereitet: Ein nicht von ungefähr allegorisch wirkender Kampf zwischen Trade und Environment, der schließlich in einen Bürgerkrieg mündet. "The Windup Girl" ist im Präsens geschrieben – die schockierend plötzlichen Explosionen von Gewalt und die unübersichtliche Lage, durch die sich die Romanfiguren kämpfen müssen, wirken damit noch unmittelbarer.
Bleibt als letzte Hauptfigur noch das "Windup Girl" selbst: Emiko, ein künstlich gezüchteter Mensch, von seinem japanischen Besitzer bei der Abreise aus Thailand einfach stehen gelassen und hier als seelenloses Geschöpf verabscheut. Um irgendwie zu überleben, muss Emiko sich in einem Sex-Club regelmäßig vergewaltigen lassen – ohne den Schutz eines Patrons würde sie sofort als Biomüll zerschreddert. Wie alle Hauptfiguren hat auch Emiko sehnsüchtig ein Ziel vor Augen. Zwei sogar, und beide entsetzlich unerreichbar: Sie träumt davon, dass irgendein barmherziger Bodhisattva im Himmel die künstlichen New People aus ihrer "falschen" Existenz in den großen Zyklus von Sterben und Wiedergeborenwerden schmuggelt, durch den sich alle "echten" Lebewesen bewegen. Und sie hört ein Gerücht von einem Dorf im Norden, in dem andere ihrer Art leben – ohne Besitzer und damit ohne sich dem genetisch verankerten Gehorsamszwang beugen zu müssen.
"The Windup Girl" ist sowohl menschlich als auch stilistisch beeindruckend. Darüberhinaus entwirft Bacigalupi in unglaublichem Detailreichtum eine Welt, die alleine schon deshalb überzeugt, weil sie auch nach dem Kollaps der ölbasierten Wirtschaft nicht auf einen vormodernen Wissensstand zurückgefallen ist. HighTech/LowEnergy lautet ihr Fundament. Die am häufigsten genutzte Energiequelle beispielsweise sind mikrotechnologisch optimierte Federn, die vor dem Gebrauch per Muskelkraft aufgezogen werden müssen – sei es von gentechnisch auf Übergröße gezüchteten Elefanten, sei es von Menschen. Oberste Devise ist die maximal erzielbare Umsetzung von Kalorien in Joule, ein anderes Maß existiert nicht mehr. Durch den Trick, einen Zyklus von Expansion – Contraction – Expansion einzuführen, lässt Bacigalupi seine Epoche überdies unmittelbar an die Gegenwart anschließen, denn der Gentechnik-Kolonialismus in der Landwirtschaft ist längst angelaufen. Und wenn das entworfene Szenario manchmal auch unsagbar deprimierend wirken mag – irgendeine Resthoffnung gibt es immer; manchmal trägt sie nur ein unerwartetes Gesicht. "The Windup Girl" ist ohne Frage einer der besten Romane des Jahres.
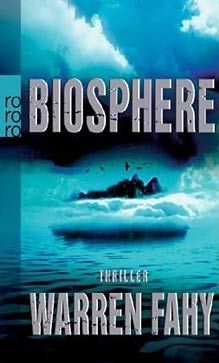
Warren Fahy: "Biosphere"
Broschiert, 495 Seiten, € 10,30, rororo 2010.
Als Autor ist der Kalifornier Warren Fahy bislang ein unbeschriebenes Blatt gewesen; vorausgesetzt man rechnet Werbetexte und Filmrezensionen nicht mit ein. Dafür entwirft er gleichsam rückwirkend die Urknall-Version des Szenarios von der abgelegenen Insel mit einer Fauna und Flora, die längst ausgestorben sein sollten. "King Kong" und "Die vergessene Welt" (Arthur Conan Doyle, nicht Michael Crichton) kleben im Vergleich dazu an der Gegenwart, denn Fahys Insel ist das letzte Überbleibsel eines uralten Superkontinents, neben dem sich Pangäa wie das reinste Neubaugebiet ausnimmt. "Fragment" daher der Originaltitel des 2009 erschienenen Romans, der auf "Deutsch" zu "Biosphere" wurde. Was aber nur die erste von vielen, vielen Mutationen ist, die uns - vor allem aber den Romanfiguren - mit Karacho ins Gesicht springen werden.
Vor dem Lesen könnte es sich anbieten einen Gurt anzulegen - Tempo ist angesagt. Das gilt für den aberwitzigen Lebenszyklus der Inseltiere - eine Wissenschafterin fasst den Takt von Fressen, Vermehren und Gefressenwerden einmal als Krieg im Kreißsaal zusammen - und ebenso für die panische (und meist vergebliche) Flucht der armen WissenschafterInnen, die auf der Insel gelandet sind. Genau genommen beginnt es aber schon früher, nämlich bei der Vorstellung der ProtagonistInnen. Im Schnelltakt werden die TeilnehmerInnen der Doku-Soap SeaLife nach folgendem Schema vorgestellt: Körper - Augen - Haare - Bekleidung ... plus ein paar Anmerkungen zum Charakter. Das könnte die Oberflächlichkeit einer auf Generierung von TV-Bildern bedachten "Forschungsexpedition" illustrieren ... oder es ist die seltsame Idee eines Autors, der seinen ersten Roman schreibt und so etwas für notwendig hält. Auf jeden Fall hat es den gleichen Effekt wie eine Cocktail-Party, auf der einem in kurzer Zeit viel zu viele Namen und Gesichter vorgestellt werden, die man sich ohnehin nicht merken kann.
Anders als auf den meisten Parties entsorgt hier aber schon nach kürzester Zeit ein erstes Gemetzel die meisten Figuren - am besten nicht verwirren lassen und gleich auf die Botanikerin Nell Duckworth und den Meeresbiologen Andrew Beasley konzentrieren. Dazu kommen noch zwei, die erst später die Insel betreten werden: Der buchstäblich über Kinderleichen gehende Bestseller-Autor Thatcher Redmond, eine geltungssüchtige Medien-Nutte der Wissenschaft - und sein genaues Gegenteil Geoffrey Binswanger, der zwar auch das Zeug zum Medienstar hätte, auf Popularität aber pfeift.
Da die blutigen Bilder vom ersten Landgang live in alle Welt übertragen werden, zieht sich bald eine Seeblockade der Navy um die Insel zusammen. Schon im ersten Drittel tritt der Roman also in die Phase ein, die keine der im Vormonat vorgestellten Erzählungen der "Monstrous"-Anthologie erreichte: Die militärischen Bemühungen um Aufklärung und schließlich Abwehr einer biologischen Gefahr, eigentlich ein klassischer Bestandteil von Monstergeschichten. Zur Sorge besteht auch aller Grund: Bald zeigen die wissenschaftlichen Analysen, dass jede einzelne der wehrhaften Insel-Spezies das Potenzial hätte, die restliche Biosphäre vollständig zu vernichten, sollte sie erst einmal auf einen der Kontinente eingeschleppt werden. Was gleichzeitig der eigentliche - und gewollte - Gag des Romans ist: In der realen Welt fallen Insel-Biotope mit deprimierender Schnelligkeit der Verbreitung vom Menschen eingeschleppter Spezies zum Opfer - Fahy dachte sich, er dreht den Spieß mal um.
Und Fahy hat seine mörderische Brut nicht nur im Wort beschrieben. Der Roman enthält auch einige Illustrationen von Hendersratten, Spigern und Tellerameisen, da lacht das Herz! Vor allem letztere sind vom biologischen Konzept her so bestechend, dass man sich fragt, warum die Natur noch nicht selbst auf den Gedanken gekommen ist. Überdies sind es keine willkürlich zusammengewürfelten Spezies mit möglichst spektakulären Kräften, Fahy hat sich bemüht, eine in sich stimmige alternative Evolutionslinie zu entwerfen. Als Ausgangspunkt wählte er dafür Fangschreckenkrebse, eine Tiergruppe, die den LSD-Träumen von Pulp-Coverzeichnern entsprungen zu sein scheint. (Web-Tipp: Eine Image-Search zum Stichwort "mantis shrimp").
Vorwarnung: Im letzten Drittel gehen Fahy die Gäule durch. Zuvor hielten sich haarsträubende Einfälle und ein erahnbares Gespür für wissenschaftliche Themen (und wie man sie schildert) noch einigermaßen die Waage. Doch die Plot-Wendung, die dann kommt, ist einfach albern - da muss man schon die Humor-Brille aufsetzen, um sich den Roman nicht zu verderben. - Eine unbestreitbare schreiberische Leistung ist es hingegen, wenn ein Autor es schafft, Sympathien oder Antipathien zu wecken, die der eigenen sorgsam gehegten Weltanschauung zuwiderlaufen. Irgendwann zwischen der Szene, in der ein kamerabestückter Mungo von den Inseltieren zerfetzt wird, und dem x-ten Massaker an hilflosen WissenschafterInnen habe ich mich - erklärter Tierschutz-Verfechter, der ich bin - bei dem ungewohnten Gedanken ertappt, dass die ganze ökologisch wertvolle Insel mitsamt ihren widerlichen Mistviechern hoffentlich bald ein schönes langes Vollbad in Napalm nimmt.

Armin Rößler & Heidrun Jänchen (Hrsg.): "Die Audienz"
Broschiert, 214 Seiten, € 12,30, Wurdack 2010.
16 Kurzgeschichten für den 16. Band der Science-Fiction-Reihe des Wurdack-Verlags - die Bandbreite reicht von Besuchen auf anderen Planeten über die Auflösung dessen, was wir als Realität empfinden, bis zu Einblicken in eine ebenso nahe wie düstere Zukunft. Zum Ausgleich werde ich demnächst mal eine Anthologie vorstellen, die sich ausschließlich optimistischer SF widmet - aber erst einmal lesen wir, warum wir besser wie die Drachen Schätze horten sollten als treuherzig auf so etwas wie eine Pension zu warten. - Die für "Die Audienz" versammelten AutorInnen dürften zumindest denen, die gerne Anthologien und Magazine lesen, zum größten Teil bekannt sein; einige davon - etwa Karsten Kruschel oder das HerausgeberInnen-Duo - haben auch bereits einige Romane auf dem Konto.
Schwarzherzigen Spaß bereitet "Finja-Danielas Totenwache" von Nadine Boos, worin die Titelheldin zur Totenwache mit anschließender Wiederauferstehung im Klonkörper lädt. Da versammelt sich nun die in mehr als einem Sinne posthumane Verwandtschaft in Form von upgeloadeten Bewusstseinen und rejuvenierten Mumien und gefällt sich im wechselseitigen Austausch von Gehässigkeiten. So langsam geht die würdevolle Zeremonie dabei den Bach runter und für Finja-Daniela stellt sich die Frage, ob sie überhaupt in dieses Klapperschlangennest wiedergeboren werden will. Was eigentlich nur zwei Schluss-Varianten zulassen sollte, doch Boos' Ende kommt überraschenderweise ... überraschend. - Komik bietet auch "Ein Schiff wird kommen" von Regina Schleheck, die die vermeintlich harmlose ältere Lady Juliet - eine Art interstellare Miss Marple mit einem Koffer voller Sexspielzeug - an Bord eines Kreuzfahrtraumers gehen lässt, der von wiederholten Zeitsprüngen durchgerüttelt wird. Dort wird Juliet einen Realitätsbruch der ganz besonderen Art erleben - keineswegs komisch gemeint hingegen der, unter dem die Titelheldin in Bruna Phlox' "Hör auf die Wahrsagerin, Nishka!" leidet. Sie pendelt zwischen einer armseligen Existenz im Realroom und rasendem Stillstand in der virtuellen Welt. Hat was von in den Cyberspace verlagerter Pop-Literatur: Tempo, Tempo, Tempo, Konsum, Konsum, Konsum - und dahinter gähnt der Abgrund der vollkommenen Einsamkeit.
Schleheck steht in der Anthologie mit ihrer Krimi-Vorliebe übrigens keineswegs alleine da: Ermittelt wird unter anderem auch in Sachen Mord an einem Serienmörder in Kai Riedemanns grimmiger Erzählung "Ich töte dich nach meinem Tod" oder Verschwinden eines jungen Richniks in "Ausgespielt" von Christian Weis - routiniert á la Freitagabend-TV inklusive klassischen Sätzen wie "Ab sofort wird nach meinen Regeln gespielt!". - Andreas Flögel schließlich zeigt in "Lod, Lad, Chine", dass selbst in einer fernen sterilen Zukunft, in der sämtlicher Körperkontakt unterbunden wurde, das Undenkbare geschehen kann: Jemand ist ermordet worden, und der Verdacht fällt auf einen Sex-Roboter. Ausbaufähige Idee.
Eine ökologische Note weisen die extraterrestrischen Erzählungen auf, die sich allesamt um die Konsequenzen drehen, die das Eindringen von Organismen in einen fremden Lebensraum hat. In Heidrun Jänchens "Kamele, Kuckucksuhren und Bienen" rätseln ExobiologInnen auf einem Planeten ohne Tiere über das Vorhandensein von Pflanzen, die eigentlich Tiere zur Vermehrung bräuchten. Armin Rößler schildert eine Ereigniskette, die sich auf dem Waldplaneten Bayo in Gang setzt, als der Pilot eines Löschflugzeugs gegen seinen Willen Passagiere an Bord nehmen muss. - Und dass ein Neuanfang nicht das gleiche sein muss wie ein Happy End, beweist Christian Günther, der es irgendwie geschafft hat sich die Domain Cyberpunk.de zu sichern, in seiner Geschichte "Der geborgte Himmel" über eine aufgegebene Marskolonie. - Die inneren Gebirge auf Orange rüsteten sich, schauderhaft zu werden: Schöner Satz. Denn die beste der vier Geschichten kommt von Karsten Kruschel. "Ende der Jagdsaison auf Orange" handelt von einem Planeten im Besitz eines Familienunternehmens, das ebenso konsequent dessen genetische Ressourcen ausbeutet, wie es auf "Wilderer" Jagd macht. Die Lebensformen auf Orange, die an Land gestiegener Meeresfauna ähneln, machen zahllose Metamorphosen durch - und diese bleiben nicht auf die einheimischen Spezies beschränkt: Wie schon in seinem Roman "Vilm" stellt Kruschel statt wechselseitiger Zerstörung die Synthese in den Mittelpunkt.
Zwei Frauen, eine Dystopie: Vom Ende des Sozialstaats berichten sowohl Andrea Tillmanns ("Hitze") als auch Karla Schmidt ("Lebenslichter"). Tillmanns wirft einen lakonischen Blick in die nicht allzuferne Zukunft Deutschlands - ihre Protagonistin, eine patente Rentnerin, meistert vorerst sämtliche Herausforderungen wie Stromrationierungen, steigende Preise und Mangel an allem; aber der Niedergang schreitet voran. - Schmidt geht von ähnlichen Voraussetzungen aus und würzt ihre Geschichte aus einer verfallenden Welt mit vielen glaubwürdigen Details. Sowohl für die Gesundheitsinspektorin Mara als auch den illegal in Deutschland lebenden jugendlichen Kleinkriminellen Vadim ist tägliches Durchwursteln angesagt. Da fallen ihnen zwei nahezu magische Gegenstände in die Hände: Eine polizeiliche Datenbrille, mit der man sämtliche Informationen über die Menschen, denen man begegnet, abrufen kann - und ein Computer, der selbst die teuersten Waren gratis abbucht. "Lebenslichter" ist eine Art melancholisches Märchen - und Karla Schmidt, die für ihre Erzählung "Weg mit Stella Maris" (hier der Rückblick) den Deutschen Science Fiction Preis erhielt, beweist einmal mehr, dass sie eine glänzende Autorin ist.
Ein letztes Highlight schließlich noch, alleine schon aufgrund der originellen Idee, ist die Geschichte "Auslese" von Jakob Schmidt. Protagonistin Anja gehört zu den Menschen, denen der Besuch eines Fleischengels bevorsteht: Nicht-irdischen Wesen, die sich aus Rissen im Raum auf Menschen mit Krebstumoren stürzen - aus ernüchterndem Grund. In schnörkelloser Weise werden hier philosophische Fragen der kleineren Art aufgeworfen: Zum Beispiel was der Sinn des Lebens (nicht nur des individuellen, sondern des Lebens an sich) ist, und ob man sich seiner Bestimmung fügt oder widersetzt. Anja gibt die Antwort mit ihrer Spattergun.
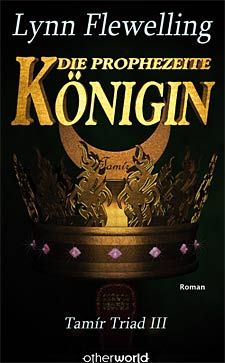
Lynn Flewelling: "Die prophezeite Königin (Tamír Triad III)"
Broschiert, 611 Seiten, € 16,40, Otherworld 2009.
Vorhang auf für den letzten Akt des Königsdramas um Skalas Thronerbin Tamír, die durch den Einsatz experimenteller Magie im Körper eines Jungen "versteckt" wurde, um sie vor der Ermordung durch den Usurpator Erius zu bewahren. Am Ende von Band II (hier der Rückblick) warf Tamír vor aller Augen ihre männliche Hülle im wahrsten Sinne des Wortes ab. Und nicht nur das: Mit ihren Getreuen drängte sie die Invasoren aus dem feindlichen Königreich Plenimar zurück, die von diesen verbreitete Seuche musste damit klarerweise ebenfalls abflauen ... womit die ewige Nemesis Skalas ironischerweise ihren Beitrag zur Erfüllung des Orakelspruchs geleistet hat, dass das Land prosperieren wird, solange eine Frau auf Skalas Thron sitzt (und Lynn Flewelling einmal mehr auf subtile Weise zeigt, dass Prophezeiungen vor allem dadurch wahr werden, dass ihnen kräftig nachgeholfen wird). - Kurz gesagt: Vielleicht zehn Seiten mehr, und Band II hätte in einem Hollywood-mäßigen Happy End aufgehen können.
... wäre Flewelling nicht eine Autorin der realistischen Art, für die Politik stets von beinhartem Kalkül geprägt und Krieg immer etwas Dreckiges - wenn auch manchmal Notwendiges - ist. Da ziehen nicht Helden gegen Finsterlinge in die Schlacht, als in Skala der unvermeidliche Bürgerkrieg heraufzieht. Auch Tamírs Gegenspieler, Erius' Sohn Korin, darf sich mit einigem Recht als Thronfolger fühlen - das macht den Konflikt für keine Seite leichter. Verschlimmert wird dies noch durch die persönlichen Aspekte, denn am Hof des feudalen Skala waren Korin, Tamír (da noch als der Knabe Tobin) und eine Reihe gleichaltriger Knappen Freunde - nun muss jeder aus diesem Kreis selbst entscheiden, welcher Seite seine Loyalität gilt.
Indirekt bezieht Flewelling natürlich dennoch Stellung, und hier kommen die Gender-Aspekte ins Spiel, die die "Tamír Triad" maßgeblich prägen. Korin setzt das System der männlichen Vorherrschaft, das sein Vater mit Gewalt und gegen die Tradition etablieren wollte, fort. Tamír hingegen, die auch nach ihrer "Geschlechtsumwandlung" kein von Kleidern behindertes Leben führen will, versammelt eine wahre Regenbogen-Koalition um sich: Freie Magier, die unter Erius verpönt waren, Angehörige der zurückgedrängten UreinwohnerInnen Skalas, Nicht-Menschen, vor allem aber: Frauen. Auch in Macht- oder Kampfposition. Was in den PC-mäßig aufgerüschten "historischen Romanen" (= Schnulzen) unserer Tage nicht immer überzeugend wirkt, funktioniert in einer fiktiven Welt natürlich problemlos. Im Grunde reicht es schon, eine patriarchalische Einzelgottheit aus dem Spiel zu nehmen, und die Geschichte nimmt einen völlig anderen Verlauf.
Martialische Action steht allerdings nicht im Vordergrund von "Die prophezeite Königin" (im Original "The Oracle's Queen"; 2006), dafür sind noch viel zu viele lose Enden auf persönlicher Ebene übrig geblieben. Der Geist von Tamírs Zwillingsbruder, der bei der Geburt getötet werden musste, um Tamírs magische Verwandlung zu ermöglichen, sinnt nach wie vor auf Rache. Die nachträgliche Erkenntnis, wer von ihren engsten Vertrauten aller in das grausame Ritual involviert war, stellt die junge Königin in spe vor eine schwere Probe. Und natürlich ist auch die Umwandlung vom Jungen zur Frau nicht so schnell zu verdauen: Die meisten Menschen in Tamírs Umfeld stecken den Wechsel recht locker weg, aber die müssen ja auch kaum mehr leisten, als sich an einen neuen Namen und ein anderes Personalpronomen zu gewöhnen. Sehr viel mehr gefordert ist da schon Tamírs Begleiter von Kindesbeinen an, Ki. Erst waren sie Freunde, dann hat sich Tamír - damals noch männlich - in den heterosexuellen Ki verliebt ... und jetzt ist sie eine Frau. Klingt nach einfacher Lösung, aber da muss man sich erst mal dran gewöhnen, und der Standesunterschied zwischen Königin und Knappe türmt gleich die nächste Barriere auf. Das alles zu schildern, ohne in Romanzen-Kitsch abzustrudeln, ist ein schwieriger Seiltanz, und Flewelling meistert ihn im Großen und Ganzen ohne Wackler.
Die "Tamír Triad" ist die richtige Trilogie für Fans von character-driven plots (und ja: "Deep Space Nine" hat mir von allen "Star Trek"-Serien am besten gefallen ...) - weniger für die von epischen Schlachten oder magischer Leistungsschau. Dafür kommen die persönlichen Konflikte mit nahezu Shakespeare'scher Wucht daher. Ohnehin scheinen einige Passagen stark von dessen Dramen inspiriert zu sein: Von der einleitenden "Macbeth"-Szene über das Auftreten eines Sühne verlangenden Geists sowie das Abtreten einer dem Wahnsinn verfallenden Frau á la "Hamlet" bis hin zur erbarmungslosen Machtpolitik der diversen Königsdramen. Mit letzteren teilt die im Rückblick erzählte "Tamír Triad" auch, dass das Ende bekannt ist - jedenfalls was die historische Seite betrifft. Die Spannung erwächst daher nicht aus der Frage, ob Tamír letztlich Königin werden wird, sondern welchen Preis sie dafür zahlen muss.
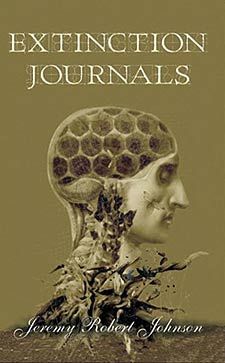
Jeremy Robert Johnson: "Extinction Journals"
Broschiert, 104 Seiten, Eraserhead/Swallowdown Press 2006.
Heißt es nicht immer, dass Kakerlaken die einzigen sind, die einen Atomkrieg sicher überleben werden? Slum-Kid Dean hatte daher die folgerichtige Idee, als die TV-Nachrichten die Phrase vom bevorstehenden Nuklearschlag nicht mehr länger mit einem "vielleicht" versahen: Er hat sich eine ganze Legion der kleinen Krabbler - lebendig und mit den Füßchen voran - an seinen Spezialanzug genäht, einen Sauerstofftank umgeschnallt und ist ins Freie gestakst. Und er hat überlebt - wie's aussieht als Einziger.
Jeremy Robert Johnson, Bizarro-Schreiber aus Portland, Oregon, und Kumpel von "Fightclub"-Autor Chuck Palahniuk, scheint ein ausgesprochenes Faible für nukleare Apokalypsen zu hegen: Nachzulesen in seiner Geschichtensammlung "Angel Dust Apocalypse" aus dem Jahr 2005. Darunter befindet sich auch eine sieben Seiten kurze Erzählung mit dem Titel "The Sharp Dressed Man At the End of the Line", kompakt und in rhythmischer Sprache, sodass man streckenweise fast von einem Gedicht sprechen könnte (man hört beim Lesen förmlich, wie großartig sich der Text für einen Vortrag eignen würde - Bizarro-Lesungen haben stets Event-Charakter). Am Ende dieser Geschichte trifft Dean auf seinen sehr an George W. Bush erinnernden verhassten Präsidenten, der den Krieg ausgelöst hat und nun weinerlich um Vergebung bittet. Dean gewährt ihm die ersehnte Umarmung. Natürlich in seinem Anzug. Die Kakerlaken legen los. - Und darum beginnt "Extinction Journals", das unmittelbar an diese Episode anschließt und in herkömmlicher Prosa geschrieben ist, mit dem Satz: The cockroaches took several hours to eat the President.
Ich werfe nicht so gerne mit großen Wörtern wie "Existenzialismus" herum - aber finde mal jemand eine andere Bezeichnung für das Szenario, wenn Dean einsam unter einem dunklen Himmel durch Asche und brennende Ruinen stapft, angetrieben von the Fear (mit großem F), die nicht näher benannt zu werden braucht. Er ist sich gar nicht mal so sicher, dass er den Atomkrieg überhaupt überlebt hat - sein vorerst bester Gegenbeweis, dass er nicht im Fegefeuer gelandet ist, bleibt, dass er immer noch den Drang zum Pinkeln verspürt. Als ein engelhaftes Wesen in brennendem Streitwagen vom Himmel schwebt, bietet es Dean weder große Eröffnungen noch Erlösung an, sondern fragt ihn nur verwirrt: "Where did everybody go?" Dann labert es noch einige Zeit über die menschliche DNA und die Irrtümer der Weltreligionen, aber Dean verliert schnell das Interesse. Ihm reicht es zu wissen, dass er am Leben ist - und für eine wachsende Zahl von Baby-Kakerlaken, mit denen er in eine empathische Kommunikation eintritt, die Mutterrolle übernommen hat. Sein Motto ist einfach: DO NOT DIE.
You'll laugh, you'll cry, you'll lose your lunch heißt es in einer Lobpreisung auf Johnsons Werke überaus passend. Ekelszenen gehen Hand in Hand mit komischen Momenten, und der Autor lässt es sich auch nicht nehmen, als Extra-Draufgabe die allerabgegriffensten Klischees eines Boy-meets-Girl-Szenarios mitzuverwursten: Er fühlt sich als "Lone Wolf", sie träumt von "white picket fences" ... kitschiger geht's nimmer, und das alles inmitten fresswütiger Insektenkolonien. Geigen und Gore.

Jörg-Uwe Albig: "Berlin Palace"
Gebundene Ausgabe, 240 Seiten, € 20,50, Tropen 2010.
Noch einmal den Fokus auf Asien gerichtet. Und wie sich die Zeiten doch ändern: Zur Hochblüte des Cyberpunk in den frühen 80ern suggerierten einem zahllose AutorInnen, dass die Welt bald unweigerlich in den Händen japanischer Konzerne sein würde (was ist daraus eigentlich geworden?). Im vergangenen Jahrzehnt tauchten dann immer mehr Werke auf, die Chinas wachsendem Drang nach Größe Rechnung trugen. Stand Maureen F. McHugh 1992 mit "China Mountain Zhang" noch eher alleine da, hat mittlerweile sogar Frank Schätzing in seiner zum Roman gewordenen Enzyklopädie "Limit" den Blick auf Chinas boomende Wirtschaft gerichtet. - Sein Landsmann Jörg-Uwe Albig, der vor ein paar Jahren in seinem Roman "Land voller Liebe" die Wende von der DDR in die BRD verlegt hat, surft weiterhin auf unterhaltsame Weise am Rande der Genre-Literatur dahin. In "Berlin Palace" entwirft er ein Szenario der chinesischen Globalhegemonie Anfang der 2030er Jahre.
Was haben wir uns 2008 über die Blumenkästen mokiert, die die chinesische Regierung zu tausenden in Peking aufstellen ließ, um die verpestete Luft der Hauptstadt während der Olympischen Propaganda-Spiele aufzufrischen. "Potemkinsche Dörfer" und so - aber denkste! Historisch betrachtet war das der Startschuss für Chinas endgültigen Aufstieg, wie Albig zu erzählen weiß. Ökonomie und Ökologie haben sich die Hände gereicht und ein hochtechnologisches, von sämtlichen Gestänken befreites Utopia geschaffen: Ältere Menschen müssen immer noch gelegentlich Mittel gegen Lichtallergie schlucken, so unfassbar blau leuchtet der Himmel über dem Reich der Mitte nun - da können nicht mal die LCD-Fassaden der Wolkenkratzer mithalten. Doch wenn die globale Wippe einen nach oben trägt, muss sie den anderen zwangsläufig nach unten befördern: Europa und Nordamerika, dort sind nun die neuen Schwellenländer, die in Sweatshops billige Massenware produzieren. Und in den Schwalbenstädten am Rande der glitzernden Metropolen Chinas drängeln sich die blonden MigrantInnen und verbrauchen das bisschen Geld, das sich beim Fensterputzen und Toilettenwischen verdienen lässt, um mit den Familien daheim zu skypen.
"Berlin Palace" mag von der zeitlichen Einordnung her unter Science Fiction laufen, eher aber könnte man es sich als Mischung aus Pop-Literatur, Alternativweltroman und Satire vorstellen. Albig hat früher Reisereportagen geschrieben, dementsprechend entfaltet sich der Roman als Strudel von Impressionen, die bravourös bis ins Karikaturhafte getrieben werden - man werfe nur einen Blick auf die im Roman servierten Speisen: Von Haifischlippen und Stutenzitzen bis zu Lotos-Eiern und (huch) Wachtel-Geschlinge in Essig. Ähnliches gilt für die fiktive Markenparade in Sachen Kleidung, Mobiliar und angesagte Restaurants. Und wenn sich die ProtagonistInnen auf der Party eines Unternehmers versammeln, der sein Geld mit Gebrauchsgegenständen verdient, die Kunstwerken nachempfunden sind, und der selbst in einem Nachbau von Bruegels "Turmbau zu Babel" residiert, dann erreicht der Satire-Faktor Höhen, die - um im Genre zu bleiben - den Werken von Johanna & Günter Braun oder dem aberwitzigen ersten Teil von Lems "Futurologischem Kongress" nahekommen. Es ist eine total konsum-affirmative Welt, in der sich die Sorgen um die Mukoviszidose des Haus-Kolibris oder die Einladung auf ein Party-U-Boot drehen. Und als Kirsche auf dem grellen, geschmacklosen Cocktail thronen obendrauf noch ein paar antiquarisch gehegte Versatzstücke aus dem Sozialistischen Realismus: Man bewundert das Gemälde eines Wasserkraftwerks oder trällert den alten Schlager "Guten Morgen, schöne Busfahrerin". Ein Traum.
Li Ai ist ein Produkt dieses Systems: Als Absolvent der Filmhochschule durchaus mit Ambitionen versehen (das "Ai" ist der für seine Landsleute aussprechbare Teil von Eisenstein, der Regiegranate aus Russland), verdient er sich seinen Turbotofu mit dem Drehen von Werbeclips. Wie jetzt für das Parfüm "Wald", was seine seit langem schlummernde Germanophilie endlich weckt, Schwarzer Wald und so. Befeuert wird dieses Faible aus einem ererbten "Hänsel und Gretel"-Buch und den hirntoten Erläuterungen einer Uni-Expertin, die das deutsche Wesen mit dem Wissensstand von Tacitus erklärt. Bei solch profunder Kenntnis kann Li Ai schon mal zu einem Bild des Eiffelturms "An solchen Dingern haben sie ihre Hexen verbrannt" einfallen. "Edelweiß"-Karaoke und die brutale Kraft von Liedern wie "O Tannenbaum" tun ein übriges, um seinen Assoziations-Blaster anzuwerfen. - Erst später wird die Realität der Deutschen-Slums den Mythos etwas trüben, wenn der Jungregisseur eine Welt von Jogging-Hosen und Frittenfett betritt - eine Art Berlin-Marzahn, nur ohne all den Glamour ...
Es ist typisch für den schwärmerisch veranlagten Li Ai, dass er die Welt weniger wahrnimmt, als sie als Projektionsfläche für seine Vorstellungen zu gebrauchen. Vom Charakter seiner angebeteten Olympia Liang, an die er sich mit aller Kraft ranwanzt, erfahren wir dementsprechend wenig. Olympia bleibt ebenso ein Idealbild in seinem Kopf, wie es die "Germanen" sind. Was gleichzeitig der rote Faden ist, der sich durch "Berlin Palace" zieht: Albig schrieb formal gesehen einen SF-/Alternativweltroman, der aber als Spiegelbild unserer Welt dient - der exotistische Blick von "Kulturmenschen" auf die "anderen" verläuft diesmal halt andersherum. Und wenn Li Ai beim Anblick von MigrantInnen von ihren Blicken voll Sanftmut und bezwungenem Stolz spricht oder sich gar dazu versteigt, ihnen die schönen Bewegungen von taunassem Hochwild anzudichten, dann ist der "Edle Wilde" nicht mehr fern.
"Berlin Palace" ist sicher kein Roman für HandlungsleserInnen - dafür aber ein vergnüglicher Trip durch ein Konsum-Wunderland voller absurdester Attraktionen, und intelligent obendrein. Macht Spaß!
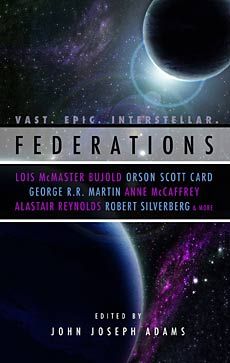
John Joseph Adams (Hrsg.): "Federations"
Broschiert, 384 Seiten, Prime Books 2009.
Manche halten ja schon Science Fiction und Space Opera für synonym, aber hier geht's noch mal eine Schraubenwindung spezieller und wir sind mit dem Thema "Sternenföderationen" auf einer Subsubsubebene der Phantastik angelangt. Ein passendes Lobeswort zur Anthologie kommt von Wil "Wesley Crusher" Wheaton, und eine der 23 hier versammelten Kurzgeschichten gibt sich sogar explizit von der wohl populärsten aller Föderationen beeinflusst - das aber auf eine ausgesprochen originelle Weise. Der hierzulande noch unbekannte Autor Jeremiah Tolbert verschmolz in "The Culture Archivist" die jeweiligen Assimilierungskünste von Sternenföderation und Borg-Kollektiv zu etwas in der Tat Unwiderstehlichem: Das Raumschiff "Jolly Happy Fun Time" der United Planets landet auf einem autonomen Planeten, dessen Mond es über Nacht in seine molekulare Bausubstanz zerlegt hat und nun in Form eines Regens von Wohnmodulen, Porno-Videos und nützlichen Nano-Sets über den verblüfften Einheimischen niedergehen lässt. Der im Titel genannte Culture Archivist Bertie kämpft gegen die Einverleibung in die fröhliche Konformität an - auch wenn er weiß, dass Widerstand auf lange Sicht sinnlos ist. Humor und lockere Sprüche machen die Geschichte trotz ihres grausigen Szenarios zum Vergnügen.
Andere AutorInnen sind im deutschsprachigen Raum wohlbekannt, darunter etwa George R. R. Martin, Kevin Anderson, Robert J. Sawyer oder die Genreveteranen Harry Turtledove (mit der dichtesten Ballung beabsichtigt schlechter Wortspiele seit der ORF-Reihe "Tohuwabohu") und Robert Silverberg, hier mit Stand-alone Stories vertreten. Andere siedeln ihre Geschichten in den Universen an, die sie international etabliert haben. "Aftermaths" beispielsweise ist eine kleine, traurige Episode aus der "Barrayar"-Reihe von Lois McMaster Bujold, die auch auf Deutsch erfolgreich genug war, dass sogar diese frühe Kurzgeschichte aus dem Jahr 1986 schon einmal in einer Übersetzung erschien (als "Schaurige Ernte" in der Sammlung "Der Fensterjesus"). Erwartungsgemäß witzig hingegen "Pardon Our Conquest" von Alan Dean Foster, angesiedelt in dessen "Homanx"-Universum. Hier greift der Admiral eines pompösen kleinen Imperiümchens eine Welt des Commonwealth an ... deren Emissäre zu seiner Verblüffung anstandslos kapitulieren und ihn statt zu kämpfen auf eine Party einladen. Auch Anne McCaffreys Reihe über Raumschiffe mit menschlicher Persönlichkeit ist auf Deutsch erschienen - eines davon, Helva, steht in "The Ship Who Returned" im Mittelpunkt von Ereignissen, die den Geschlechterdualismus auf vielfältigste Weise thematisieren ... und auch ziemlich überstrapazieren. Bekannt ist schließlich auch die "Ender"-Serie von Orson Scott Card - hier ergänzt um die Episode "Mazer in Prison", die sich um einen ehemaligen Kriegshelden dreht, der im relativistischen Flug "geparkt" wird, um ihn für ein in mittlerer Zukunft bevorstehendes Gefecht aufzubewahren.
Diese Geschichten erfüllen die Erwartung, die man an eine solche Anthologie wohl am ehesten stellen würde, sie sind Appetithäppchen im doppelten Sinne: Zum einen (wie jede Kurzgeschichte) in Sachen Stil, zum anderen aber auch, was das entworfene Universum betrifft. Sehr gut gerecht wird dem auch "The Other Side of Jordan" von Allen Steele. Diese Erzählung gehört zu seiner bislang nicht auf Deutsch erschienenen "Coyote"-Reihe. Den Hintergrund bildet ein aus zahlreichen Spezies gebildetes Konglomerat, dem zwar nicht die abgeschnittene Erde, aber dafür der aufstrebende Kolonialplanet Coyote angehört. Ein buntes Völkergemisch und atemberaubende High-Tech machen die "Coyote"-Reihe zur Empfehlung für Fans von Iain Banks oder Larry Niven. - Die meisten Erzählungen in "Federations" aber - der Großteil davon extra für diese Anthologie geschrieben - stehen nur für sich selbst.
Tiefergehende Gedanken zur Infrastruktur ihrer jeweiligen Sternenföderation machen sich überraschend wenige AutorInnen. Mary Rosenblum tut dies in "My She" in hervorragender Weise: Sie wirft aus der Perspektive eines genetisch aufgewerteten Hundes ein Schlaglicht auf eine Gesellschaft, die eine Art telepathische Quantenverschränkung zur interstellaren Kommunikation nutzt. Das Fundament dafür liefert ein religiös verbrämtes System beinharten Missbrauchs. - Ein musisches Concert of Worlds beschwört Yoon Ha Lee in "Swanwatch" herauf - kaum weniger poetisch aber die maschinellen Evolutionsprozesse in "Spirey and the Queen" von Alastair Reynolds, der sich hier in gewohnt technophiler Weise präsentiert. - Außergewöhnlich, wenn auch weit weg vom Thema, "Twilight of the Gods" von John C. Wright, der Abschlussteil einer Trilogie von Kurzgeschichten, die sich ebensosehr auf Wagners wie auf Tolkiens "Ring"-Zyklus bezieht. Geschildert wird, wie die Isolation eines gigantischen Sternenschiffs in seinem Inneren zu technischem Niedergang und zur Bildung von Nationen geführt hat. Unterschiedliche Schwerkraftverhältnisse haben gedrungene "Zwerge" und spindeldürre "Elfen" entstehen lassen - und alle gieren nach dem Ring der Macht, der über das schiffseigene Computersystem gebietet.
Eine Extra-Würdigung gebührt dem bislang noch kaum in Erscheinung getretenen Autor S. L. Gilbow für seine Story "Terra-Exulta", die grauenhafte Ereignisse in zweifach indirekter Weise erzählt und dabei die Macht des Wortes demonstriert. Ein Linguist zieht die geschäftliche Korrespondenz eines Terraformers als Stilprobe heran, um die Verbreitung neugeschaffener Wörter auf galaktischer Ebene zu untersuchen. Da erfährt man zunächst, wie die einheimischen Tiere eines umzuwandelnden Planeten von hübschen trillbrights zu slaggerbugs umgetauft werden, damit ihre Ausrottung nicht durch Sympathien behindert wird. Und das ist nur der Startschuss für einen Öko-Holocaust, der immer weitere und weitere Kreise zieht. Strategisch erschaffene Wörter wie delinction oder ecoviserate, die der Linguist mit wissenschaftlicher Neutralität unter die Lupe nimmt, lassen den Schrecken nur erahnen, der sich schließlich auch auf die Erde selbst zubewegt.
Zum Abschluss noch eine Erzählung, die aufgrund ihrer originellen Perspektive herausragt: Der Kanadier James Alan Gardner schildert in "The One with the Interstellar Group Consciousnesses" den Wunsch einer Sternenföderation, sich mit einer anderen zu vereinigen - doch tut er dies in Form einer romantic comedy of cosmic proportions. Die Spinward Union of Democratic Lifeforms - a regular guy who just happened to cover four hundred cubic parsecs - sehnt sich nach einer geeigneten Partnerin und ist sogar bereit, sich fürs Date ein wenig aufzubrezeln (mit anderen Worten: die Sozialsysteme werden nachgebessert und ein paar lokale Diktatoren entsorgt, um ein attraktiveres Gesamtbild abzugeben), doch jede Kandidatin hat ihre Eigenheiten - Zickenalarm! Warum also in die Ferne schweifen, wenn doch die alte WG-Kumpeline Didge (die Digital Auxilosphere) eh schon im "Haus" ist? - Großartige Geschichte, und nicht nur deswegen lohnt "Federations" den Kauf.

Dirk van den Boom: "Tentakelsturm"
Broschiert, 193 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.
Eine Sternenföderation hätt' ich noch - womit ich gleichzeitig das Ende einer Trilogie nachtrage, die 2007 begann. Irdische Sphäre nennt sich Dirk van den Booms Variante des Motivs - und seit dem ersten Band ist diese Sphäre eingeschrumpelt wie ein Ballon, dem man die Luft ausgelassen hat. Gerade mal das innere Planetensystem hält die Menschheit noch, der Rest ist dem Ansturm der Tentakel geschimpften pflanzlichen Aliens zum Opfer gefallen. Im letzten Akt des Dramas verlagern sich die Kampfhandlungen nun auf Mutter Erde selbst.
Eine Sternschnuppe zog eine leuchtende Bahn über den Nachthimmel. So lautet der erste Satz des Abschlussbands - und Schöngeister sollten ihn an dieser Stelle vielleicht gleich wieder zuschlagen. Denn man kann es sich an den Tentakeln abzählen: So beschaulich wird's auf den kommenden Seiten nimmer wieder. Kurz zur Erklärung für diejenigen, die die beiden ersten Bände nicht gelesen haben (hier der Rückblick): Die Aliens sind nicht zur Unterwerfung der Menschheit angereist, sie verwenden sie als Dünger. (Angehende) Leichen tragen die Sporen aus, aus denen die Krieger der Tentakel schlüpfen - Angehörige höhergestellter Kasten pflanzt man als Setzlinge ins lebende Gehirn: Blumentöpfe nennen die Menschen die Unglücklichen, die ihre paar restlichen Tage ohne Schädeldecke fristen müssen. - Soviel also zum Thema Beschaulichkeit ... lange hat sie ohnedies nicht angehalten: Schon ein paar Sätze weiter erweist sich obige Sternschnuppe als abgeschossenes Tentakel-Schiff. Wenigstens der Wunsch ist den Erdstreitkräften erfüllt worden.
An verschiedenen Fronten der letzten großen Abwehrschlacht sind noch einmal die Hauptfiguren der beiden bisherigen Bände im Einsatz. Capitaine Jonathan Haark muss den von Feindschiffen umwimmelten Jupiter erreichen, um Dr. DeBurenberg, das leicht derangierte Genie, in einer Forschungsstation abzusetzen - die Hoffnung auf eine "Wunderwaffe" lebt noch. Und Ex-Soldatin Rahel Tooma, einst aus persönlichen Gründen aus dem Militärdienst ausgeschieden, dann aber zur Retterin tausender Flüchtlinge avanciert und postwendend wieder einberufen, erhält ein neues Kommando nahe dem Hauptquartier der Erdstreitkräfte in der Sahara. Erst einmal hat sie aber mit den Folgeerscheinungen des massiven Pharmazeutika-Gebrauchs zu kämpfen, mit dem sie sich durch die zurückliegenden Schlachten gepusht hat. - Als neue Hauptfigur, gleichsam stellvertretend für die gesamte kämpfende Erdbevölkerung, kommt Leon Shiver hinzu, ein unauffälliger, schmerbäuchiger Kaufhaus-Sicherheitsmann irgendwo in Europa. Nicht mehr allzuweit von der Rente entfernt, wird er nun ebenfalls unter Waffen gestellt - so wie praktisch alle, die noch irgendeine Gliedmaße bewegen können. Irgendwie berührend die Szene, in der Leon von seiner Frau ein letztes Stück Tiefkühllasagne angeboten bekommt, während beide mit Helm und Schusswaffen in der Küche stehen und am Fenster mitansehen, wie ein Tentakel-Raumschiff auf ihre Heimatstadt stürzt. Ein letzter Hauch von normalem Eheleben ... dann ziehen beide in den Häuserkampf.
Es ist ein dreckiger Krieg, und van den Boom erzählt ihn lapidar und kompromisslos - das gilt auch für die klare Abgrenzung gegenüber dem Feind. Anders als in Teil 2 kommen diesmal die Aliens nicht mehr zu Wort (so ganz überzeugend war das ohnehin nicht) und präsentieren sich statt dessen als anonymer Angreifer, der hauptsächlich auf Masse und sein biologisches Waffenarsenal setzt. Nicht zu knapp erinnern die Tentakel in ihren verschiedenen Erscheinungsformen an die Bugs aus "Starship Troopers".
Im Abwehrkampf feuern nicht nur die Romanfiguren, sondern auch der Autor buchstäblich aus allen Rohren - Wörter wie Dodge Annihilator Megatruck grenzen fast schon an Poesie. Was van den Booms Variante von Military Science Fiction von beispielsweise der eines David Weber unterscheidet, ist aber etwas anderes: Hurrapatriotismus ist hier nicht angesagt. Stattdessen zieht sich ein tiefer Bruch zwischen der Bevölkerung und den Instanzen, die sie nominell beschützen. Und das gilt - keine Selbstverständlichkeit im Genre - sowohl für die Politik als auch das Militär. Rahel und Jonathan haben beide ihre Erfahrungen mit Machtmissbrauch in der Armee gemacht - ihr daraus resultierendes Misstrauen haben sie für immer verinnerlicht und nur für den Überlebenskampf vorübergehend zur Seite geschoben. Und auch die Verzweiflungsmaßnahme des Erddirektorats, die gesamte Bevölkerung unter Waffen zu stellen, führt nicht automatisch zum allgemeinen "Schulterschluss" (ein Top-Anwärter für das scheußlichste Wort aller Zeiten), sondern zum Zusammenbruch der zivilen Ordnung. Nicht grundlos machen sich die ProtagonistInnen Gedanken, was aus der Erde werden wird ... im unwahrscheinlichen Falle, dass sie die Invasion übersteht. - Fazit: Bester Band und somit gelungener Abschluss der "Tentakelkrieg"-Trilogie.
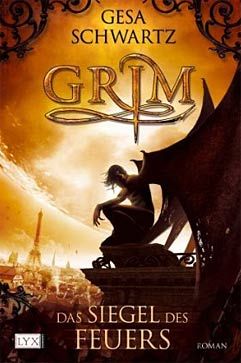
Gesa Schwartz: "Grim. Das Siegel des Feuers"
Gebundene Ausgabe, 677 Seiten, € 20,60, Lyx 2010.
Betritt eine neue Autorin die Bühne, sei es ihr von Herzen vergönnt, sich erst einmal ein wenig Platz um die Ellenbogen zu verschaffen. Vor allem wenn es in Form einer netten kleinen Stichelei passiert wie hier gleich zu Beginn, wo Titelheld Grim sich über den öden Dauerkonflikt von Werwölfen und Vampiren lustig macht, der niemanden mehr hinterm Ofen hervorlockte. Dafür danke, Frau Schwartz - und schön wenn's so wäre! Die überquellenden Romantasy-Stände in den Buchhandlungen sprechen allerdings eine andere Sprache. Und Hand aufs Herz: Sooo groß ist der Unterschied dann auch wieder nicht, wenn es zur klassischen Plot-Konstellation junge-Frau-trifft-attraktiven-aber-nicht-im-herkömmlichen-Sinne-lebendigen-Mann kommt. Seien es nun Zecken, Werwölfe, gefallene Engel oder un-, aber nicht hirntote Zombies. Oder eben wie hier steinerne Wasserspeier vulgo Gargoyles.
"Grim", der Debütroman der deutschen Autorin Gesa Schwartz, ist davon geprägt, dass jede Menge hineingepackt wurde - streckenweise auch mehr, als gut für ihn ist. Gehen wir's mal der Reihe nach durch: Da wäre zunächst die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren. Grim ist ein Gargoyle in geflügelter Menschengestalt - angesichts der möglichen Formenfülle (er ist unter anderem eng mit einer steinernen Ziege befreundet) ist das für eine eventuelle Romanze natürlich von Vorteil. Sein Gegenpol ist Mia, ein 17-jähriges Grufti-Mädchen aus Paris, das als Seherin des Möglichen Gargoyles und andere nicht-menschliche Wesen wahrnehmen kann - anders als der Rest ihrer Artgenossen, die der alte Zauber des Vergessens daran hindert: Die große Verschwörungstheorie der Urban Fantasy ist auch hier in Kraft, aber anders würd's auch nicht funktionieren. Mias Charakterisierung - sie fühlt eine Mauer zwischen sich und der Welt - ist mäßig originell und vor allem mäßig originell ausgedrückt. Generell gehen der Autorin dann, wenn's gefühlig wird, die eigenständigen Worte aus - siehe etwa die zentrale Botschaft des Romans: Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben, ganz gleich, was geschieht, sind etwas ganz Besonderes - sie sind das Licht in der Dunkelheit. Deutlich besser gelingt Schwartz die Charakterisierung des bärbeißigen Grim, der sein heimliches Faible für Menschen hinter vielfach geäußerter Misanthropie verbirgt. Zugleich ermöglicht ihm seine selbstgewählte Distanziertheit einen scharfen Blick auf gesellschaftliche Veränderungen und Missstände.
Womit wir beim zweiten Handlungselement wären: In der magischen Parallelwelt, in der Grim und viele andere mythologische Wesen leben, tut sich Umwälzendes. So richtig sympathisch war das politische System dort schon lange nicht mehr, wie Grim weiß. Doch als die Hybriden - Mischlinge von Menschen und Gargoyles - nach der Macht greifen, wandelt sich das System vom latent faschistoiden zum totalitären. Das eigentlich sehr verständliche Aufbegehren der seit Jahrhunderten versklavten oder gleich abgeschlachteten Hybriden wird als schwarzmagischer Rachetrip geschildert, dem sich Grim und Mia entgegenstemmen müssen - da kratzt die Autorin aber im letzten Moment noch die Kurve.
Und dazu kommen dann jede Menge modernistische oder auch humorige Einsprengsel, die die Handlung immer wieder auflockern. Grim lebt in einer Gargoyle-WG, mokiert sich anlässlich der Einlasskontrollen in die unterirdische Stadt Groghonia über den "gläsernen Gargoyle" oder macht sich über seinen Pomp-versessenen Vorgesetzten Mourier lustig: Ein steinerner Löwe mit Sternchen und Gala-Schleifen in der Mähne - für Grim sieht er aus wie eine Sissi-Parodie. - Keine gute Idee war es hingegen, in für die Handlung vollkommen unerheblichen Nebensätzen "Erklärungen" für Atlantis, Nessie, die Moai-Statuen der Osterinseln oder den Untergang der Maya mitreinzupacken. Ist wohl zur historischen Untermauerung der "Grim"-Mythologie gedacht, wirkt aber unfreiwillig komisch.
In Erinnerung bleiben einige wirklich schöne Bilder: Etwa das in einer gigantischen Höhle unter Paris gelegene Groghonia, das man sich als eine Art magisches Metropolis mit beeindruckendem Luftverkehr vorstellen kann. Oder eine höllische Version des Römer Petersplatzes und eine fliegende Karawane von Gargoyles, die aus dem politisch umgekrempelten Groghonia geflüchtet sind. Und vor allem der unheimliche Kartenmann, der in einem Menschenschlachthaus residiert und aus Körperteilen wahrsagt. Das lässt ganz generell eine Tendenz erkennen: Je mehr sich Schwartz von Vorgefertigtem löst und Eigenständiges schafft, desto besser wird sie auch.
... womit wir auch bei einem Kernproblem der gegenwärtig den Markt dominierenden Mainstream-Fantasy wären: Warum so viele AutorInnen auf lexikalisierte "Völker" zurückgreifen, statt sich schreiberisch freizuspielen, werde ich nie begreifen. All diese Völker und Wesen haben ihren kulturgeschichtlichen Hintergrund - ständig läuft man als AutorIn also Gefahr, inkompatible Mythologien zusammenzupappen - hier beispielsweise kostet es einige Anstrengung, sich ein vergangenes Goldenes Zeitalter vorzustellen, in dem Menschen und Wasserspeier harmonisch zusammenlebten. Außerdem schränkt es einfach zu sehr ein. Das ist ungefähr so, als müsste sich jede Space Opera, egal von wem geschrieben, bei Romulanern, Wookies und Kzinti bedienen ... obwohl na gut, mehr Wookies wären cool.
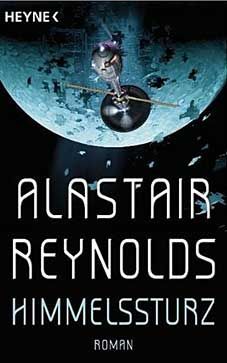
Alastair Reynolds: "Himmelssturz"
Broschiert, 784 Seiten, € 10,30, Heyne 2010.
Das nenne ich buchhandlungstauglich: Eine gute und großdimensionierte Plot-Idee (hier: ein ganzer Mond geht stiften), die im Klappentext angerissen werden kann, und dazu ein Eröffnungssatz, bei dem man unwillkürlich grinsen muss: Ihr Name war Chromis Anemone Laubenvogel, und sie hatte einen weiten Weg zurückgelegt, um ihr Anliegen vorzutragen. – Damit bin ich schon gewonnen; ähnlich wie durch eine gute erste Einstellung eines Films. Wie sich zeigen wird, ist Frau Laubenvogel – nicht die Hauptfigur des Romans – auf recht originelle Weise temporal nicht so leicht ver-"ort"-bar. Im Prolog lernen wir sie jedenfalls als Provinzpolitikerin eines in der ferneren Zukunft liegenden mittelgroßen Sternenreichs kennen, das sein 10.000-Jahresjubiläum feiern will. Sollte man zu diesem Anlass eine Dysonsphäre bauen oder doch lieber einen Springbrunnen? Auf jeden Fall legt die Laubenvogel Wert darauf, die mythische Wohltäterin der Vergangenheit zu ehren ...
... und damit springt der Roman auf die eigentliche Handlungsebene um. Wir schreiben das Jahr 2057 und mit seiner 145 Mann (und Frau) starken Besatzung ist das Raumschiff "Rockhopper" der Vereinten Wirtschaftseinheiten im Sonnensystem unterwegs, um Kometen zu sammeln und zwecks Rohstoffgewinnung in Erdnähe zu befördern. "Wir schieben Eis" lautet das Credo der Besatzung – "Pushing Ice" ist auch der Originaltitel des Romans, der 2007 ins Deutsche übersetzt und nun auch als Taschenbuch veröffentlicht wurde. Noch ahnt niemand, dass sich diese lakonische Selbstmotivation zu einem interstellaren "Tschaka!" auswachsen wird, das die Äonen überdauert. – Aber ich will nicht vorgreifen: Für die Crew der "Rockhopper" gehen die Wochen der Routinearbeit schlagartig zu Ende, als sich der Mond Janus erst aus seinem Orbit um den Saturn und dann aus der Ekliptik des Sonnensystems löst, um auf den 260 Lichtjahre entfernten Stern Spica Kurs zu nehmen. Nur die "Rockhopper" fliegt auf einer Bahn, die sie dem Mond – offenbar in Wahrheit ein 190 Kilometer großes Raumschiff unbekannter Herkunft – eine Zeitlang folgen lassen kann, um Daten zur Erde zu senden. Nicht alle Eisschieber sind mit dieser neuen Mission einverstanden: Aus der bordinternen Abstimmung entspringt eine Konfliktlinie, die die gesamte weitere Handlung prägen wird.
Der Besuch beim außerirdischen Riesending ist ein Arthur C. Clarke-Topos, dass es klassischer nicht mehr geht. Freunde des Sense of Wonder werden sich aber zunächst noch gedulden müssen. Zwar erspäht man im Zielgebiet des mobilen Mondes eine künstliche Konstruktion, die offenbar mehrere Lichtminuten groß ist – das war es in Teil 1 des Romans aber auch schon. Im Mittelpunkt steht hier der routiniert beschriebene Bordalltag. Erst schlägt man sich noch mit eher kuriosen "Problemen" herum: Etwa wie man sich für die tägliche Pressekonferenz mit CNN zurechtmodelt (die Besatzung der ISS kann ein Lied davon singen, wie es ist, ständig "Medienereignisse" kreieren zu müssen ...) oder ob das Pinguin-Logo auf der Außenhülle der "Rockhopper" auf Aliens aggressiv wirken könnte. Später mit ernsteren wie Unfällen und dem Verdacht, von den eigenen Auftraggebern hintergangen worden zu sein. Die Lagerbildung an Bord verschärft sich – die eine Seite von Kommandantin Bella Lind angeführt, die andere von deren leitender Mitarbeiterin und bester Freundin Svetlana Barseghian. Sie mahnt vergeblich zur Umkehr – bis es schließlich zu spät ist und die "Rockhopper" an den immer weiter beschleunigenden Janus gebunden bleibt. Svetlana wird Bella niemals verzeihen, ihre Warnungen missachtet zu haben – und nie ist im Dilatationsflug eine sehr lange Zeit.
"Himmelssturz" ist das Zeit und Raum hinter sich lassende Duell zweier Frauen, die einander ähnlicher sind, als ihnen lieb ist. Beide bleiben im festen Glauben das Richtige zu tun konsequent bis zur Kompromisslosigkeit, beide treffen unpopuläre Entscheidungen und müssen mit deren Folgen leben. Ihre Spiegelbildlichkeit tritt umso deutlicher hervor, wenn das Pendel der Macht in Teil 2 von Bella auf Svetlana umschwingt. Nun geht es darum, eine überlebensfähige Kleinkolonie auf dem Janus einzurichten. Wie Parasiten werden die Menschen dann zwischen den gebirgshohen Maschinen des Mondes herumkriechen und Ideen wälzen, wie sie aus deren unerschütterlichen Bewegungsabläufen auf irgendeine Weise Energie gewinnen könnten. Ihre Reise ist damit aber noch lange nicht zu Ende – ebensowenig ist es die Feindschaft zwischen den Hauptfiguren. – Und wer sich zu diesem Zeitpunkt noch an das Vorwort erinnert, dem wird sich inzwischen auch langsam die Frage aufgedrängt haben, wer nun eigentlich die mythische Wohltäterin der zukünftigen Vergangenheit ist.
"Himmelssturz" ist ein wenig länger als seine Handlung, und zieht man die Höhepunkte des "Revelation Space"-Zyklus oder auch "Das Haus der Sonnen" zum Vergleich heran, dann handelt es sich sicher nicht um denjenigen von Alastair Reynolds' Romanen mit dem größten Wow!-Faktor. Zumindest in Teil 2 und 3 bietet er aber das, was man sich von ihm erhofft. Reynolds ist einfach ein Autor, der nur in großen Räumen leben kann.
In der nächsten Rundschau wird möglicherweise die Zeitmaschine (ja, genau die) angeworfen. Und sollte sich das mit dem Erscheinungsdatum nicht mehr ausgehen, dann besuchen wir eben eine Stadt, die auf Schienen durch die Gegend rumpelt. Hauptsache in Bewegung bleiben! (Josefson)