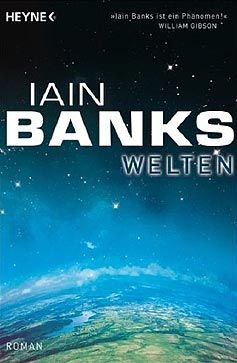
Iain Banks: "Welten"
Broschiert, 558 Seiten, € 15,50, Heyne 2010.
Als eine Explosion, die sich nicht zerstreut, verlangsamt oder Energie verliert, sondern genau im Gegenteil immer weiter und mit wachsender Kraft, Intensität, Komplexität und Reichweite aus sich hervorbricht, verbildlicht Star-Autor Iain Banks die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik in seinem jüngsten Roman. "Welten" (im Original unter dem Titel "Transition" 2009 erschienen) gehört nicht zum beliebten "Kultur"-Zyklus des Schotten. Zwar ist es gut möglich, dass sich unter den buchstäblich unzählbaren Parallelwelten, die sich in diesem ins Endlose fortgesetzten Urknall laufend auseinanderfalten, auch solche befinden, in denen die Kultur vertreten ist. Doch hat es einen guten Grund, warum in "Welten" die Menschheit unter sich bleibt, wie spätestens im furiosen Finale des Romans klar wird.
Manche verzagen beim Lesen recht schnell, wenn ihnen die Handlung nicht ausreichend überschaubar vorkommt. Die seien gleich vorneweg ermutigt: "Welten" ist nicht nur durch Banks' diesmal extra-munteren Stil sehr flüssig zu lesen, es zeichnet sich auch bald eine gemeinsame Richtung ab, in die die einzelnen Handlungsfäden laufen werden (auch wenn sie sich noch lange nicht verknüpfen). - Auf den ersten Seiten mag das noch nicht so aussehen: Da folgen in schnellem Wechsel vermeintlich zusammenhanglose Passagen von einem Attentatsversuch in einem Zug bis zu den Bemühungen eines Autors, seine Drehbuch-Idee für einen Alien-Film an den Mann zu bringen. Es erzählen verschiedene Personen jeweils aus der Ich-Perspektive - und einer davon schildert gleich zu Beginn seine Ermordung. Überdies werfen schon die ersten Kapitel die Frage auf, ob es sich bei den einzelnen Erzählern um völlig getrennte Personen handelt, um Versionen einer Meta-Person in verschiedenen Parallelwelten oder auch - der Roman wird nämlich nicht immer chronologisch erzählt - um dieselbe Person in verschiedenen Zeitabschnitten. Aber schließlich surfen wir ja auch mit Banks durchs Multiversum: Zeit, Ort. Notwendig wohl, wenn auch unzureichend unter den Umständen.
Die Nahtstelle der unterschiedlichen Welten liegt auf einer Version der Erde namens Calbefraques. Dort hat man die Möglichkeit entwickelt, mithilfe einer Septus genannten Droge parallele Welten zu bereisen. Das Bewusstsein des Reisenden wechselt in den Körper einer ausreichend ähnlichen Person auf der zu besuchenden Welt; der eigene Körper bleibt indessen auf einem nur noch instinktgesteuerten Niveau auf Calbefraques zurück. Ein ganzes Konglomerat von Institutionen - die Universität für Praktische Talente, das Transitionsamt und vor allem der Konzern - regelt das Weltenwechseln ... für Banks zugleich die Möglichkeit, ein paar satirische Seitenhiebe auf die Verselbstständigungstendenzen bürokratischer Einrichtungen anzubringen.
Und zwei der Ich-Erzähler sind bzw. waren auch im Auftrag dieser Instanzen unterwegs: Erstens der unter vielen Namen auftretende "Weltenwechsler" Temudschin Oh, der die üblichen Ausbildungsschritte seiner Zunft durchlaufen hat und unversehens in den blutigen Richtungskampf zweier rivalisierender Fraktionen gerät. Für welche Seite er sich entscheidet, wird den Hauptstrang der Erzählung abgeben. Und zweitens "Patient 8262", der einst für den Konzern gearbeitet hat. Um sich dessen Zugriff zu entziehen, hat er sich in eine psychiatrische Klinik auf irgendeiner Erd-Version geflüchtet. Seine Situation könnte kaum surrealer sein: Er erinnert sich an seine Vergangenheit als Auftragskiller und findet ein diebisches Vergnügen darin, seiner Umgebung den Geisteskranken vorzuspielen ... muss aber zugleich alle Demütigungen über sich ergehen lassen, die einem Klinikinsassen so widerfahren können. Die Schere zwischen Alles-Durchschauen und Total-Ausgeliefertsein lässt ihn darüber philosophieren, dass er auf ein Solipsismus-Level zurückgeworfen ist wie ein Baby. (Und im Hintergrund reibt sich Banks vergnügt die Hände, weil damit auch die Möglichkeit offensteht, dass all die erinnerten Welten vielleicht reine Einbildung sind.)
Die anderen zwei Ich-Erzähler agieren innerhalb ihrer jeweiligen Welten. Der "Philosoph" ist professioneller Folterer; dass er seine Arbeit im Tonfall eines Fremdenführers vorträgt, wirkt sogar noch gruseliger als der Humor, mit dem Patient 8262 seine Auftragsmorde schildert. Nicht nur Sex, sondern auch Gewalt ist in "Welten" reichlich vertreten - "Menschenfreundlichkeit hat eben immer etwas Fades an sich" - und den zuvor erwähnten munteren Erzählton und die Esprit-geladenen Dialoge nutzt Banks ganz gezielt, um einem zwischendurch immer wieder mal was Meinungsmäßiges reinzuwürgen. Am klarsten wird dies anhand der vierten Hauptfigur, Adrian Cubbish. Aus dem Norden Englands kommend, schlägt er sich in London zunächst als Koks-Dealer durch, baut damit Kontakte zu den besseren Kreisen auf und wird schließlich zum Börsenhai. Hinter jedem seiner Worte und jeder seiner Taten steckt Berechnung - Adrian wird zur Personifizierung des von der Realwirtschaft losgelösten Booms der 80er und 90er und schließlich des beliebtesten Feindbilds unserer Tage, des Hedgefonds-Unwesens. Im Schimpfen über das grundlegende Übel von Aktiengesellschaften wechselt Banks so deutlich wie nie vom Romancier zum Kommentator - bezeichnenderweise kategorisieren die professionellen Weltenwechsler Adrians Welt - aller Wahrscheinlichkeit nach die unsere - als eine der Gierwelten.
Der schleichende Niedergang der Demokratie zieht sich ebenfalls als Leitmotiv durch den Roman. Der Zentralrat des Weltenwechsler-Konzerns ist immer stärker unter die Kontrolle der machtlüsternen Madame d'Ortolan geraten - ihrer großen Gegenspielerin Mrs Mulverhill, die nicht mehr an die philanthropischen Ziele des Konzerns glaubt (sie spricht gallig von Nettigkeitsvollstreckung), bleibt nur der Partisanenkampf aus dem Abseits. - Und der "Philosoph" foltert auf der Suche nach Hintermännern Terroristen, wie wir das nur allzugut kennen - auch wenn es hier Christen sind; die Märtyreraspekte, die deren Religion eingebaut seien, prädestinierten sie bekanntlich zu Attentätern, dreht Banks vergnügt geläufige Stereotype um. Dass der "Philosoph" eine von häuslicher Gewalt geprägte Herkunftsgeschichte hat, die sich in seinem späteren Beruf widerspiegelt, riecht zwar etwas nach Wald-und-Wiesen-Psychologie. Aber dann kommt wieder so ein kleiner Nebensatz, der unwillkürlich für Gänsehaut sorgt: Sie wollten bei der Truppe keine Leute, die etwas wie ich getan hatten, damals zumindest noch nicht ...
Wenn man schon zwischen beliebig vielen Realitäten wechseln kann, dann impliziert das letztlich auch die Suche nach einer besseren Welt. Das machen die Kommentare, die Banks aus dem Munde seiner Figuren äußert, ebenso klar wie eine Passage, in der die 90er Jahre rückblickend als "Goldenes Zeitalter" verklärt werden. Die Menschen in Ruanda und Ex-Jugoslawien mögen da andere Erinnerungen hegen, aber zugegeben: Die Zeiger der Doomsday Clock (klingt nach Science Fiction, gehört aber zu unserer Welt) standen nie davor und nie danach so weit von Zwölf entfernt wie in den frühen 90ern. - "Welten" bzw. "Transition" ist auch über die Grenzen der Genre-Literatur hinaus wahrgenommen worden und hat die Kritiken stark polarisiert. Mir persönlich war es ein großes Vergnügen.
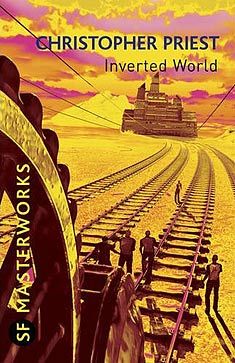
Christopher Priest: "Inverted World"
Broschiert, 304 Seiten, Gollancz 2010.
Man kann es nur als folgerichtig bezeichnen, dass Christopher Nolan den Roman "The Prestige" seines Landsmanns und Namensvetters Priest verfilmt hat. Denn sowohl der Regisseur ("Memento", "Batman Begins") als auch der Autor hegen eine deutliche Vorliebe für überraschende Wendungen und wechselnde Perspektiven. "The Prestige", die Geschichte über das Duell zweier Bühnenmagier, wurde 1995 geschrieben und zu einem der größten Erfolge Christopher Priests. Sein mit Twists auch nicht gerade geizender Science Fiction-Roman "Inverted World" ist ein Frühwerk aus dem Jahr 1974 und zugleich ein preisgekrönter Klassiker. Auf Deutsch zuletzt vor fast 30 Jahren veröffentlicht ("Der steile Horizont", davor "Die Stadt"), gab es auf Englisch zuletzt gleich mehrere Reissues innerhalb kurzer Zeit. Tipp am Rande: Wer den Roman noch nicht kennt und sich diese hübsch aufgemachte Ausgabe aus der Reihe SF Masterworks des Gollancz-Verlags zulegen will, sollte das von Adam Roberts geschriebene Vorwort vielleicht erst nach dem Roman lesen. Es ist zwar nicht dasselbe wie "Bruce Willis ist die ganze Zeit tot!" zu schreien, aber je weniger Vorwissen, desto besser eigentlich.
... immerhin ist der Roman auch so aufgebaut. Er beginnt mit der feierlichen Initiation des jungen Helward Mann in die Future Surveyors, eine der Gilden, die Helwards schlicht Earth genannte Heimatstadt verwalten. Anschließend darf er zum ersten Mal in seinem Leben ihre Mauern verlassen, exakt getimt zum Zeitpunkt eines atemberaubend geschilderten Sonnenaufgangs. Was da aufgeht, hat übrigens nicht die Gestalt unserer Sonne - doch weiß man in der Stadt ja, dass man nicht mehr auf der Welt lebt, nach der die Stadt benannt wurde (wenn auch nicht, wie man hierher kam). Traditionsgemäß muss Helward nun eine gewisse Ausbildungszeit in jeder der Gilden verbringen, ehe er in die von ihm gewählte eintreten darf. Schritt um Schritt wird er so an das wahre Wesen Earths - soweit bekannt - herangeführt. Und immer wieder wird er im Verlauf dieser Zeit mit dem Satz konfrontiert werden, dass er selbst erleben muss, was er gerne von anderen erklärt bekäme.
Den vergleichsweise größten Erzählraum in diesem Abschnitt widmet Priest der Tracks-Gilde - mit gutem Grund. Denn Earths hervorstechendste Besonderheit ist es, dass sich die Stadt von den Ausmaßen eines großen Wohnkomplexes auf einer vermeintlich endlosen Reise befindet: Die Schienen, die hinter ihr abgerissen werden, werden vorne wieder angestückelt. Über eine öde Welt hinweg rumpelt die Stadt beständig einem ominösen optimum hinterher, hinter das sie nicht mehr als ein paar Meilen zurückfallen darf, um nicht vernichtet zu werden. Von Anfang an fallen - nicht Helward, aber dem Leser - zahlreiche Widersprüche auf. Die altertümliche Fortbewegungsweise, die wie ein trauriges Echo der klassischen Science Fiction-Visionen von mobilen Städten anmutet, passt dazu, dass die Stadt zum größten Teil aus Holz gebaut ist, dass ihre Wächter mit Armbrüsten bewaffnet sind und auf Pferden reiten. Nicht aber dazu, dass ein Reaktor sie mit Elektrizität versorgt und synthetische Nahrung hergestellt wird - ganz zu schweigen von Makrostrukturen wie der fremdartigen Sonne und der Welt selbst, über die sich die Stadt dahinwälzt.
Aber auch Helward selbst beginnt schon früh Seltsames aufzufallen. Dass das Lebensalter der StadtbewohnerInnen nicht in Jahren, sondern in Meilen angegeben wird, scheint zunächst nur ihrer mobilen Lebensweise geschuldet zu sein. Aber schon auf den ersten Seiten wird angedeutet, dass down past (also hinter der Stadt) und up future (auf ihrem Weg voraus) mehr sind als bloße Richtungsangaben, dass Zeit und Raum hier in einem anderen Zusammenhang stehen als auf der aus dem Schulunterricht noch gut bekannten Erde. Helward wird dies in der drastischstmöglichen Weise vor Augen geführt, als er einige Dorffrauen, die die Stadt für einige Zeit zur Auffrischung ihres Gen-Pools zwangsverpflichtet hat, in ihre Heimatsiedlung zurückbringen soll. Auf dem langen Marsch down past verzerren sich die Proportionen seiner Begleiterinnen und der Landschaft um Helward herum auf bizarre Weise - bis er schließlich mit den Augen über die Wolken ragt und dazu noch gegen eine Zugkraft ankämpfen muss, die ihn aus der Welt zu reißen droht. Und damit sind wir immer noch weit vom eigentlichen Twist entfernt.
Auf den ersten Blick scheint es sich bei der Stadt um eine einzige großartige Metapher zu handeln. Ihre niemals enden dürfende Bewegung wird von Arbeitern und wenigen Wissenden ebenso mühevoll wie unsichtbar vorangetrieben, während der Großteil der nach außen abgeschotteten Bevölkerung diese nicht einmal zur Kenntnis nimmt. Natürliche Hindernisse werden überbrückt, die Ressourcen der Umgebung - was nicht zuletzt heißt: die in der Öde hausenden Menschen - werden gezielt ausgeforscht und herangezogen. Auf Verhandlungsbasis zwar, aber stets aus der Position des technologisch Überlegenen heraus. Einmal philosophieren die Romanfiguren sogar explizit darüber, dass sich ihre Lebensweise gar nicht so sehr von dem unterscheidet, was sie in der Schule über die ausbeuterisch veranlagten Fortschrittsgesellschaften der alten Erde gelernt haben. - Aber so simpel belässt Priest es nicht: Viel stärker wird es um Fragen der Perspektive gehen, um das Festhalten an alten Sichtweisen und die Verweigerung einer anderen Wahrnehmung, solange es nur irgendwie geht - und eventuell auch darüberhinaus. Sei es das Verharren der Gilden in Traditionen, sei es die Herausforderung, der sich Helward persönlich stellen muss. Unvergleichlich auf den Punkt gebracht in einer Passage, in der er sich am "Rand der Welt" buchstäblich festkrallt - doch das ist wie gesagt noch lange nicht das Ende.
Sehr beeindruckendes Buch. Aus dem Twist ergeben sich zwar auch einige kleinere Logikfehler (die sogar angesprochen, wenn auch nicht aufgelöst werden). Doch verblassen diese angesichts der Grundidee und der Vielzahl an Sichtweisen, die sie ermöglicht. Klare Kaufempfehlung!

r.evolver: "The Nazi Island Mystery"
Broschiert, 140 Seiten, € 8,90, Evolver Books 2010.
Knackiger Arsch, wenn auch ein bisschen groß; feste Titten, wenn auch ein bisschen klein; große Brustwarzen, wenn auch ein bisschen unempfindlich - so beschreibt sich Kay Blanchard selbst, ihres Zeichens Spezialagentin des britischen MI6. Der Wiener Autor Robert Draxler alias r.evolver huldigt damit einem Typus, für den Peter O'Donnells Schöpfung Modesty Blaise zum Vorbild, ja beinahe schon zur Genrebezeichnung wurde: Trashig fortgesetzt in einer ganzen Reihe sex- und kampflüsterner Heroinnen der 60er und 70er Jahre, die der Lizenz zum Töten unter anderem mit messerscharfen Stilettos und Dildos mit eingebautem Pistolenlauf nachkamen. Das weckt - vom Inhalt wie vom Format her - heftig nostalgische Erinnerungen an diverse Taschenbüchlein, die ich mal in der Wühlkiste aus den wilden Jahren meines Vaters gefunden habe (soll heißen: der Zeit, bevor Mama kam ... und nach einem für alle Beteiligten überraschend kurzen Intervall ich). Alle in "The Nazi Island Mystery" vorkommenden Frauen eint jedenfalls zumindest eine Eigenschaft: Sie loten vollbusig die Spannkraft von Leder, Latex und Lycra bis zum Letzten aus.
Die 60er und 70er bilden auch den eigentlichen Referenzrahmen des Romans, selbst wenn er in der nahen Zukunft spielt - abzulesen beispielsweise an den sonder Zahl enthaltenen Anspielungen auf die damalige Pop-Kultur. Dass man die Exploitation-Kultur von anno dunnemals nicht ehren kann, indem man sie 1:1 nachahmt, ist dem Autor aber klar. Alleine schon die diversen außerirdischen Einwirkungen mischen den klassischen Agent-versus-Nazi-Wissenschafter-Plot einigermaßen auf - aktuellen Bizarro-Einschlag erhält der Roman aber spätestens, wenn Kay das neuentstandene Vierte Reich betritt, in dem gerade das Festival der Weltgeschichte tobt: Ein surreales Gebrodel von Hunnen, Cowboys und rückgezüchteten Galionsfiguren der Linken, die zur Erbauung des Volkstums in einen Zoo gestopft werden sollen ... Hitlerland heißt es im Vorwort treffend. Soll aber keiner glauben, Draxlers Phantasmen wären völlig von der Realität losgelöst, denn die Steigerung von Themenpark heißt immer noch Weltausstellung. Hannover im Jahr 2000: Zwischen einem albanischen Geschützbunker und einem ominösen Loch im Boden, in das Freiwillige hinabtauchen durften, sammelte sich die samstägliche Weltausstellungsparade - gespeist offenbar aus allem, was gerade auf dem Gelände zusammengetrommelt werden konnte. Da zogen in direkter Folge an mir vorbei: Die spanische Krawalltheatertruppe La Fura dels Baus (komplett mit Stelzenläufern und Flammenwerfern), ein wie von der Straße wegengagierter Leierkastenmann, ein offener Truck voller Nonnen, die sich gegenseitig auspeitschten, und freundliche Weltausstellungsmitarbeiterinnen, die Luftballons verteilten. It's art, baby.
"The Nazi Island Mystery" ist auch von seiner Entstehung her ein Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart: Vor zehn Jahren als Fortsetzungsroman in der Netzzeitschrift EVOLVER erstmals publiziert, erscheint er nun auch in gedruckter Form - ein (Rück-)Weg, den schon einige in dieser Rubrik vorgestellte Bücher absolviert haben. - Am schönsten fließen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aber vielleicht dann ineinander, wenn Kay Blanchard einer peitschenknallenden Nazi-Wissenschafterin in deren Geheimlabor folgt, vor dem ein Schild "Eintritt nur für MitarbeiterInnen der Stein Laborbetriebe GmbH!" verkündet. - "MitarbeiterInnen mit großem I", stellte ich überrascht fest. Inge Steins Seufzen klang fast ein bisschen wehmütig. "Gönnen Sie mir doch diesen zarten Hauch von Nostalgie."
Zur Handlung: Ehe die letzte Botschaft eines MI6-Mitarbeiters Kay zu einer Adria-Insel führt, auf der die SS-Burg besagter Herrenmenschin steht, geht es erst mal in ein Wien, in dem irgendwie jeder wie irgendwer anderer aussieht. Da steigt schon mal Django (samt Sarg) in den Fahrstuhl ein oder bewegt sich ein Sammy Davis junior-Lookalike unbehelligt durchs arische Vierte Reich. Faszinierenderweise haben dergleichen Absurditäten aber (abgesehen von der Zitate-Show) ihren Grund - zumindest dergestalt, dass sie nicht willkürlich eingestreut und dann vergessen werden: Keine blinden Motive auszumachen, der Autor hält was von Handwerksehre! Kays Handwerk indes ist das Kämpfen und Töten, und da stellt sich ihr auch so einiges entgegen: Von Karate-Girls über Monsterschleim und Killerkraken, kommunistische Werwölfe (aus dem Weltraum), imperialistische Zorrozwerge auf Rollschuhen (ebenfalls aus dem Weltraum, ein Stück mehr zur Seite) bis zum Gröfaz höchstselbst.
Wo die Gewalt blüht, will sich der Sex natürlich auch nicht lumpen lassen, und wenn Kay auch noch ihre bunten Pillen einwirft, mutiert das Ganze endgültig zu einem "Cthulhu Meets The Lesbian Spanking Inferno"-Szenario. - Klar, dass das nicht endlos so dahingehen kann und sich auch Kays Schlampenschmäh irgendwann einmal abnutzen muss. Zumal sie als Figur, von der alles abprallt, auch nicht wirklich eine Entwicklung durchmachen kann, die einen großen Handlungsbogen gewährleisten würde. Aber da kommt einmal mehr die den literarischen Vorbildern entsprechende Kürze des Romans ins Spiel, die nicht nur nostalgisch, sondern auch für den Inhalt maßgeschneidert ist.
Vor einiger Zeit wurde hier Warren Ellis' "Gott schütze Amerika" vorgestellt, das ebenfalls ein Kaleidoskop der Abseitigkeiten in Gang setzt. Während Ellis' Roman allerdings auf eine überraschend biedere Botschaft hinausläuft, ist "The Nazi Island Mystery" nicht moralischer als ein Spaghetti-Western. Womit einmal mehr auf die 60er verwiesen ist. - Kids von heute würden Draxlers Roman vielleicht als die "Drawn Together"-Variante von James Bond beschreiben, aber die kannst du ja sowieso mit nix mehr schocken.
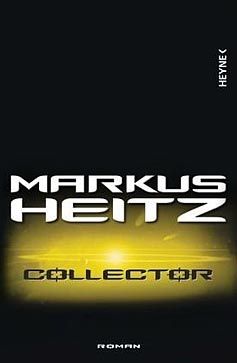
Markus Heitz: "Collector"
Broschiert, 653 Seiten, € 15,40, Heyne 2010.
"Schützenswerte, bedrohte Rasse Mensch - eure Rettung ist nahe!" So ein Satz kann ja gar nichts Gutes verheißen. Unter anderem weil die Menschheit des 31. Jahrhunderts gar nicht das Gefühl hatte bedroht zu sein, bis die ominösen Collectors ihre Heilsparole hinausplärrten und mit ihren technisch überlegenen Raumschiffen einen Planeten nach dem anderen abriegelten, um ihn unter ihre Obhut zu stellen. Zugegeben, die Erde ist ein umweltzerstörter Klumpen und die Bevölkerung drängt sich in wenigen Milliardenstädten zusammen - außerhalb davon gibt es nur noch Wüste und - schöne Idee! - kubikkilometergroße Hochregalhorte zur Aufbewahrung von Rohstoffen und Artefakten. Dafür haben sich die einstigen Flächenstaaten sowie die mächtigsten Konzerne der Erde aber längst ins All ausgedehnt und reihenweise Kolonialplaneten besiedelt. Welche Bedrohung für die Spezies Mensch könnte es also geben? So mancher kommt da insgeheim ins Grübeln ...
Aber erst einmal werden die Collectors selbst hinterfragt, ihre Herkunft - ob Aliens, autonom gewordene Androiden mit Künstlicher Intelligenz oder getarnte Truppen eines besonders raffgierigen Konzerns - und natürlich ihre Motive. Genetisch veränderte Menschen scheinen ihnen nämlich weit weniger schützenswert, da kann's schon mal zu einem planetaren Massaker unter Mensch-Tier-Chimären kommen. Die ungeteilte Zuneigung der Eugeniker from Space gilt den "wahren" Menschen, denen sie die Botschaft der Liebe dafür sogar mit der Hormonspritze einflößen. In einem der witzigeren Abschnitte des Romans muss die prüde Bischöfin (pardon: Bishopness) Theresa mitansehen, wie sich der Planet Putin in einen einzigen Orgienschauplatz verwandelt ... und wird sich solange gegen den hormonellen Zwang stemmen, bis sie sich mangels Auswahl schließlich um den ekeligsten Mann des ganzen Planeten wickelt.
In der Ausführung ist das alles dann nicht ganz so spektakulär, wie es jetzt vielleicht klingt. Bestseller-Autor Markus Heitz war bislang primär im Fantasy-Bereich unterwegs ("Die Zwerge", "Ulldart"). Im Nachwort zu "Collector" zählt er auf, was für ihn prägende Genre-Erfahrungen waren: Literatur wird keine genannt, Science Fiction war - wie für viele andere auch - offenbar vor allem ein Schau-Erlebnis. Also "Star Trek" und alles, was danach kam. Das mündet im Text zunächst einmal in diverse Anspielungen auf die Kulturproduktion des 20. Jahrhunderts (es tauchen auf: "Babylon 5", "Link der Butler" und was nicht alles sonst). Alles in allem ist der TV-Output unserer Tage den Menschen des Jahres 3042 noch recht präsent - ein wenig so, als hätten wir den Kopf voller Kreuzritterschwänke und Hoher Minne; aber Anspielungen auf die hypothetische Kulturproduktion des nächsten Jahrtausends gingen ja auch irgendwie ins Leere. Apropos Vergangenheit - auch die verwendete Technologie zeigt sich tendenziell retrofuturistisch: Es gibt Transmitter zum Beamen, Antischwerkraft-"Düsen", Sprünge durch den Hyperraum (Interim genannt), quäkende Übersetzungsgeräte und dazu dann noch Menschen mit Psi-Kräften - ganz, wie man sich das in den 60er Jahren mal so vorgestellt hat. Genau genommen erinnert das auch irgendwie an den technologischen Fuhrpark von "Perry Rhodan" - was als Bezugsquelle allerdings nicht genannt wird. Abweichend von allen möglichen Vorbildern jedoch das Phänomen, dass Raumschiffe nach dem Sprung durchs Interim von Schleim bedeckt sind. Das weckt Interesse.
Ein ausdrücklich guter Grundzug der "Justifiers"-Welt, die mit "Collector" ihre literarische Geburtsstunde erlebt, ist der Verzicht auf Schwarz-Weiß-Zeichnung. Wo interstellare Konzerne ihre jeweiligen Interessen gegeneinander ausspielen und als Einsatztruppen besagte Justifiers ins Rennen schicken, kann es von der ganzen Anlage her nur um Grautöne gehen. Auch die Hauptfiguren des Romans sind nicht per se heroische Gestalten: Der Trucker Kris Schmidt-Kneen, der beim Transportieren eines Alien-Antriebs gegen seinen Willen ins All geschleudert wird, ist ebenso eine gestrandete Existenz wie Faye Durrick, die sich nach einem Karriereknick fürs erste als Drogendealerin durchschlägt. Beide werden sich aber unversehens mit einem bunten Häuflein anderer in einer Justifiers-Mission wiederfinden, die Herkunft und Beweggründe der Collectors herausfinden soll. Dabei werden sie überdies auf zahlreiche Querverbindungen familiärer und sonstiger Art stoßen: Die Galaxis ist ein Dorf.
Einiges Erklärungspotenzial für die Warums und Wies des Romans dürfte der Umstand bieten, dass "Collector" laut Heitz die Einführung in eine multimediale "Justifiers"-Welt darstellt, zu der außer Romanen auch Comics und Rollenspiele kommen sollen. Deswegen wohl werden mehr Fraktionen und Kategorien eingeführt, als für das Romangeschehen tatsächlich von Bedeutung sind. Und auch die optische Komponente ist vor diesem Hintergrund anders einzuschätzen. Die in jedem Wortsinn unterschiedlichen Kolonien der irdischen Staaten mögen alle recht holzschnittartig wirken - siehe etwa den Planeten Putin mit seiner Mischung aus zaristischer und sowjetischer Folklore. In einem Comic allerdings kann das, was in einem Roman noch platt und unplausibel wirken mag, ein effektives Bild abgeben: Seien es die putinschen Militäruniformen oder die Collectors selbst, die man sich wie stampfende Borg mit - Stichwort unplausibel - Elektro-Schwertern ausmalen darf.
Für sich genommen ist "Collector" ein passables Abenteuer ohne viel Einbeziehung der dritten Dimension - sei es Überbau oder Tiefgang; im Filmbereich würde man von einem B-Picture mit großem Budget sprechen. Aber das Buch erfüllt seine Erwartungen - und die liegen wie gesagt nicht ausschließlich im literarischen Bereich.
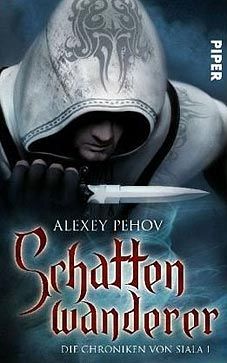
Alexey Pehov: "Schattenwanderer"
Broschiert, 558 Seiten, € 17,50, Piper 2010.
Interessant, wie sich die Herangehensweise an ein Buch im Lauf des Lesens verändern kann. Mein während der Lektüre vollgekrakelter Stichwortzettel, auf den ich jetzt starre, gibt schön chronologisch wieder, wie der Gesichtspunkt Literatur (im herkömmlichen Sinne) immer mehr hinter den des Computerspiels (letzten Endes ja auch ein Narrativ) gerutscht ist. Und das auf mehr Weisen, als zunächst zu erahnen war.
Anfangs also, noch ganz der Annäherung an einen Roman gemäß, ein paar Worte zur Hauptfigur: Schattenwanderer Garrett ist ein Meisterdieb. Gleich zu Beginn philosophiert er über den für ihn entscheidenden Unterschied zwischen dem Schatten und dem Dunkel. Das bezieht sich einerseits auf die heraufziehende Bedrohung, die ihre ersten Vorboten bereits in Garretts Heimatstadt Awendum geschickt hat; vor allem aber enthält es eine Aussage über Garretts moralisches Selbstbild. Er mag ja ein mit allen Wassern gewaschener professioneller Auftragsdieb sein - aber einer mit klarem Ehrbegriff. Und mit Schmäh: Als ein bestohlener Baron eine Belohnung auf Garretts Kopf aussetzt, klaut Garrett auch die. Generell scheint allen Figuren eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber hierarchisch Höhergestellten zu eigen - ein recht moderner Zug, der auch zu einer Stadt passt, in der die Wände voller Graffiti sind und magische "Neon"-Reklamen über den Läden prangen. Dazu eine multikulturelle Bevölkerung (samt draus erwachsenden absurden Konflikten), eine eher unfähige Wache, magische Umweltverschmutzung infolge misslungener Experimente und ein höchst realpolitisch eingestellter Herrscher, der mit den Diebes- und Mördergilden verhandelt ... da liegt ein Hauch Ankh-Morpork in der Luft.
Bevor Garrett so richtig klar wird, was er sich mit seinem neusten Auftrag eingehandelt hat, herrscht plötzlich ein enormes G'riss um ihn und seine Beute: Herrscherklasse und Diebesgilde, bekloppte Ziegenmenschen, Magier und zwei mit äußerst überschaubarer Intelligenz ausgestattete Dämonen werden zu seinen Mit- und Gegenspielern; im Hintergrund agieren mit dem Unaussprechlichen und dem Herrn zwei vorerst noch unbekannte Größen. Und "Spieler" ist das entscheidende Stichwort. Das wird spätestens klar, wenn Garrett - mittlerweile im königlichen Auftrag unterwegs, um das Reich vor eingangs erwähnter Bedrohung zu retten - in einen abgeschotteten Teil Awendums vordringt, um dort dringend benötigte Landkarten zu besorgen. Das funktioniert exakt wie ein Computerspiel: Vom ursprünglichen Game "Awendum" ins Add-on "Geschlossenes Viertel", dort Straßenkampf gegen Zombies und auf dem nächsten Level Rangelei mit Monstermädchen im Hausinneren, Aufgabe lösen und mit der verbesserten Ausstattung ins Ausgangsspiel zurück. Das wird sich in den folgenden Teilen der Trilogie "Die Chroniken von Siala" mit Sicherheit fortsetzen, wenn es auf der Suche nach dem Horn des Regenbogens ins vagliostrische Umland geht. Da warten erst mal die Wälder Sagrabas (und was darin so lauert, wird in Teil 1 bereits angedeutet) und am Schluss dann wohl die Katakombenstädte von Hrad Spine, wo das Horn versteckt wurde. Die wurden in Terrassen angelegt - womit die Levels des Spiels endgültig wörtlich zu verstehen sind.
So Game-kompatibel das alles wirkt - erstaunlicherweise handelt es sich, im Gegensatz etwa zur Dystopie "Metro 2033" von Landsmann Dmitry Glukhovsky, um keinen Multimedia-Anlauf des russischen Autoren. Ironischerweise liegen Alexey Pehovs Bezüge zur Welt der Computerspiele anderswo, gibt es da doch die Reihe "Thief", die ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat als der im Original 2002 erschienene und in Russland recht erfolgreiche Roman. Die zentrale Figur von "Thief" ist ein Meisterdieb namens ... erraten: Garrett. Zufall oder nicht: Dem Verlag der englischsprachigen Ausgabe von Pehovs Trilogie war die Parallele offenbar zu heikel, dort muss sich der "Shadow Prowler" nämlich als hausbackener Harold durchs Gebüsch schlagen.
Zusammengefasst: In lockerem, oft halblustigem Erzählton finden wir uns unter Elfen, Zwergen, Orks, Gnomen, Riesen, Kobolden, Drachen, Ogern und Trollen wieder, treffen - Kronk-a-Mor! - auf die Morpheme des Bösen, jagen nach einem magischen Gegenstand, mit dem sich die finstere Bedrohung aus der Vergangenheit abwenden lässt - und das einzige Motiv aus dem Kabinett der Unvermeidlichkeiten, das zunächst ausgelassen schien, kommt nach einiger Zeit dann doch noch: die uralte Prophezeiung, die Garretts Multi-Spezies-Rettungsmission ihren übernatürlichen Segen erteilt. "Schattenwanderer" ist die x-te Variation des kleinsten gemeinsamen Nenners unzähliger anderer Fantasy-Romane. In den Worten der Prinzen: Es ist alles nur geklaut, ey-oh ey-oh. Aber schließlich geht's ja auch um einen Meisterdieb. Teil 2 der "Chroniken von Siala" ("Schattenstürmer") erscheint im August.

Daniel Fox: "Geschmiedet in Feuer und Magie"
Broschiert, 600 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2010.
Im Vergleich zum vorangegangenen nun der bedeutend bessere Fantasy-Roman. Und das ist er nicht etwa nur deshalb, weil er - statt die ausgelutschten Elfen, Zwerge und bla zu recyceln - eine mythische Variante des alten China heraufbeschwört, sondern auch rein schreiberisch. Dahinter steckt der britische Genre-Autor Chaz Brenchley, der auch im deutschsprachigen Raum mit seiner "Outremer"-Reihe bekannt wurde, und unter dem Pseudonym Daniel Fox seine (noch gar nicht so alte) Liebe zu Taiwan und der chinesischen Kultur verarbeitet. Das mag manche an die "Meister Li"-Romane von Barry Hughart erinnern: Mit verschmitztem Humor à la Hughart ist's bei Fox zwar nichts - dafür werden die handlungsmitbestimmenden Kriegsgräuel zu realistisch dargestellt -, doch versuchten sich beide Autoren der "märchenhaften" fremden Kultur durch einen kunstvollen Stil anzunähern. Wodurch nicht nur das tendenziell unvorhersehbare Fortschreiten der Handlung den Roman lesenswert macht, sondern jeder einzelne Punkt auf den kurvenreichen Wegen der Hauptfiguren seine Reize entfalten kann.
Stichwort unvorhersehbar: Dass der Autor anderes im Sinn hatte als stereotype Handlungsschemata abzupausen, zeigt eine Episode kurz nach dem Beginn. Der junge Schreibergehilfe Han wird von Piraten aufs Meer entführt und erlebt ihren Angriff auf eine Insel mit, auf der Mönche der Legende nach jene Ketten schmieden, mit denen eine Drachin seit Jahrhunderten auf dem Grund des Meeres festgehalten wird. Beim Anblick der mönchischen Kampfkunst hat Han kurz die hoffnungsvolle Vision, sie würden die Piraten in die Knie zwingen, ihn verschonen und ihm in ihrem Orden eine neue Zukunft geben. Und genau so wären wohl auch viele Fantasy-Romane geschrieben worden - doch nichts da: Die wehrhaften Mönche werden massakriert - und Han wird sogar, wie zuvor angedroht, von seinem Kapitän der Daumen abgehackt. Eine von vielen, vielen Grausamkeiten, zu denen es im Roman kommen wird: Morde, Vergewaltigungen, drakonische Strafen und schließlich ein Krieg.
Fox verwendet sogar ein ganzes - und sehr eindringliches - Kapitel darauf, anhand von Personen, die in der weiteren Handlung keine Rolle spielen, das Grauen zu schildern, das die Zivilbevölkerung im Streit der Mächtigen heimsucht. Denn der jugendliche Kaiser Chien Hua ist mit seinem gesamten Hofstaat und den ihm treuen Teilen der Armee auf der Flucht vor putschenden Generälen. Wie ein Heuschreckenschwarm fällt der kaiserliche Tross in einer Hafenstadt ein, beschlagnahmt erst alle Nahrungsmittel und schließlich auch sämtliche Boote, mit denen auf die Insel Taishu als letztmöglichen Zufluchtsort übergesetzt wird. Die Stadtbevölkerung bleibt eingeschlossen von der Armee der Rebellen und ohne Hoffnung zurück. - Weitgehend unblutig, aber ähnlich tragisch die Versuche der Bergarbeiter-Clans auf Taishu, die von ihnen geschürfte Jade direkt zum Kaiser zu bringen und die raffgierigen Zwischenhändler auszuschalten. Auch wenn dieses Unternehmen letztlich an persönlichen Umständen scheitert, nimmt sich die Vergeblichkeit des Versuchs geradezu symbolhaft aus: Das System lässt denen, die in der Hierarchie unten stehen, keine Chance.
... mit einer möglichen Ausnahme, dem Fischermädchen Mei Feng. Sie befindet sich zufällig auf dem Boot, auf dem der Kaiser nach Taishu übersetzt, und erfreut ihn mit ihren zwanglosen Umgangsformen. Zwar lässt er sie daraufhin ohne mit der Wimper zu zucken ihrem Großvater abkaufen, doch entwickelt Mei Feng im neuen Leben als Konkubine ein ungeahntes Talent für Machtspiele und freundliche, aber effektive Manipulation. Ihr Hauptinteresse gilt dabei stets dem Wohl der Inselbevölkerung, der sie ein ähnliches Los wie den FestlandbewohnerInnen ersparen will. Mei Feng wird damit zur einzigen der drei Hauptfiguren, die selbsttätig agiert. Ihre männlichen Pendants bleiben buchstäblich gebunden: Han ist nicht nur auf Gedeih und Verderb dem weiteren Schicksal der Piraten ausgeliefert, er trägt nun auch das symbolische (aber trotzdem sauschwere) Ende der magischen Ketten, mit denen die Drachin gefesselt ist. Und dem dritten Schicksalsgefährten, dem Bergarbeiter-Jungen Yu Shan, ergeht es kaum besser. Er war derjenige, den die Clans dazu ausersehen hatten, einen riesigen Jadeklumpen direkt zum Kaiser zu bringen, doch erliegt Yu Shan der Magie des Steins und kommt in jedem Sinne des Wortes vom Weg ab.
Das Schöne an "Geschmiedet in Feuer und Magie" ("Dragon in Chains") ist, dass es ermöglicht, die Übergänge zwischen den Interpretationsebenen fließend zu gestalten. Beide Jungen ringen mit destruktiven Kräften in ihrem Inneren: Yu Shan, der zu dem geworden ist, was als Jadeesser verfemt wird, ist süchtig nach der - metaphorischen wie auch realen - Magie des Steins geworden; sie verleiht ihm dieselben Kräfte wie dem Kaiser, macht ihn zugleich jedoch abhängig. Und Han droht immer mehr unter der unmenschlichen Last der Ketten zu zerbrechen, mit denen die Drachin an ihn und durch ihn an ihr nasses Exil gebunden ist. Sie - ein Wunder, sie, die einst ganz aus Hitze und Hatz, Reißen und Verzückung bestanden hatte - lebt nun auch in Hans Kopf, doch will sie um jeden Preis ihrer Natur folgen und frei sein. Fox sei's gedankt, ist sie nicht einfach nur ein Reptil in Übergröße, das am Meeresboden herumhockt, sondern eine beseelte Naturgewalt. Ihr Atem ist der Nebel, eine Regung ihres Körpers ein Tsunami. Ihr möglicher Wiederaufstieg kündigt sich simultan zum heraufziehenden Krieg an.
Das nenne ich einen verheißungsvollen Auftakt. Teil 2, "Im Schatten von Stein und Drache", erscheint im November, den kann ich jetzt schon empfehlen.

Jay Lake: "Mainspring"
Broschiert, 368 Seiten, Tor Books 2008.
Und noch ein zweites Mal in dieser Rundschau läuft die Erde auf Schienen dahin. Diesmal war Gott selbst der Schienenleger, entsprechend größerdimensioniert sieht das Gleis aus (und besteht überdies aus schimmernd schönem Messing). Im Frühling ist mit "Pinion" der dritte Teil von Jay Lakes formidabler "Mainspring Universe"-Reihe erschienen - aber da man ja meistens am besten von vorne beginnt, sei hier Teil 1 empfohlen. Der übrigens - Extrazuckerl - eine in sich abgeschlossene Handlung bietet.
Nach einer Reihe von Kurzgeschichten hat der in Oregon lebende Jay Lake erst Mitte der 00er Jahre, also rund um seinen 40. Geburtstag, mit dem Romaneschreiben begonnen. Ein literarischer Spätzünder, gewissermaßen - umso produktiver war er seitdem. Mit voller Steampunk-Energie wirft er uns in "Mainspring" in eine Welt an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, also kurz bevor Relativitätstheorie, Quantenmechanik und all die anderen Dinge ersonnen wurden, die die Physik so verdammt kompliziert gemacht haben. Hier entspricht die Erde noch streng mechanistischen Vorstellungen, wie sie selbst die Vorläufer Isaac Newtons nicht so wörtlich genommen hätten. Die Erdachse hat einen Federantrieb und der Äquator ist ein 100 Meilen hoher Gebirgswall, auf dessen Messingdach gigantische Zahnradzacken thronen: So rotiert die Erde um das Gleis, das sie rund um die Sonnenlampe führt. Und wer besonders gute Ohren hat - wie etwa der Uhrmacher-Lehrling Hethor Jacques aus New England -, der hört Nachts das leise Klacken der Sterne.
Und so fällt es auch an Hethor, das Uhrwerk des Universums zu reparieren, als dieses aus dem Takt gerät. Unmittelbar zu Romanbeginn schreckt ihn der Erzengel Gabriel aus dem Schlaf und erteilt ihm den Auftrag, mittels des verloren gegangenen Key Perilous das Federwerk am Torsionspendel der Erdachse wieder aufzuziehen. Eine Aufgabe von wahrhaft biblischen Dimensionen - nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch weil sie Hethor auf einen Leidensweg befördert: Durch eine Intrige landet er völlig mittellos auf der Straße, und als er dem Vizekönig der immer noch britischen Neuengland-Kolonie von seiner Mission erzählt, lässt der den vermeintlichen Narren ins Gefängnis werfen (ein ziemlich gruseliges voller absichtlich eingemauerter U-Bahnarbeiter obendrein). Aber Hethor erhält auch immer wieder Unterstützung durch ein geheimes Netzwerk, das an seine Mission glaubt, sich vorerst aber noch bedeckt hält. Mehr zu den Hintergründen werden die LeserInnen in den weiteren Romanen erfahren. Vorerst tun sie ohnehin nichts zur Sache, erst steht die überlebensnotwendige Reparatur an: Hethor kann sogar hören, dass das mitternächtliche Zahnradklicken der Erdachse immer unpünktlicher wird - für alle unübersehbar aber die sich häufenden Erdbeben, die die verlangsamte Erdrotation auslöst.
Lake zeichnet einen überaus sympathischen Helden und versetzt ihn in eine Reihe sehr menschlicher Situationen, die mal zum Traurigen, mal zum Komischen ausschlagen: Sei es der tragische Abschied Hethors von seinem Meister, sei es eine Kutschfahrt, auf der der frischverpflichtete Himmelsbeauftragte die schockierende Feststellung macht, dass es sich beim Kutscher um ein Mädchen handelt ... die weitere Reise bringt Hethor vor lauter durcheinandergewirbelter Geschlechterklischees und aufwallender jugendlicher Erotik schier zum Platzen. Es ist bei weitem nicht das letzte Mal, dass er seinen Horizont erweitern wird, sobald es erst mal mit dem Luftschiff - was wäre Steampunk ohne Luftschiffe? - zum Equatorial Wall geht. "Mainspring" wächst sich in der Folge zu einem prallen Abenteuer aus, das an Greg Keyes' "Bund der Alchemisten"-Reihe ebenso erinnert wie - Stichwort Worldbuilding - an Philip José Farmer und in weiterer Folge an Autoren der Genre-Frühzeit wie Jules Verne und Edgar Rice Burroughs. Das Äquatormassiv, aufgrund seiner Größe praktisch ein eigener Kontinent, nimmt sich überhaupt wie ein Burroughs-Themenpark aus: Da gibt es zyklopische Felsenstädte voller weißhaariger Affen, vergessene römische Kolonien, fliegende Menschen, Kampfautomaten aus Eisen und Kristall - kurz: Wunder über Wunder. Lake greift mit Verve exotistische Vorstellungen des 19. Jahrhunderts auf - und mehr noch als der Äquatorwall selbst dient die unerreichbar dahinterliegende Südhalbkugel als Projektionsfläche für Mythen, wie sie einst um die (von Europäern) unerforschten Teile Afrikas oder Südamerikas gesponnen wurden.
Ein wichtiges Thema ist natürlich auch die Religion, die im Roman eine buchstäblich wegweisende Rolle spielt. Man sollte eigentlich glauben, dass in einer Welt, über deren Himmel sich eine gigantische Messingschiene zieht, keine Zweifel an der Existenz eines Gottes bestünden. Doch dem ist nicht so: Rationale Humanisten gibt es auch hier, und es wird viel darüber diskutiert, ob der Gott der Bibel abwesend ist - oder vielleicht überhaupt nie existierte und irgendwelche Clockmakers die Welt gebaut haben. Und selbst bei religiösen Menschen gehen die Vorstellungen weit auseinander zwischen dem patriarchalischen Gott des Alten Testaments und einer pantheistischen Gleichsetzung der Gottheit mit der Welt an sich. Wie stets spiegeln die unterschiedlichen Gottesbilder dabei die jeweilige Gesellschaft wider, die sie hervorgebracht hat. Und auch hier kommt Lakes Worldbuilding mit Sinn fürs Detail zum Tragen: Christus wurde in dieser Welt nicht ans Kreuz, sondern an ein Uhrwerk genagelt (horofixion, famoses Wort), und auch das Vaterunser lautet dementsprechend ein wenig anders: "Our Father, who art in Heaven, Craftsman be thy name, for thine is the power, and the precision ..."
Ein klasse Leseabenteuer, ich kann's nur empfehlen. Fortsetzen lässt es sich mit "Escapement" (2008; ebenfalls bereits als Taschenbuch erhältlich) und "Pinion" (2010). Eine Übersetzung ins Deutsche ist vorerst nicht in Sicht.
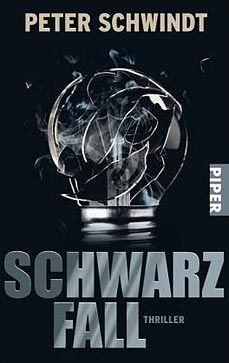
Peter Schwindt: "Schwarzfall"
Broschiert, 282 Seiten, € 9,20, Piper 2010.
Ja, am Anfang stellen sie noch Stühle ins Freie und sehen sich mit dem Bier in der Hand an, wie Frankfurt nach dem großen Stromausfall in aller Schwärze daliegt - später wird ihnen das Lachen noch vergehen. Monatelang hat es in Deutschland nicht geregnet, bis die Pegelstände der Flüsse schließlich soweit abgesunken sind, dass Kraftwerke der Reihe nach mangels Kühlung abgeschaltet werden müssen. Das durch Waldbrände ohnehin geschädigte System der Überlandleitungen ist überlastet und eine Kettenreaktion setzt sich in Gang, wie wir sie vom großen nordamerikanischen Stromausfall des Jahres 2003 noch in Erinnerung haben. Die Einsatzkräfte sind hoffnungslos überfordert, und als auch noch die Wasserpumpen ihren Dienst einstellen, sitzt die deutsche Bevölkerung endgültig in der heißen, dunklen Scheiße. Nichts geht mehr.
... klingt nach dem Stoff eines typischen Pro7-Katastrophenzweiteilers (gab's da nicht sogar einen mit sehr ähnlicher Grundidee, "Hitzewelle in Frankfurt" oder so?) - und so weit hergeholt ist der Vergleich auch gar nicht. Vor allem filmische Untergangsszenarien werden ja gerne auf die individuelle Ebene heruntergebrochen: Der Niedergang der Außenwelt dient als Bühne bzw. Spiegel für den Zerfall der Zivilisation im Menschen selbst. Der Frankfurter Peter Schwindt versteckt dies gar nicht erst, sondern stellt die zwischenmenschliche Ebene klar in den Vordergrund. Die Rahmenhandlung entspinnt sich rund um ein kleines Ensemble von Hauptfiguren, zwischen denen vielfältige - mitunter vielleicht auch zuviele, um wahrscheinlich zu bleiben - Querverbindungen bestehen.
Und alle ProtagonistInnen leben in konfliktträchtigen Umständen: Jessie und Patrick sind ein Teenager-Pärchen mit Kind, aber ohne Geld - für Brisanz ist gesorgt. Die Ärztin Katharina Debus muss sich nicht nur mit dem stressigen Berufsalltag im Krankenhaus und einem selbstherrlichen Chefarzt herumschlagen, zuhause wartet auch noch ihre dement werdende Mutter auf sie. Und die gutbürgerliche Familie Hellmann schließlich ist längst nur mehr Fassade: Die Ehe von Harald und Claudia besteht seit 20 Jahren - für das Ende reichen schon zwei mitten im Alltagstrott beiläufig fallende Sätze: "Willst du die Scheidung?" - "Es wäre besser, nicht wahr?" (Ein großes Plus an Schwindts Stil ist nebenbei bemerkt, dass er keinen Erzählraum verschwendet, sondern sich aufs Erforderliche konzentriert ... fast als hätte er ein Zeilenlimit einhalten müssen.) Harald Hellmann erweist sich als rechthaberischer Spießer und riecht von Anfang an drei Kilometer gegen den Wind nach einem "Falling Down"-Kandidaten. Dass er am Ende seines Vorstellungskapitels im Hobbyraum einen Waffenschrank öffnet, kommt also nicht überraschend.
Zündschnüre glosen an allen Ecken und Enden - es braucht nur noch einen Anstoß wie den landesweiten Stromausfall, um das menschliche Pulverfass endgültig hochgehen zu lassen. Wie dies dann abläuft, ist wieder eine andere Sache. Schwindt greift bewährte Muster auf: Einbrüche und Plünderungszüge auf der einen Seite - die Bildung von Bürgerwehren, die auch nichts gegen ein bisschen Schutzgelderpressung haben, auf der anderen. Dass die beiden Parteien einander vom moralischen Standpunkt aus durchaus ähneln und sich ein Räuber-und-Ritter-System à la Frühmittelalter anbahnt, wird sehr schön angedeutet, wenn auch nicht bis zur letzten Konsequenz ausgeführt. Schwindt hat bislang in erster Linie Jugendromane geschrieben, und das schlägt sich nicht nur in der flapsigen Sprache des Romans nieder (was in Dreiteufelsnamen ist ein Druffi??), sondern auch darin, dass alles nicht gar so schlimm kommt, wie es in vergleichbaren Erzählungen schon geschehen ist. "Schwarzfall" wird reißerischer angekündigt, als es letztlich ist, und trägt durchaus Züge einer "Tatort"-Folge unter erschwerten Rahmenbedingungen. Aber es muss ja auch nicht immer alles komplett in Schutt und Asche fallen.
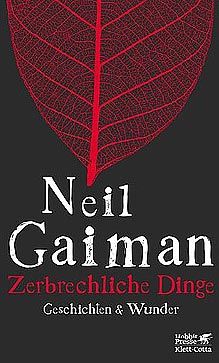
Neil Gaiman: "Zerbrechliche Dinge"
Gebundene Ausgabe, 329 Seiten, € 20,50, Klett-Cotta 2010.
Neil Gaiman ist in vielen Welten zuhause: Die einen kennen ihn als Comic-Autor, die anderen von seinen Arbeiten fürs Filmbusiness, die nächsten als Autor von Kinderbüchern (das sind die, die sich anschließend wundern, warum ihre literarisch beschenkten Sprösslinge die nächsten Nächte im elterlichen Bett schlafen wollen) oder als großen Romancier der Phantastik - und Musik- oder gar Klatschspaltenfans identifizieren ihn zumindest als den kongenial schrägen Verlobten von Dresden Dolls-Frontfrau Amanda Palmer. Viele Gesichter also, und entsprechend bunt sieht auch die Palette der Geschichten aus, die hier versammelt wurden. 14 sind es insgesamt, die Auswahl entspricht übrigens nicht ganz der originalen Story-Sammlung "Fragile Things".
An den Übergängen von Traum und Wirklichkeit siedelt der Klappentext Gaimans Erzählungen an und sehr schön fließend ist auch der Übergang der autobiografisch anmutenden Eröffnungsepisode "Kies auf der Straße der Erinnerung" in das folgende "Verbotene Bräute gesichtsloser Sklaven im geheimen Haus der Nacht grausiger Gelüste", welches das vorangegangene Titelmotiv gleichsam als Einleitung übernimmt ... doch führt der Kiesweg nun zu einem gar schauerlichen Haus. Das wiederum ist in der Fantasie eines Jungautors angesiedelt, der so gerne realistische Literatur schreiben würde. Nach und nach enthüllt Gaiman nun aber, wie die Realität hinter der Schulter des Schreiberlings aussieht: Eine Edgar-Allan-Poe-Welt von sprechenden Raben, im Wahnsinn kreischenden Verwandten, die in irgendeinem Hinterzimmer angekettet wurden, und dergleichen mehr. Zu dumm nur, dass sich das nicht aufs Papier übertragen lassen will - bleibt als Ausweg wohl doch nur die Möglichkeit, absurde Phantastik über Toastbrot und Ehekrisen zu schreiben. - Ähnlich spielerisch vergnügt sich Gaiman in "Eine Studie in Smaragdgrün", das als Crossover-Hommage an Arthur Conan Doyle und H. P. Lovecraft beginnt, Identitäten und Gut-Böse-Zuordnungen aber zunehmend verschwimmen lässt.
Gaiman findet die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit durchlässig werden zu lassen. In "Bitterer Kaffeesatz" driftet ein Mann nach dem Ende einer Beziehung in einem gleichsam scheintoten Zustand durchs Leben, nimmt durch Zufall die Identität eines anderen an (passenderweise ein Anthropologe mit Spezialgebiet Zombies) und strandet im morbid-schwülen Ambiente von New Orleans. - "Goliath" handelt vom Krieg gegen Aliens und blickt zugleich in eine "Matrix"-artige Welt; der Protagonist der Geschichte führt ein Leben mit Ablaufdatum und irrt durch ein Labyrinth von Zeitsprüngen, Déjà-vus und Realitätsbrüchen: Ein seltener Ausflug Gaimans in die Science Fiction - wenn man so will, gilt dies auch für das preisgekrönte "Wie man auf Partys Mädchen anspricht". Hier landen einige Jugendliche auf der falschen Fete und lernen nicht nur die fremde Welt des Sex kennen. - "Die wahren Umstände im Fall des Verschwindens von Miss Finch" werden in der gleichnamigen Geschichte vom Ich-Erzähler und seinen Freunden rekapituliert, nachdem sie die verbiesterte Titelfigur im Theater der nächtlichen Traumwelten (einer Gaiman-Variante des Jim Rose Circus) verloren haben. "Virusproduzentenkrupp" schließlich löst sich von selbst in seine Bestandteile auf. Geschildert werden - Achtung Hypochonder-Alarm! - die Symptome einer fiktiven Krankheit; eines davon ist die Schwierigkeit stringent zu formulieren. Dürfte gar nicht so leicht zu übersetzen gewesen sein.
"Der Herr des Tals" ist auf Deutsch bereits in der Piper-Anthologie "Legenden" erschienen, und apropos Widerholungen: Auch die Mitglieder des Klubs der Epikuräer in der launigen Erzählung "Sonnenvogel" haben mehrfach mit dem Gefühl zu kämpfen, dass alles schon mal da gewesen ist. Nachdem sie jedes bekannte Tier - darunter auch einige ausgestorbene und mythologische - bereits gegessen haben, reisen sie auf der Suche nach einer neuen kulinarischen Sensation nach Ägypten. Ständig beschleicht sie dabei das unterschwellige Gefühl einer Wiederholung - was sich einerseits in raffinierter Weise mit besagter Sensation verknüpfen wird ... und andererseits zu dem Déjà-vu passt, das mich beim Lesen beschlichen hat. Ich komme aber um die Burg nicht drauf, auf welcher Erzählung eines anderen Autors "Sonnenvogel" basieren könnte (wer es weiß, gerne posten!). Hier kommt auch das einzige Manko der Geschichtensammlung zum Tragen: Leider gibt es weder Vor- noch Nachwort und erst recht keine Anmerkungen zu den einzelnen Episoden.
Bis zu einem gewissen Grad kompensiert Gaiman selbst dies allerdings dadurch, dass er mehrfach über die Mechanismen des Geschichtenerzählens an sich sinniert. Wie im surrealen "Oktober hat den Vorsitz", in dem die zwölf Monate um ein Lagerfeuer sitzen und abwechselnd den Erzähler geben. Gaimans genereller Tenor: Geschichten mit rundem Ende schreibt das Leben selten. - Dem im Klappentext erhobenen Anspruch wird die preisgekrönte Sammlung jedenfalls gerecht: Der richtige heimelig-unheimliche Lesestoff nicht nur für eingefleischte Gaiman-Fans, sondern auch für alle diejenigen, die das Werk von beispielsweise Kelly Link oder Roald Dahl schätzen.

Jack Campbell: "Black Jack"
Broschiert, 380 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2010.
"Black Jack" ("Fearless"; 2007) ist der zweite Roman um den Flottenkommandanten John Geary alias Black Jack - und zwischen diesen beiden Namen spannt sich auch sein ganzes persönliches Dilemma auf. Wir rekapitulieren: Im ersten Teil der Reihe "Die verschollene Flotte", "Furchtlos" (Dauntless"; 2006), gerät die Kriegsflotte der Allianz in einen Hinterhalt des mit ihr verfeindeten Syndikats. Der befehlshabende Admiral kommt zu Tode - glücklicherweise wurde zuvor aber die Rettungskapsel gefunden, in der John Geary 100 Jahre lang im Kälteschlaf gelegen hatte. So übernimmt Geary als dienstältester Offizier - eine ziemlich geniale Ironie - das Kommando und steht nun vor der Mammutaufgabe, seine aus einigen hundert Raumschiffen bestehende Flotte sicher in die Heimat zurückzubringen.
Geary ist ein Fossil - und zwar eines der menschlichen Art. Der 100-jährige Krieg zwischen den beiden Sternenföderationen hat die eigentlich demokratische Allianz weit genug verrohen lassen, dass sie ihrem autoritär gelenkten Gegner zu ähneln beginnt. Längst steht beim Kämpfen nicht mehr das Siegen, sondern das Töten im Vordergrund. Die Flotte ist ein entsprechend undisziplinierter Haufen, der von Taktik wenig hält und sich lieber - "Tapfer! Glorreich! Hirnlos!" - in die Schlacht stürzt. Geary müht sich nach Leibeskräften, das Kriegshandwerk wieder den Regeln seines Zeitalters zu unterwerfen - darunter so vergessene Konzepte wie dem Feind vor einem Angriff Zeit zum Evakuieren einzuräumen oder keine zivilen Ziele zu bombardieren. Dass er in einem Zeitalter, das kein strategisches Denken mehr zu kennen scheint, mit seinen Manövern aus der Mottenkiste durchschlagenden Erfolg hat, verstärkt noch seinen Ruf als Kriegsheld. "Black Jack" wird als Artus im All verehrt, der in der Stunde der Not zurückgekehrt ist, um seine Heimat zu retten: Ein Gräuel für den nach alten Spielregeln erzogenen John Geary. Zugleich hätte er ohne diese Heldenverehrung aber keine Chance, seine "weichen" Ideen durchzusetzen: Ein Dilemma, das ihn fortwährend zwingt sich selbst zu hinterfragen - keine schlechte Prämisse für eine Military SF-Reihe.
Lästige aber notwendige Unterstützung erhält John dabei von Senatorin Victoria Rione, der einzigen Zivilistin, die mit der Flotte reist, denn die präfaschistoiden Züge des Heldenkults sind für sie erst recht ein Alarmsignal. Im Zwiespalt zwischen Argwohn und dem tiefen Bedürfnis nach Vertrauen kommt es zwischen den beiden zu einer ruppigen aber unaufhaltsamen Annäherung - umso besser kann Victoria künftig in die Rolle schlüpfen, die einst ein Sklave beim Triumphzug eines römischen Feldherrn spielen musste: Nämlich den Triumphator ständig daran zu erinnern, dass auch er nur ein Mensch ist. Das Grundszenario von "Die verschollene Flotte" erinnert ohnehin stark an "Battlestar Galactica" - Roslin & Adama finden ihre Entsprechung in den Kabinengesprächen von Rione & Geary.
... das soll jetzt nicht heißen, dass der Roman sonderlich pazifistisch wäre oder diejenigen, die vor allem Action! Action! Action! wollen, zu kurz kämen: Locker 50 Prozent des Umfangs machen Raumgefechte aus. Zu bemängeln wäre, dass das Syndikat leider genauso skrupellos agiert, wie es gesichtslos bleibt. Da könnte nachträglich aber noch ein wenig Differenzierung ins Spiel gebracht werden, denn es gibt Andeutungen, dass im Krieg der Sternenföderationen eine dritte - und möglicherweise nichtmenschliche - Partei ihre Extremitäten drin hat, was die Motive der fiesen Syndiks in ein anderes Licht rücken würde. Ja, gelegentlich hört man die Geigen der Selbstbeweihräucherung (... dann konnte er nur den Vorfahren danken, solche Schiffe und Matrosen an seiner Seite zu haben) und generell bleibt die Frage offen, ob sich hinter einer Obama-Figur zu scharen gleich alles wettmacht, was zuvor in Jahrzehnten verbockt wurde. Wer dergleichen politische Bezüge übrigens für unzulässig hält, möge sich beispielsweise diesen Gedanken Gearys über Kriegstreiber durch den Kopf gehen lassen: Mögen uns die Vorfahren vor jenen Menschen beschützen, die von sich behaupten, sie verteidigen die Allianz, obwohl sie in Wahrheit alles zerstören, was diese Allianz ausmacht.
Jack Campbell ist das Pseudonym John G. Hemrys, eines ehemaligen Offiziers der US Navy. Die Einblicke, die er in seiner ersten Karriere gewonnen hat, zeigen sich nicht nur in den diversen Karriere- und Psychoprofilen, denen wir im Verlauf des Romans begegnen, sie prägt auch den Erzählton. Wo sich Military-SF-Star David Weber (vormals Werbe- und PR-Agent) an den Strukturen des Militärwesens beinahe schon aufgeilt, bleibt Profi Campbell deutlich nüchterner. Im Vergleich zu ähnlich gestrickten Serien ist "Die verschollene Flotte" somit nicht die schlechteste.
In der nächsten Rundschau widmen wir uns dann gleich zweimal dem Ding, mit dem Elton John durch die Sümpfe der Everglades brettern könnte, dem Abschluss von Pierre Bordages "Krieger der Stille"-Trilogie ... und der Einberufung in einen Krieg, den es möglicherweise gar nicht gibt. (Josefson)