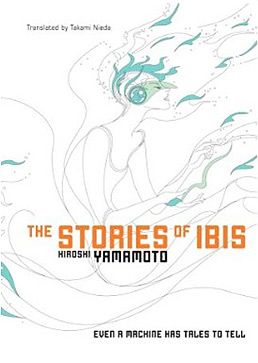
Hiroshi Yamamoto: "The Stories of Ibis"
Broschiert, 466 Seiten, Haikasoru/VIZ Media 2010.
Zum Auftakt ein Buch eines japanischen Autors, der mir bislang leider völlig unbekannt war ... dessen Backlist ich aber gleich im Anschluss auf die "Search and Purchase"-Liste gesetzt habe. Hiroshi Yamamotos "The Stories of Ibis", das 2006 auf Japanisch und heuer erstmals auf Englisch erschien, beginnt mit einem wunderschönen Bild: Einem Engel gleich schwebt eine geflügelte Androidin aus dem Himmel nieder und landet inmitten pflanzenüberwucherter Großstadtruinen auf einem verrosteten Bus, direkt vor den Augen des Ich-Erzählers. Es folgt eine kurze Martial-Arts-Einlage, die in einen Waffenstillstand mündet - und zu einer ungewöhnlichen Abmachung führt: Ibis, so der Name der Androidin, will ihm sieben Geschichten darüber erzählen, wie es zum Niedergang der Menschheit und zur Machtübernahme der Künstlichen Intelligenzen kam. Doch muss sie ihm das Versprechen geben, dass alle Erzählungen reine Fiktion sind; denn er will nicht von robot propaganda manipuliert werden. Erst wenn er sich freiwillig dazu bereit erklären sollte, will sie ihm auch die wahre Geschichte erzählen.
Die Menschen dieser Zukunft sind nur noch wenige, sie verstecken sich in kleinen Kolonien und leben davon, die Versorgungszüge zwischen den Maschinenstädten zu überfallen. Nach oben sehen sie nicht gerne, denn am Himmel leuchten der "Katzenauge-Mond" der Maschinen und künstliche Sterne wie Zeugnisse der menschlichen Bedeutungslosigkeit. Man munkelt von den Final Hundred Years zwischen 1940 und 2040, ehe die KI-Revolte die Welt veränderte, und lebt in Angst davor, von Maschinen gekidnappt zu werden. Das will aber gar nicht so recht dazu passen, dass der im Zweikampf verletzte Erzähler freundlich behandelt und sorgsam aufgepäppelt wird. Nichtsdestotrotz bleibt er misstrauisch - das Buch wechselt in der Folge zwischen den Erzählungen der elektronischen Scheherazade und Intermissions, in denen Ibis und ihr unfreiwilliger Gast das Gehörte reflektieren ... und in denen der Erzähler immer weiter in die Maschinenzivilisation seiner Gegenwart eingeführt wird.
Der Auftakt "The Universe On My Hands" dreht sich um eine Gruppe junger Menschen, die eine an "Star Trek" angelehnte relay novel - einen abwechselnd fortgesetzten Online-Roman - schreiben. Als einer von ihnen einen Mord begeht und abtaucht, verhört ein Polizist die Organisatorin der Gruppe und äußert sich verächtlich über ihre "Realitätsflucht" - doch erweist sich der Teamgeist der "Crew" auch im wirklichen Leben als reale Größe: Sie arbeiten die Verzweiflungstat in ihr Szenario ein und werfen die spontan weitergesponnene Geschichte als Rettungsanker aus. Yamamotos Grundtendenz deutet sich bereits hier an und bestätigt sich in den folgenden Episoden, die - mit einer Space-Opera-Ausnahme - allesamt im Japan der Gegenwart oder nahen Zukunft handeln. "Virtueller Autismus" scheint dem Mädchen Sami in "Mirror Girl" zu drohen, als sie mit dem gleichnamigen Spielzeug - einem Prinzessinnen-Avatar mit einfacher KI - als wichtigster Bezugsperson aufwächst. Doch entwickelt sich Sami zu einer gesunden, selbstbewussten Frau weiter - genauso wie die Protagonistin von "A Romance in Virtual Space", die einen körperlichen "Makel" verbirgt, indem sie nur Verabredungen im Virtuellen Raum eingeht. Die gemeinsamen Abenteuerspiele im VR nähren in ihr aber den Mut, auch in der Realität Risiken einzugehen.
So positiv, wie Ibis die Mensch-Maschine-Interaktionen schildert, ist es kein Wunder, dass unser Erzähler skeptisch bleibt und erneut festgehalten haben will, dass es sich um fiktive Begebnisse handelt. "I know that humans are moved by true stories", entgegnet Ibis, "their feeling wanes when they learn a story isn't true. But isn't that a denial of the value of fiction?" Sie ist ihm immer einen Schritt voraus - spielt mit ihm und bringt ihn zugleich mit ihrer Offenheit aus dem Konzept. Ganz das Gleiche macht Yamamoto mit uns LeserInnen: "The Stories of Ibis" ist eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten, die - bis auf die beiden letzten - zwischen 1997 und 2005 in verschiedenen Medien veröffentlicht wurden und die der Autor nun in unwahrscheinlich eleganter Weise in eine neue Rahmenhandlung eingebaut hat. Dabei legt er ihren Ursprung offen, indem er Ibis stets zwischen der Handlungszeit der Erzählungen und dem Jahr, in dem sie geschrieben wurden, unterscheiden lässt - letzteres natürlich stets das Jahr, in dem er sie selbst veröffentlicht hat. Er geht sogar soweit, dass Ibis ihren Zuhörer sanft auf einige Denkfehler aufmerksam macht, die Yamamoto einst begangen hatte. Und wenn es am Ende doch noch dazu kommt, dass Ibis die wahre Geschichte von Menschen und KIs erzählt, dann werden sich in dieser weltbilderschütternden Eröffnung aus allen fiktiven Episoden einige Elemente wiederfinden. Vor solch eleganter Konstruktion kann man echt nur den Hut ziehen!
Die Stories 4 und 5 sind etwas dunkler getönt: In "Black Hole Diver" vertreibt sich die KI einer Raumstation, die um ein Schwarzes Loch kreist, die Zeit damit, ihre hyperschnellen Gedankengänge in langsame menschliche Prosa zu übersetzen (ebenjene Prosa, die wir in Form des Buchs vor Augen haben; einmal mehr thematisiert Yamamoto den Akt des Erzählens an sich). Besuch erhält sie von einer jungen Frau, die endlich ein echtes Abenteuer erleben will, während sich draußen in der Galaxis Zivilisation um Zivilisation in virtuelle Welten zurückfallen lässt. - Das Schulmädchen Saika wiederum, die Protagonistin von "A World Where Justice Is Just", hat eine Online-Freundin in einer anderen Welt. Für Saika ist das nichts Besonderes: Für sie gehört es zum Alltag, dass BesucherInnen aus anderen Welten einfach so in der ihren aufpoppen - ebenso wie Monster und Riesenroboter, gegen die Saika und ihre Klasse als Power Rangers-artige HeldInnen in den Kampf ziehen. Nur die Nachrichten von ihrer Online-Freundin klingen seltsam, erzählen von Biokrieg, Genozid und a tragic world with no heroes and no reset.
Die vielleicht beste von sieben bzw. eigentlich acht hervorragenden Geschichten, "The Day Shion Came", kommt gänzlich ohne Action-Feuerwerk aus. Im Mittelpunkt steht Kanbara, Pflegerin in einem Rehabilitationszentrum für alte Menschen. Kanbara wird von der Heimleitung mit der Aufgabe betraut, die brandneue, mit lernfähiger KI ausgestattete Pflege-Androidin Shion in die Praxis einzuführen - und erkennt rasch, dass sie ihr auch beibringen muss, wie man ein "Herz" bekommt. Der Lernprozess, der Shion zu einigen erstaunlichen Einsichten gelangen lässt, erinnert in seiner Beschreibung an die Romane eines David Marusek - und an einen anderen großen Autor unserer Tage: Passagen wie "A human would have been embarrassed, but Shion just returned a vague smile. Her default expression." haben die lakonische Brillanz eines Ted Chiang. Letztlich findet Shion zu einer Formel für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Maschine, die ebenso unerwartet wie effektiv ist - und für die Menschheit alles andere als schmeichelhaft.
Womit wir bei Ibis' siebenter Geschichte und damit der Wahrheit angelangt wären - die hier selbstverständlich nicht verraten wird. Nur einige formale Anmerkungen: "AI's Story" mündet auch in eine stilistische Klimax, denn die darin vorkommenden KIs kommunizieren in einer Mischung aus Neologismen, metaphorischen Ausdrücken, Hyper-Links und Emphase-Angaben mit Hilfe imaginärer Zahlen - alles, um eine breitere Palette an Gefühlen ausdrücken zu können als Menschen und um eine optimale Kommunikation ohne Gefahr von Missverständnissen zu schaffen. Garniert wird das Ganze wieder mit reichlich Martial Arts, die sich zum Teil in einer zweifach virtuellen Welt, zum Teil aber auch mitten im Shibuya der realen Welt abspielen. Womit zugleich der Bogen zum Anfang des Romans geschlagen ist. Perfekt. "The Stories of Ibis" ist ein großartiges Buch - umso mehr, als es eine Message transportiert, die dem alten Frankenstein-Motiv, das die Science Fiction doch so wesentlich mitgeprägt hat, etwas ganz Anderes entgegen hält.

Simon R. Green: "Krieg der Wächter"
Broschiert, 573 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2010.
Das Startfeld der Urban Fantasy, auf dem beherzte ErmittlerInnen gegen übernatürliche Wesen antreten, ist so dichtgepackt wie die Liegeplätze am Strand von Rimini. Da muss sich schon jeder ganz genau seine Nische ausklügeln - und beim britischen Autor Simon R. Green lautet sie: Bond. Shaman Bond. Das ist nämlich das berufliche Pseudonym von Greens Schöpfung Eddie Drood, Jäger von so ziemlich allem, was die Phantastik zu bieten hat. Green hat seine Bond-Romane mit zahlreichen Anspielungen auf Eddies (vorerst noch) berühmteren Landsmann James gespickt. Das beginnt schon bei den Titeln, die sich allesamt an 007-Filmen orientieren, was in der deutschen Ausgabe allerdings verloren ging: "Krieg der Wächter" hieß im Original "Daemons Are Forever", beim Vorgängerband "Wächter der Menschheit" war's "The Man with the Golden Torc". Wer weiß, was die in England mittlerweile sehr erfolgreiche Serie in Zukunft noch bringen wird. Vielleicht "Golemeye". Oder "Orkopussy". - Oh, apropos: Da ergötzt man sich allmonatlich daran, wie herrlich pervers das Bizarro-Genre ist, und dann trudelt das Buch mit dem ekeligsten Titel des Jahres über die Mainstream-Rubrik "Freche Frauen" ein (also da, wo es im Schnitt darum geht, wie man hach so kokett den Ehemann zum Geschirrspülen bringt und währenddessen einen Seitensprung mit einem sexy Vampir hat): "Die Schokospalte". Bäääääääh!
Anstelle eines Aston Martin fährt Eddie ein Bentley-Cabrio: Das ist gleichermaßen kugel- wie zauberspruchsicher und nicht nur mit MGs und Flammenwerfer, sondern auch mit einem Overdrive-Gang ausgestattet, mit dem es durch Dimensionsbarrieren brettert: Verschiedene Welten dopplerten an uns vorbei, als ich in die Eisen stieg. Und wo James von Q eine Standpauke gehalten wird, wenn er einen Kratzer auf einer von dessen Erfindungen verursacht hat, wird Eddie vom Waffenmeister der Familie Drood - seinem Onkel Jack - gescholten. Qs Werkstatt sorgt in den Bond-Filmen stets für die besten Gags, verblasst aber neben dem knalligen Absurditäten-Kabinett, das in der Droodschen Waffenmeisterei zusammengebastelt wird: Von der Seuchenspraydose über eine Atom-Wurfgranate bis zum Gewehr, das Schwarze Löcher verschießt, ist hier alles enthalten. Nicht zuletzt auch ein Zeitzug, der im weiteren Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen wird. Nur die Torques - unverwüstliche metallische Schutzhüllen, die ihren TrägerInnen übermenschliche Kräfte verleihen - sind kein Eigenbau, sondern waren das Geschenk eines außerdimensionalen Spenders. Gleich die erste Kampfszene im Roman zeigt, dass britisches Understatement hier nicht angesagt ist: Eingepackt in seine silberne Rüstung fängt Eddie eine Rakete mit der bloßen Hand und lässt einen Hubschrauber an seiner Brust explodieren; da hätte sogar der Hulk ein wenig gewackelt.
Die Organisation, für die Eddie arbeitet, ist seine eigene mehrtausendköpfige Familie - und die bildet seit Menschengedenken die letzte Verteidigungslinie gegen unirdische Umtriebe. Ihr Wahlspruch: "Wir halten nichts von zweiten Chancen." Das Droodsche Hauptquartier liegt in einem riesigen Tudor-Herrenhaus, das mit einem hypermodernen Kontrollraum und aberwitzigen Verteidigungsmechanismen ausgestattet ist - bei einem Angriff aus der Hölle heißt es da schon mal: "Macht euch bereit, die Rasensprenger auf Weihwasser umzustellen!" Vorstellen kann man sich das Ganze in etwa wie eine Mischung aus MI6 und Wolfram & Hart - inklusive der ethischen Komponente. Denn im Vorgängerband musste Eddie erst mal die Familienhierarchie durcheinanderwirbeln, nachdem er entdeckt hatte, dass die Droods trotz ihres Anspruchs, Hüter der Menschheit zu sein, selber ordentlich Dreck am Steck hatten. Vom Frontagenten zum neuen Familienoberhaupt aufgestiegen, bläut er ihnen nun die Rückbesinnung auf alte Tugenden ein, unterstützt von zwielichtigen, aber kompetenten "TutorInnen" wie einem unsterblichen Jack the Ripper. Nebenbei bemerkt liebt der Autor Anspielungen auf andere Werke: Verweise auf Lovecraft und "Wild Wild West" hat Green ebenso im Repertoire wie Querverbindungen zu seinen eigenen "Nightside"- und "Deathstalker"-Serien.
Da sich die Familie nach dem internen Führungswechsel noch in Schockstarre befindet, steht zu befürchten, dass sich Feinde der Menschheit (davon hat sie, ohne es zu ahnen, reichlich) das Machtvakuum zunutze machen könnten. Ein Präventivschlag muss her, um zu demonstrieren, dass man noch da ist. Hier liegt die einzige gröbere Logikschwäche des Romans vor: Denn just der leichte Aufbaugegner, den man sich zufällig aus dem Angebot herauspickt, erweist sich als Wegbereiter für eine Lovecraftsche Invasion aus Höheren Sphären. Glück gehabt! - Aber egal, Hauptsache, es gehen endlich die Kloppereien los, die "Krieg der Wächter" um einiges actionreicher machen als den Vorgängerroman. Greens Sinn für schwarzen Humor äußert sich dabei in einer wilden Mischung aus beuschelreißenden Gemetzeln jenseits aller Vernunft und Relation und einem Spaßfaktor hart am Rande der Persiflage. Diese Mixtur macht den wichtigsten Faktor in der Erfolgsformel der "Secret History"-Reihe aus, deren fünfter Teil bereits in Vorbereitung ist (auf Deutsch erscheint Ende November Teil 3: "Der Spion, der mich jagte"). Und dass die Reihe schon so lange läuft, liegt natürlich auch daran, dass sich Green zwecks Abwechslung keinerlei Genre-Beschränkungen auferlegt: Viel Feind, viel Ehr' - seien es Dämonen, Aliens, Gespenster, Elben oder die Privatarmeen Bondscher Erzschurken. Kein Fall ist zu schwer - und vielleicht klären die Frontagenten der Droods eines Tages sogar auf, wer da aus dem deutschen ÜbersetzerInnen-Duo unter einer erheblichen das/dass-Schwäche leidet.
Einen wesentlichen Unterschied zwischen Eddie und James Bond gibt es letztlich aber doch: Anders als 007 hat sich Eddie nämlich inzwischen in einer echten Beziehung wiedergefunden - und zwar mit der wilden Waldhexe Molly Metcalf, die ebensowenig zweisamkeitstauglich erscheint wie Eddie selbst. Einst stand sie auf der Seite des Bösen (und zum zarten Pflänzchen ist sie auch nach ihrer Bekehrung nicht mutiert) - doch jetzt bilden die beiden eine fest zuschlagende Einheit: "Ich werde deine Pornografie sein." - "Und da sagen die Leute, heutzutage gäbe es kein romantisches Gesäusel mehr."

Karl Schroeder: "Säule der Welten"
Broschiert, 450 Seiten, € 9,20, Heyne 2010.
Wem für sein Werk Larry Niven, Stephen Baxter und Vernor Vinge Rosen streuen, der hat in Sachen Worldbuilding ganz offensichtlich einiges geleistet. Kurz zur Erinnerung, weil's schon einige Zeit her ist, dass ich Teil 1 von Karl Schroeders "Virga"-Zyklus besprochen habe, damals noch anhand der Originalausgabe "Sun of Suns": Virga ist ein mehrere 1.000 Kilometer durchmessender Fulleren-Ballon, der irgendwo im Weltall schwebt. In seinem luftgefüllten, aber schwerelosen Inneren drehen sich zahllose Kleinhabitate, beschienen von künstlichen Sonnen wie dem Zentralgestirn Candesce und dessen kleineren "Schwestern". Von diesen abgesehen bewegt man sich in Virga auf vergleichsweise niedrigem technischen Niveau; Verbrennungsmotoren sind so ungefähr das avancierteste, was man aus der glorreichen Vergangenheit noch kennt. - Gleichzeitig ist Virga eine Art Reservat, in dem Menschen noch ganz im "alten Stil" leben können; unbehelligt vom alles nivellierenden virtuellen Paradies der posthumanen Gesellschaft außerhalb des Ballons. Die Bedrohung durch diese Künstliche Natur bildet einen Hintergrund, den man nie vergessen sollte - auch wenn er in Teil 1 (auf Deutsch: "Planet der Sonnen") eine größere Rolle spielte als hier.
Wie das Worldbuilding in konkrete Handlungsabläufe einfließt, demonstriert gleich die Eröffnungspassage aufs Schönste: Die Adelige Venera Fanning, die sich am Ende von "Sun of Suns" trotzig ins schwerelose Nichts gestürzt hat, befindet sich im unkontrollierten Anflug auf eines von Virgas Habitaten. Spyre, ein kilometerlanger rotierender Hohlzylinder, ist ein Relikt aus Virgas Anfangsjahren und wird heute nur noch von Spucke und viel gutem Willen zusammengehalten. Als Venera wie eine Hornisse durch den Zylinder schießt, gibt der gealterte Gigolo Garth Diamandis die freundliche Spinne und spannt für sie ein Fangnetz auf. Später wird er Venera erklären, dass sie nur eine Chance von 1:1.000.000 hatte, lebend durch die Minen- und Stacheldrahtwolken zu kommen, mit denen sich Spyre von der Außenwelt abgeschottet hat. Aber von Terry Pratchett wissen wir ja, dass bei der Quote gar nix schiefgehen kann ...
Da sitzt sie also nun auf Spyre fest und wundert sich darüber, dass sie hier so weit wie nie zuvor in ihrem Leben zu Fuß in eine Richtung gehen kann - viel mehr noch aber über die politischen Verhältnisse auf Spyre. Denn Schroeder setzt die Zersplitterung Virgas in fraktaler Weise fort: Spyre ist trotz seiner überschaubaren Größe in unzählige Duodezfürstentümer zerfallen - und jedes der winzigen Anwesen hat sich auf eine Export-Marktnische spezialisiert, die es ebenso eifersüchtig hütet wie seine Grundstücksgrenzen. Jede Nation führte genau Buch darüber, wer wen wann beleidigt hatte. Nichts wurde vergessen, und hinter moos- und efeubewachsenen Mauern schmiedeten Monarchen und Präsidenten von Staaten, die kaum größer waren als ein Swimmingpool, ihr Leben lang Rachepläne. Die neurotischen BewohnerInnen Spyres und ihre unverständlichen, nach innen gerichteten Bräuche wirken ebenso pittoresk wie tragisch. Und innerhalb der übervölkerten Mini-Domänen setzt sich das Ganze noch einmal fort: Jeder lebt in seiner engen, mit Andenken vollgestopften Nische.
Karl Schroeder hat für Teil 2 seiner famosen Reihe einige ungewöhnliche Entscheidungen getroffen. So manche LeserInnen mag es enttäuschen, dass er die gefühlte Unendlichkeit Virgas nun durch das genaue Gegenteil ersetzt. Immerhin hatte es großen Reiz, Jules-Verne-mäßig durchs "All" zu fliegen - ohne Vakuum, kosmische Strahlung, Relativität, riesige Entfernungen und den ganzen anderen komplizierten Mist. In Teil 1 flogen noch Schiffe, kerosinbetriebene Bikes und Menschen mit Fußflossen zwischen rotierenden Städten und kugelförmigen "Seen" herum - jetzt finden wir uns in einer beinahe irdischen Umgebung wieder. Beinahe, denn in einer Welt, die Schwerkraft nur als Folge von Rotation kennt, stellt diese keine Konstante dar - was auch Begriffe wie "oben" und "unten" variabel macht. Man mag "Säule der Welten" Steampunk nennen, doch ist es Steampunk in drei Dimensionen. Und immer noch gilt: Virga ist keine Welt für Leute, die nicht schwindelfrei sind.
Schroeders zweiter unerwarteter Schachzug war es, seine Reihe nicht mit dem Helden aus Teil 1, sondern mit einer Nebenfigur fortzusetzen. Noch dazu einer, die man schwerlich als Sympathieträgerin bezeichnen konnte. Eher schon präsentierte sich Venera Fanning als Mischung aus Machiavellis "Fürst" und Patricia Highsmiths "Tom Ripley"; Leichen pflasterten ihren Weg. Auf die BewohnerInnen Spyres macht sie zwar immer noch einen einschüchternden Eindruck, wenn sie ... konsequent ... daran geht, sich eine gesellschaftliche Machtposition zu sichern, um den Abflug aus Spyre zu schaffen. Doch erhalten wir nun zwangsläufig Einblicke in ihre Psyche - und siehe da: Die Frau, die in Teil 1 noch aus Teflon zu bestehen schien, offenbart einige ungeahnte Unsicherheiten. Als ironischen Schlusspunkt ihres bisherigen Weges, der stets von Rachemotiven geleitet war, wird Venera hier auch etwas erfahren, wonach sie ein Leben lang vergeblich geforscht hat: Nämlich wo einst die Kugel abgeschossen wurde, die vor langer Zeit durch halb Virga sauste, ehe sie zufällig Venera traf und sie von einer Bilderbuch-Prinzessin in eine schmerzgepeinigte Frau ohne Mitgefühl und Skrupel verwandelt hat. Selten war eine Wahrheit so ernüchternd.
Ungeklärt bleibt indessen, woher der Ken-Follett-artige Titel der deutschen Ausgabe angeflogen kam. Im Roman gibt es absolut nichts, was eine "Säule der Welten" sein könnte - ebensowenig wie im Vorgänger "Planet der Sonnen" einen Planeten. Im Original heißt der Roman "Queen of Candesce", was in seiner Handlung gut verankert ist. - Aber was soll's: Teil 3, "Segel der Zeit" (öhem; auch als "Pirate Sun" bekannt) ist für April angekündigt: Angesichts von Schroeders herrlicher Fabulierkunst ein Anlass zur Vorfreude. Ich schließe mich einfach den Worten Venera Fannings an: "Absurd! Ich will mehr hören."

Dru Pagliassotti: "Das mechanische Herz"
Broschiert, 510 Seiten, € 15,40, Feder & Schwert 2010.
Noch einmal Steampunk - diesmal aber ohne Einbettung in einen Science-Fiction-Rahmen, sondern der pure Stoff. Ondinium heißt die Schöpfung der in Kalifornien lebenden Uni-Professorin Dru Pagliassotti und präsentiert sich als Stadt der Paläste und Raffinerien, der Gelehrtentürme und Fabriksschlote. Wie ein metallenes Spinnennetz ziehen sich die Kabel von Ondiniums Drahtfährenbahn die Hänge des Berges Oporphyr hoch, in dessen Innerem - quasi symbolhaft für das ganze Genre - das mechanische Herz der Stadt schlägt: Ein gigantischer schwebender Komplex aus Kolben und Zahnrädern, in dem unaufhörlich Simulationsprogramme von Ressourcenströmen, Wetterprognosen und sozialen Trends laufen. Für sich schon ein beeindruckendes Bild - umso mehr, wenn in weiterer Folge zwischen den titanenhaften Windungen der Maschine waghalsige Flugmanöver stattfinden werden.
Endlich mal nicht London als Schauplatz eines Steampunk-Romans! Auch wenn der Name der Stadt zugegebenermaßen nicht allzu weit vom lateinischen Ursprung Londinium entfernt ist (und im Roman diverse latinisierte Begriff auftauchen, die eine gedankliche Verbindung nahelegen). In der Romanwelt selbst ist der Name von Ondium abgeleitet: Einem Metall, das leichter als Luft ist und aus dem nicht nur die Maschine im Berg, sondern auch die Fluggeschirre der Ikarier gefertigt sind, einer der Kasten Ondiniums. Als geflügelte Boten und Einsatzkräfte können sie frei zwischen den übrigen stark voneinander abgegrenzten Kasten verkehren - die Erhabenen als Spitzen der Gesellschaft verpuppen sich sogar in Roben, Masken, Turmfrisuren und Unmengen von Klunkern, um Abstand zu niedriger Gestellten zu halten. Die Freimütigkeit der Ikarier - was den Gesprächston, Sex oder lockere Umgangsformen auch mit den Erhabenen betrifft - ist nebenbei bemerkt auch ein guter Trick der Autorin, LeserInnen der Gegenwart ohne große Hürden an das fremdartige Gesellschaftssystem heranzuführen; eine gewisse ironische Distanz bleibt immer gewahrt.
Hauptfigur des Romans, der im Original 2008 als "Clockwork Heart" erschien, ist die Ikarierin Taya. Gleich zu Beginn rettet sie eine Erhabene und deren Kind aus einer abstürzenden Drahtfährengondel - und so nach und nach muss sie zur Kenntnis nehmen, dass der vermeintliche Unfall ein Anschlag war. Damit gerät Taya in einen Polit-Krimi, im Zuge dessen sie zwei höchst unterschiedliche Brüder kennenlernt. Der joviale Erhabene Alister Forlore bekleidet ein hohes Amt, ist maßgeblich an der Programmierung der Großen Maschine beteiligt und insgesamt eine umwerfende Erscheinung. Sein älterer Bruder Cristof hingegen ist das schwarze Schaf der Familie: Weil ihm die Heuchelei des Kastenwesens zuwider ist, verdingt er sich im ärmsten Viertel der Stadt als Uhrmacher. Menschen gegenüber unbeholfen, wirkt er schroff und nervtötend, was seinem unscheinbaren Äußeren - Taya vergleicht ihn fortwährend mit einer Krähe - auch nicht gerade schmeichelt. Die Ikarier pfeifen's von den Dächern, wer von den beiden Taya unweigerlich mehr reizen wird ...
Es ist immer wieder verblüffend, wie etwas, das in einem Mainstream-Roman die stinknormalste Sache der Welt wäre, den Glanz des Faszinierenden erhält, wenn man nur aus der EDV das "E" für "elektronisch" rausnimmt und die ganze Chose mit Zahnrädern, Dampf und Lochkarten laufen lässt. Pagliassotti treibt dies in einer witzigen Passage auf die Spitze, in der sie ProgrammiererInnen darüber fachsimpeln lässt, wie sie an Lochkarten den "persönlichen Touch" von ArbeitskollegInnen ablesen können. Die märchenhaft weitergesponnene Rückbesinnung auf ein versunkenes Goldenes Zeitalter der Mechanik ist sicher einer der Schlüssel zum Verständnis der Popularität von Steampunk, aber nicht der einzige. Wenn das 18. und 19. Jahrhundert so etwas wie das Arkadien des Steampunk darstellen, dann sollte auch auf einige andere zeitgenössische Topoi nicht vergessen werden. Nicht von ungefähr trägt "Das mechanische Herz" auch klare Romantasy-Züge - und viel klassischer als eine Frau zwischen zwei Brüdern, einer davon ein gesellschaftlicher Misfit, geht's ja wohl kaum. Dass dem Konzept der romantischen Liebe ausgerechnet ein Programm zur optimalen Heiratsvermittlung gegenübergestellt wird, darf daher nicht verwundern. Und keine Angst: Das ist nur die oberflächliche Bedeutung des Titelbegriffs Das mechanische Herz - darunter schlummern viel weiter gehende Steuerungskonzepte. Schließlich wurden in der Ära, auf die sich der Steampunk so gerne bezieht, auch diverse -ismen geboren; und Taya wird bald selbst mit einem Gesellschaftskonstrukteur, wie sie es abschätzig bezeichnet, konfrontiert.
An den Hälsen der Reichen schillern Juwelen, auf den Gesichtern der ArbeiterInnen Ölschlieren - und über allen hängt als Zeichen des gemeinsamen Fortschritts eine Glocke aus Smog und Ruß. Pagliassotti lässt für Fans des Genres nichts zu wünschen übrig - außer vielleicht, dass alles einen Tick beschönigend gehalten ist. Von Armut und Elend als Kehrseite des industriellen Reichtums - auch das schließlich ein gängiges Motiv - ist hier jedenfalls nichts zu lesen, Ondinium wird abgesehen von einigen kleineren Schönheitsfehlern als Vorzeige-Modell präsentiert. - Dafür führt Pagliassottis grundsätzlich gutherzige Perspektive an anderer Stelle zu einer angenehmen Überraschung: Endlich macht sich mal jemand Gedanken um Redshirts! Zur Erklärung: Das sind Randfiguren - gerne Wachsoldaten und ähnliches -, die nur auftreten, um sogleich blutig abtreten zu dürfen; erzählerisches Kanonenfutter gewissermaßen. Müssen sich die HeldInnen von Filmen und Büchern ihrer Haut erwehren, steigen sie anschließend in aller Regel nonchalant über die Leichen hinweg - Taya hingegen bereitet es echte Gewissensbisse, jemanden getötet zu haben, auch wenn ihr keine Wahl blieb. Pagliassotti lässt Taya nach dem Namen ihres Opfers fragen und zu dessen Familie Kontakt aufnehmen - das tun wirklich wenige AutorInnen.
Insgesamt also ein beachtlicher Debüt-Roman - und auch wenn er nicht gerade in das größte Finale aller Zeiten münden mag, weckt er doch Appetit auf mehr: Weitere Erzählungen aus der originellen Welt von Ondinium wären eine gute Sache.

Sean Williams: "Blutschuld. Die Bücher des Kataklysmus 2"
Broschiert, 589 Seiten, € 14,95, Otherworld 2010.
Im ersten Band seiner "Bücher des Kataklysmus" (hier der Rückblick) verschmolz Sean Williams ganze Welten - jetzt geht er noch einen Schritt weiter und tut's mit Romanzyklen. Standen in Band 1 die "Spiegelzwillinge" Seth und Hadrian Castillo im Mittelpunkt, so heißen die jugendlichen ProtagonistInnen von "Blutschuld" (2005 als "The Blood Debt" erschienen) Sal Hrvati, Shilly von Gooron und Skender Van Haasteren. Da wird's vermutlich bei nicht allzu vielen klingeln, denn dies sind die Hauptfiguren einer älteren Trilogie von Sean Williams, den "Books of the Change" - und die sind nie auf Deutsch erschienen. Tatsächlich werden sich LeserInnen der "Books of the Change" sehr viel schneller in "Blutschuld" zurechtfinden als die der "Spiegelzwillinge", welche sich erst mal fragen müssen, wo denn ihre ganzen Hauptfiguren abgeblieben sind. Ein Tipp: Am besten die Reset-Taste drücken und bei Null beginnen. Beinahe jedenfalls.
Seit dem Kataklysmus, der unser Zeitalter beendet hat, ist ein unbestimmter, aber sehr langer Zeitraum verstrichen - und die Welt hat zu einer neuen Stabilität gefunden. Eine, in der die Veränderung (nennen wir's einfach Magie) zu einer neuen Konstante geworden ist, während sich andere Naturgesetze verabschiedet haben, seit die Städte fielen und der Strom ausging. Im Grunde wurde "eine Magie gegen die andere getauscht", wie es an einer Stelle heißt. Den Menschen dieser Ära ermöglicht dies ein Leben auf in etwa frühneuzeitlichem Niveau - inklusive vermeintlich anachronistischen Versatzstücken aus der Ära der Technik. Doch steigt ein Protagonist vom Kamel in den Geländewagen um, dann fährt der eben nicht nur mit Alkohol, sondern auch mit Veränderung. Veränderung kann auch den Mörtel zwischen den Steinen eines Verteidigungswalls bilden oder gar als Sonnenschutz-Zauber dienen (auf die Idee konnte vermutlich nur ein australischer Autor kommen ...). Entsprechend bedenklich ist es daher, wenn aus einem Zwischenöde genannten Limbus ein Wesen aufgetaucht ist, das durch die Lande wandert und in seinem Kielwasser jegliche Veränderung zum Erliegen bringt.
Auf dieses Wesen werden die magisch begabten Teenager Sal und Shilly angesetzt, denn die Schuld an der Misere trägt Sals leiblicher Vater: Er hat einen Homunkulus geschaffen, in dem er den Geist seiner verstorbenen Frau aus der Zwischenöde retten wollte - stattdessen ist offensichtlich etwas ganz anderes eingetroffen. - Parallel zur Verfolgung des Homunkulus macht sich der Magier-Schüler Skender, ein alter Freund von Sal und Shilly, auf die Suche nach seiner verschollenen Mutter. Als Vermesserin durchstöbert sie seit Jahren die Ruinen des früheren Zeitalters, doch ist sie von ihrer letzten Mission nicht zurückgekehrt. Beide Handlungsstränge werden in der Stadt Laure zusammengeführt, die an der Kluft liegt, einem gigantischen und auf unnatürliche Weise entstandenen Grabenbruch, der Skenders Heimat Hinterland von der Küstennation Gestade trennt, in der Sal und Shilly vor einigen Jahren Zuflucht gefunden haben.
Daran sieht man schon, dass Williams ein wesentliches Strukturelement aus den "Spiegelzwillingen" übernommen hat, nämlich das Spiel mit Dualitäten und Parallelitäten: Hinterland und Gestade, deren jeweilige magische Konzepte, die im einen Fall auf Erde und Feuer, im anderen auf Luft und Wasser basieren, die Suche nach einem Elternteil und die Mann-Frau-Konstellation der beiden Suchteams: Sal und Shilly sind seit den "Books of the Change" ein Paar und Skender bekommt nun in Gestalt des Bergarbeitermädchens Chu einen weiblichen Widerpart an die Seite gestellt. Nur eine Dualität lässt Williams dankenswerterweise aus: eine plumpe Gegenüberstellung von Gut und Böse. Stattdessen setzt er auf glaubwürdige Charaktere mit Ecken und Kanten - am besten ausgeführt in Chu. Sie ist ehrgeizig (weil stets mit der Angst im Nacken, vor dem Nichts zu stehen) und berechnend, dabei aber auch ehrlich: Von Anfang an sagt sie Skender klipp und klar, dass sie ihn für ihre Zwecke benutzen will. Und was die Berechnungen anbelangt - die werden mit der zunehmenden Turbulenz der Ereignisse ohnehin über den Haufen geworfen. Dass Sal und Shilly nicht ganz so plastisch rüberkommen, liegt daran, dass sie schon reichlich Vorgeschichte in den "Books of the Change" haben und diese leider vom Autor vorausgesetzt wird. Der Handlung von "Blutschuld" kann man problemlos folgen, ohne diese gelesen zu haben. Doch wird immer wieder auf frühere Erlebnisse verwiesen, die für die charakterliche Entwicklung von Sal und Shilly entscheidend waren (etwa was ihre unterschiedliche Wertung des Begriffs Familie betrifft) - das muss man sich dann halt irgendwie zusammenreimen.
Wie gesagt: Die Welt hat zu einer neuen Stabilität gefunden, die Handlung läuft dementsprechend deutlich linearer ab als im fantastischen Chaos der "Spiegelzwillinge" - einzig die sphinxhaften Menschähnlichen, belebte Statuen und Büsten, erinnern mit ihrer Fähigkeit, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zugleich zu sehen, noch an den Kataklysmus, als Raum, Zeit und Kausalität auseinander brachen. Anstelle kollidierender Welten stehen nun Wüstensafari und Häuserkampf an, statt dem Kampf veritabler Gottheiten müssen sich die ProtagonistInnen nun mit "Mad Max"-artigen Banditen herumschlagen. Das mag manchen LeserInnen im Vergleich ein wenig dünn vorkommen - in etwa wie die Befreiung des Auenlands, nachdem Sauron bereits gefallen ist. Oder besser vielleicht - nachdem sich "Die Spiegelzwillinge" ja als Fern-Prequel entpuppt hat - so, als hätte man eine (leider nie geschriebene) ausführliche Version vom Untergang Almarens und der Zerstörung der Großen Lampen gelesen, um dann unversehens zu Bilbos Geburtstagsfest umzublenden.
Nichtsdestotrotz: Williams mag das Effekt-Feuerwerk stark heruntergefahren haben, glänzt aber immer noch mit einer spannenden Erzählweise und originären Schöpfungen von hoher Bildhaftigkeit: Seien es die fliegenden Bergleute von Laure, die mit Hängegleitern Artefakte aus der Kluft bergen - sei es der Staubwolken aufwirbelnde Massenexodus der Menschähnlichen, deren Wanderung die BewohnerInnen Laures in Panik versetzt. Daher noch einmal: Reset-Taste drücken. Nach dem in der Tat kataklysmischen Tempo von Teil 1 schreiten die weiteren Bände nun in herkömmlicher Trilogie-Geschwindigkeit voran. Aber immer noch in die richtige Richtung.

Michael Cobley: "Die Saat der Erde"
Broschiert, 620 Seiten, € 10,30, Heyne 2010.
Mitunter wundert man sich, welche Bücher Klappentext-VerfasserInnen anstelle derjenigen gelesen haben, auf denen sie ihre Zusammenfassungen platzieren. Also: Die Erde wurde nicht durch einen Alien-Angriff zerstört, und die drei entkommenen Kolonieschiffe hatten daher auch nicht die letzten Überlebenden an Bord. Würde irgendwie auch die gesamte Handlung zunichte machen, schließlich dreht sich in Michael Cobleys "Die Saat der Erde" ("Seeds of Earth", Start der Trilogie "Humanity's Fire") alles darum, wie Mutter Erde zu ihren verlorenen Kindern wieder Kontakt aufnimmt. 150 Jahre sind seit der Attacke vergangen und die an Bord des Raumschiffs "Hyperion" Geflohenen haben sich auf dem Planeten Darien und dessen bewaldetem Mond eingerichtet. Sie teilen sich das System mit den eingeborenen Uvovo - was die interessanteste Idee des Romans ist, auch wenn sich manche an die Na'vi aus "Avatar" erinnert fühlen mögen. Denn auch die friedliebenden Uvovo leben in Harmonie mit ihrem dschungelhaften Ökosystem, das über eine Kollektivintelligenz namens Segrana verfügt, die an Gaia (oder Eywa) denken lässt. Doch schlummert tief unter dem Waldboden auch das Erbe einer hochtechnologischen Vergangenheit der Uvovo.
Die Koexistenz zweier so unterschiedlicher Kulturen und die aus der Not geborene Rückbesinnung der Uvovo auf ein Zeitalter des Kampfes bilden einen der Handlungsstränge des Romans. Die beiden ForscherInnen Greg Cameron und Catriona Macreadie befassen sich beruflich mit der Kultur der Uvovo, der Uvovo-Gelehrte Chel unterstützt sie dabei - zumindest solange, bis er abberufen wird, um sich zu verpuppen und in ein neues körperliches und geistiges Stadium einzutreten. Robert Horst, Botschafter der Erde, wird später, ganz zu seiner Überraschung, auch noch zu den Personen gehören, die die stark metaphysisch geprägte Kultur der Uvovo hautnah erleben dürfen. - Das hätte schon Stoff genug für einen Roman abgegeben, doch wirft der Autor noch einiges mehr auf den Haufen. Mit den Gesandten der Erde schwirren nämlich nach und nach auch diverse außerirdische Kolonialmächte in spe ein, die sich für Darien interessieren. Es kommt zu Intrigen, Attentaten - und in Folge dessen zu reichlich Aufklärungs- und Kampfeinsätzen, in denen vor allem der alte Haudegen Theodor Karlsson, Gregs Onkel, so richtig auflebt. Durch die Vielzahl an kapiteltragenden Personen sind 100 Seiten vergangen, bis die erste von ihnen zum zweiten Mal an die Reihe kommen darf. Und kaum wurde das gesamte Ensemble endlich zusammengeführt, da blendet Cobley total um und führt mit Kao Chih eine ganz neue Hauptfigur ein: Letzterer ist der Nachkomme von Passagieren eines Schwesterschiffs der "Hyperion", die inzwischen weit entfernt als Hilfskräfte eines weiteren Alien-Volks schuften. Weil auch dieses von der Wiederentdeckung Dariens gehört hat und seinen Teil vom Kuchen möchte, wird der junge Kao Chih als Botschafter auf die Reise geschickt.
Müsste man "Die Saat der Erde" in einem Satz zusammenfassen, würde er lauten: Weniger wäre mehr gewesen. So hilflos, wie die Bevölkerung Dariens der plötzlichen Info-Flut über ihre kosmische Nachbarschaft ausgesetzt ist, so erbarmungslos geht auch über den Köpfen der LeserInnen ein nicht enden wollendes Trommelfeuer von Namen und Begriffen nieder. Cobleys Galaxis wimmelt nur so vor raumfahrenden Spezies, die zudem allesamt reichlich hölzern wirken. (Aber warum sollte es ihnen auch besser gehen als den Menschen? Die "Hyperion"-KolonistInnen stammen zu gleichen Anteilen aus Russland, Skandinavien und Schottland. Also sagt ständig irgendwer "Aye", und Skandinavien dürfte Cobley, der selbst in Schottland lebt, das letzte Mal besucht haben, als man noch Helme mit Hörnern trug.) Die diversen Aliens leben in Staatsgebilden, die sich bombastisch XY-Hegemonie, YZ-Solidarität, ZX-Synergie oder XYZ-Zyklarchie nennen. Ein bisschen so wie in einer Soap, wo bloß keine zwei Personen denselben Vornamen tragen dürfen ... damit man sie wenigstens irgendwie unterscheiden kann. Und läuft die Soap lange genug, sind alle griffigen Namen halt vergeben und es betreten die Korbinians und Raffaelas die Szene. Dito die Amtsbezeichnungen außerirdischer Potentaten: Was dem einen sein Castigator, ist dem andern sein Compositor, Estimator oder Oberarbogator. Menschen über 30 mögen sich dabei an einen der "Otto"-Filme erinnert fühlen ("Amboss! Amboss!"). Insgesamt verbreitet das Wording den klobigen Charme der 60er Jahre, was durch eine sperrige Sprache wie Deutsch auch nicht eleganter wird. Ist "getunt", im Roman ein Synonym für genmanipuliert, wirklich die eingedeutschte Variante von "tuned"? Der Satz "Catriona war eine gescheiterte Getunte" hat's jedenfalls in sich.
Pseudo-Techno-Babbel à la querfraktulierte Schutzschirme (???) kennt man auch von "Star Trek" & Co - hier erfüllt er aber eine weitere Funktion: Nämlich zu verschleiern, dass "Humanity's Fire", Weltraum hin oder her, als Space Opera durchgehen kann, genauso sehr aber auch der Fantasy zuzurechnen ist - also dem Genre, aus dem Cobley eigentlich kommt. Und das betrifft gar nicht allein die schon an der Oberfläche sichtbaren Handlungselemente wie die zahlreichen rational nicht erklärbaren (und auch nicht zu erklären versuchten) Fähigkeiten der Uvovo, ihre mythisch verbrämten Erzählungen von einem zigtausende Jahre zurückliegenden Krieg oder das metaphysische Wirken des Waldgeists Segrana. Auch der Plot-Aufbau selbst hat viel mit Fantasy-Trilogien gemeinsam: Da wäre die Bedrohung aus ferner Vergangenheit, die sich nun wieder regt, was die Uvovo in den tieferen Sphären des Hyperraums - oder auch den Unterreichen der Wirklichkeit - spüren. Da wäre das mächtige Artefakt, das einst unter einem Tempel verborgen wurde, und das als einziges Mittel den Feind aufhalten kann. Da wäre die Berufung einiger Auserwählter durch übernatürliche Mächte. Und da ist das Gut-Böse-Schema mit Künstlichen Intelligenzen als Schurken: Die KIs der Romangegenwart wurden zwar von völlig anderen Zivilisationen hervorgebracht als ihre zerstörerischen Pendants vor 100.000 Jahren - aber über irgendeinen im Hyperraum angesiedelten Zusammenhang scheint die Existenzform KI - von den Uvovo Traumlose genannt - per se eine heimtückische Macht zu sein.
Mit Blick auf die Mainstream-Fantasy unserer Tage und etwas Polemik könnte man meinen, dass Cobley noch zwei weitere ihrer Charakteristika ins neue Genre übertragen hat: Erstens den Déjà-vu-Effekt, dass man glaubt, das alles schon mal bei jemand anderem gelesen zu haben. Zweitens und vor allem aber die LÄNGE. 640 Seiten ist "Die Saat der Erde" lang und kommt danach - weil von Anfang an als Teil einer Trilogie angelegt - nicht mal ansatzweise zu einem Abschluss. Wie der Umfang zustande kommt, ist leicht nachzuvollziehen: Cobley schildert jede Teilepisode Länge mal Breite, kombiniert stets mit oben erwähnter Überfrachtung von Namen und Begriffen, die dem Geschehen wohl räumliche und historische Tiefe verleihen sollen. Bestes Beispiel ist Kao Chihs Odyssee von seiner Heimat nach Darien. In für die Rahmenhandlung völlig bedeutungslosen Episoden wird Kao Chih wie ein Wanderpokal zwischen Kriminellen, Revolutionären und religiösen Fanatikern weitergereicht. Kein Problem, wenn "Die Saat der Erde" Kao Chihs Roman wäre - doch lässt man sich auf eine Figur, die ihren ersten Auftritt erst nach 160(!) Seiten hat, wirklich noch so geduldig ein, als wäre sie von Anfang an die Hauptfigur gewesen? Oder denkt man nicht eher: Junge, komm mal langsam in die Hufe - du solltest längst auf Darien sein, dort spielt die Musik.
Natürlich haben auch ausufernde Weltraum-Geschichten ihre Fans - siehe Iain Banks oder Peter F. Hamilton. Bloß hat Banks mehr Witz (und zwar gewollten), und Hamilton ist ein weit besserer Erzähler. Bei Cobley hingegen geht auch hier die Info-Keule nieder. Wenn Erd-Botschafter Robert Horst wehmütig an seine Tochter zurückdenkt, bleibt nichts vorerst ungesagt, kein Freiraum, in dem der Leser seine Fantasie spielen lassen könnte, was denn wohl passiert sein mag, kein behutsamer Aufbau einer Stimmung, die uns fesselt und erst später durch Erklärungen ergänzt wird. Stattdessen wird - als hätten wir den Text-Link "Rosa Horst" angeklickt - sofort die Hintergrundgeschichte vom tochterlichen Tod abgespult; auch hier wieder mit zahlreichen Begriffen aus der Cobleypedia garniert. - "Die Saat der Erde" ist der richtige Roman für alle, die sich gerne zudröhnen lassen. Es passiert dauernd was - aber ist es auch wichtig? Wem Teil 1 dieses Satzes vollkommen ausreicht, der kann sich den Jänner 2011 vormerken: Dann geht Cobley mit "Waisen des Alls" in die zweite lange Kreisbahn.

Eleanor Arnason: "Tomb of the Fathers"
Broschiert, 160 Seiten, Aqueduct Press 2010.
Nach Michael Cobleys unerwiderter Liebe zum Golden Age der Science Fiction jetzt zu einer Autorin, die diese Ära noch selbst miterlebt hat: Der vielseitigen Eleanor Arnason, Enkelin isländischer ImmigrantInnen in den USA (was sie wohl von Cobleys Pappmaché-Nordleuten hielte?). "Tomb of the Fathers" ist alles das, was "Die Saat der Erde" nicht ist - kurz, witzig und unterhaltsam. Im Mittelpunkt der Novelle steht mit Lydia Duluth eine Abenteurerin in mittleren Jahren, Ex-Revolutionärin und jetzt Mitglied des galaktischen Überlicht-Jetsets. Arnason hat verstreut über die vergangene Dekade bereits einige Lydia-Duluth-Kurzgeschichten geschrieben. Dass die Figur eine Vorgeschichte hat, merkt man in "Tomb of the Fathers" an einigen Stellen; Verständnisprobleme ergeben sich daraus allerdings keine.
Anstoß zum aktuellen Abenteuer gibt die Wiederentdeckung der Ursprungswelt der Atch, einem Nachbarvolk der Menschheit, die sich ihrerseits nach dem Öko-Kollaps der Erde über weite Teile der Milchstraße ausgebreitet hat. Im flugs gebauten Sternentor über der Atch-Welt, das den Flair einer Hotel-Lobby aus den 1970er Jahren verströmt, versammelt sich rund um Lydia ein buntes Erkundungskommando - ebenjenes, das auf dem Titelbild verewigt ist. Da wäre etwa ein alter Bekannter Lydias, der Tourismus-Manager Olaf Reykjavik, der trotz seines Namens pechschwarze Haut hat ... wie der größte Teil der Menschheit, inklusive der Adolf-Hitler-Hologramme in den zeitgenössischen Action-Thrillern (was nur logisch erscheint: der Orientale Jesus Christus mutierte in der Ikonografie ja auch zum Blondschopf). Begleitet wird Olaf von der genetisch aufgewerteten Pseudo-Äffin Geena Dent ... genau genommen eigentlich Vagina Dentata ("The flower I am named after is very lovely."). Dazu noch die Künstliche Intelligenz Mantis, die im Körper eines Metallinsekts steckt und Lydia mitunter an einen Hutständer erinnert, und Precious Bin, ein im Exil lebender Atch mit Faible für Marx & Engels.
Trotz dieser Beschreibung ist "Tomb of the Fathers" keine Gag-Parade. Arnason streut einfach von Zeit zu Zeit eine Pointe ein und pflegt dabei ihre Vorliebe für trockenen Humor. Der kommt besonders in den Zwiegesprächen zwischen organischen und künstlichen Intelligenzen zum Ausdruck, von denen sich Lydia sogar eine ins Gehirn implantieren ließ. Die KIs sind das selbstständig gewordene Erbe einer untergegangenen Zivilisation und bewahren seit langer Zeit bedrohte Spezies - wie unlängst auch die Menschheit - vor dem Untergang. Die Organischen interessieren sie, da sich diese als Produkte einer endlosen Folge "genetischer Unfälle" entwickelt haben und es dementsprechend an Perfektion mangeln lassen. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit den Emotionen, die die KIs mangels Körperchemie nicht nachvollziehen können. In der Symbiose mit TrägerInnen wie Lydia können sie sich in dem Punkt weiterbilden (und ähneln in diesem Prozess dem Androiden Data, sind allerdings weit entfernt von dessen Naivität) - aber auch die Menschen lernen über die Unterschiede zwischen Maschine und Maschine stets noch was dazu. Etwa wenn sich Lydia nach dem Status einer wandelnden Alarmanlage erkundigt: "Is it intelligent?" - "Yes, but it has narrow interests."
Mit der Unverkrampftheit der Hippie-Generation schildert Arnason, die mittlerweile auf die 70 zugeht, die Bisexualität Lydias und Olafs und schiebt ganz generell munter Gender-Grenzen hin und her - nicht von ungefähr ist sie Trägerin des "James Tiptree, Jr. Award". In der aktuellen Novelle äußert sich dies vor allem in der Gesellschaft der Atch, in der die Männer die Eier ausbrüten und die Frauen in den Krieg ziehen. Ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern schon auf dem Exilplaneten der Atch enorm, so hat er in der nun wiederentdeckten Heimatwelt groteske Ausmaße angenommen: So sehr haben sich die kriegs- und konkurrenzgeilen Amazonen auf den Kampf konzentriert, dass sie ganz auf die Aufzucht männlicher Nachkommen vergessen haben und sich jetzt nur noch klonen können. - Insgesamt kein Planet, auf dem Olaf ein neues Touristen-Resort einrichten würde, und erst recht kein Ort, an dem man gerne länger bleibt. Genau das blüht unserer Reisegruppe aber, als das Sternentor explodiert und sie auf der Planetenoberfläche festsitzen - möglicherweise für Jahrzehnte.
Bezeichnenderweise taucht hier nie das gängige Motiv vom Menschen, der in der feindlichen Wildnis zum Heroen oder Barbaren mutiert, auf - unsere mehr oder weniger wackeren Fünf machen nie einen anderen Eindruck als den von TouristInnen. Am Ende fragt sich Olaf, was sie aus dem Trip eigentlich gelernt haben - das bleibt offen, denn der Schluss ist zugegebenermaßen wenig berauschend. Nichtsdestotrotz wirkt "Tomb of the Fathers" auf seine kultivierte und ein wenig altmodische Weise erfrischend. Die angekündigte Story-Sammlung mit weiteren Lydia-Duluth-Abenteuern klingt daher nach Spaß. Und vielleicht verwirklicht Eleanor Arnason ja doch noch ihr im Nachwort erwähntes Projekt über eine Gruppe machtvoller Geister, die durch Raum und Zeit reisen und den verheißungsvollen Namen the Big Mamas tragen.
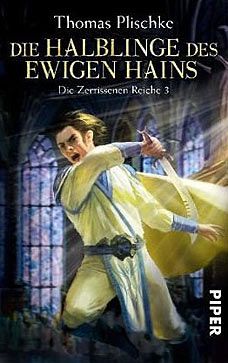
Thomas Plischke: "Die Halblinge des Ewigen Hains"
Broschiert, 454 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
"We're going to see the Elves!" jubelt Sam beim Aufbruch aus dem Auenland. Dass das bald auch in Thomas Plischkes "Chronik der Zerrissenen Reiche" anstehen würde, machte bereits die nach Süden auszoomende Weltkarte im Vorgängerband (hier der Rückblick) klar. Was Plischkes Romanfiguren dann tatsächlich zu sehen bekommen werden, wird die LeserInnen noch mehr verblüffen als sie. Die überraschende Optik ist aber nicht alles: Schon vor der Begegnung macht sich der Zwerg Garep Schmied so seine Gedanken, wie wohl der Charakter eines Volkes beschaffen sein muss, das andere so sehr einschüchtert, dass sich die Menschen demütigenden Begrüßungsformeln unterwerfen und sich als "Bittsteller" und "es" titulieren lassen. Die Antwort: Die Elfen scheinen wie Touristen aus einer wirtschaftlich und technologisch avancierteren Kultur zu kommen und die Welt der geringeren Völker als erfrischende Telefavela zu genießen. Kultur ist übrigens gar nicht das schlechteste Stichwort - Plischkes Elfen erinnern deutlich mehr an Iain Banks als an J.R.R. Tolkien.
Damit setzt der Autor das fort, was die "Chronik der Zerrissenen Reiche" von Anfang an auszeichnete: Eine klassische Fantasy-Ausgangslage samt deren Archetypen weiterzudenken und einer historischen Entwicklung zu unterwerfen. Bei den im "Dampfland" lebenden Zwergen bedeutete dies den Aufbau einer Industriegesellschaft im Stil des 19. Jahrhunderts. Wo Kaufhallen als Dampfmaschinen des Verbrauchsgüterhandels prunken und aus den Druckerpressen abwechselnd kitschige Romane, politische Pamphlete und sensationsgeile Schmierblätter quellen. Und wo der Sozialdarwinismus ebenso fröhliche Urständ feiert wie Drogenkonsum, Prostitution und Verbrechensserien; kein Wunder, dass sich die Elfen prächtig amüsieren. Gerne wird hinter Vorhänge geblickt - nicht umsonst bekennt Plischke im Nachwort, sich am viktorianischen Zeitalter orientiert zu haben - zu keiner Zeit war die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre strikter.
Plischke erzählt in launigem Ton vom prallen Leben zwischen Sex & Crime und Politik - er hat den Ton für seine Saga längst gefunden und weiter zurechtgefeilt. Dazu gehört auch das Bemühen, jedes Volk mit eigenen Redewendungen zu versehen: Halblinge schöpfen ihre aus dem semantischen Feld von Flora und Fauna, Menschen (zumindest diejenigen, die sich als Knechte und Mägde der mythischen Herren verstehen) aus der Landwirtschaft, Zwerge hauptsächlich aus Mineralogie und Bergbau. Da Sex eine nicht unwesentliche Rolle spielt, haben wir es daher mit jeder Menge Zapfen, Spalten, Pflügen und Schläuchen zu tun - das dürfte wohl der absolute Gegenpol zu den Blütenknospen-Dingsbumsen von Storm Constantines Wraeththu sein ...
Zur Handlung: Der Großteil der Hauptfiguren aus Teil 1 und 2 hat sich mittlerweile in der weit im Süden gelegenen Stadt Meerschaum versammelt; da sich da eine ziemliche Menge an Charakteren ein Romandrittel teilen muss, bleibt für jeden einzelnen nicht allzuviel Erzählraum. Hier kommt es unter anderem zu besagter Begegnung mit den Elfen - und eigentlich auch nicht zu viel mehr: Dass es in weiterer Folge um die Suche nach einer Superwaffe gehen wird, die so aparte Namen wie Auslöscher und Zerschmetterer der lästerlichen Heere trägt, bleibt vorerst eher eine Verheißung für die Zukunft; der Expansionskrieg der Zwerge, der die Handlung des Vorgängerbands bestimmte, bildet in "Die Halblinge des Ewigen Hains" nur das Hintergrundrauschen. Stärker als die vorangegangenen Bände hat Teil 3 den Charakter eines Mittelteils - soll heißen: Am Ende wird sich, was die große Rahmenhandlung betrifft, nicht allzu viel gegenüber dem Anfang verändert haben. Der Autor schreibt selbst im Nachwort, dass es hier vor allem um die Einführung der letzten Hauptpersonen gegangen ist. Gewissermaßen ein nochmaliges Überblicken des Spielfelds, bevor in Teil 4 dann alles ins Rollen kommt.
Die beiden anderen Erzählstränge des Romans schlängeln sich durch den Zwergenbund und langsam aufeinander zu. Einer dreht sich um die Zwergin Karu Schneider, die ursprünglich Polizistin bzw. Sucherin werden wollte wie Garep Schmied - und die genauso wie er auf die andere Seite des Gesetzes gewechselt ist, nachdem sie gemerkt hat, dass etwas faul ist im Staate Dampfland: Irgendjemand versucht die Geschichtsschreibung des Zwergenbunds zu manipulieren und geht dafür auch über Leichen. Mit ihrem Lover Rinul, der aus einer mafiösen Familie stammt, stößt Karu schließlich auf einen Mordfall, auf den auch die letzte neue Hauptfigur angesetzt wird: Der Halbling Anini 29-3, ein Kommissar der Bundessicherheit und Familienvater mit Faible fürs Foltern. Was zunächst nach einem typischen Beispiel für die Banalität des Bösen klingt, sich allerdings noch erstaunlich weiterentwickeln wird.
... womit wir bei den Halblingen wären, in deren Leben und Denken Teil 3 erstmals ausführlich einblicken lässt. Trotzdem ist das Bild hier noch etwas verwirrend: Anders als bei der Überführung der Zwerge in den Steampunk und der Elfen in noch einmal ganz etwas Anderes liegt keiner der beiden diametral entgegengesetzten Wesenszüge von Plischkes Halblingen sofort auf der Hand. Zum einen scheinen sie stocknüchterne Beamtenseelen zu sein - auf der anderen Seite hat zumindest ein Teil von ihnen Zugang zum Ewigen Hain: Von ihnen selbst als das wortgewordene Gedächtnis unseres Volkes bezeichnet, erinnert dieser an die Traumzeit der Aborigines - manifestiert als metaphysischer Wald, Abbild des verlorenen Heimatkontinents der Halblinge. Hier ist Plischkes Spiel mit Archetypen wohl noch nicht ganz ausgespielt - allerdings sollte man auch nicht vergessen, dass der "Archetyp" Halbling kaum älter ist als die Fliegende Untertasse und jünger als der Roboter und der Zeitreisende. Platz genug also für Freiheiten - und ein Grund mehr gespannt zu sein, wie's in Teil 4 weitergehen wird!

Christophe Bec & Eric Henninot: "Carthago", Teil 1 und 2: "Die Lagune von Fortuna" + "Die Challenger-Tiefe"
Graphic Novels, gebundene Ausgaben, jeweils 56 Seiten, € 14,20 bzw. 13,80, Splitter 2010.
Die Mystery-Welle im TV der 90er war rückblickend nur ein Vorgeschmack auf das, was das Millennium an Bedrohungs- und Verschwörungsszenarien bringen sollte: "4400", "Heroes", "Invasion", "Jericho", "Flash Forward" und natürlich das heilige "Lost". Fast alle einte der Umstand, dass sie von einer originellen Ursprungsidee lebten, ihnen aber recht bald die Puste ausging - nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil jede Idee früher oder später in die immer gleichen Handlungsschemata mündete und sich ein gewisser Sättigungseffekt einstellte. Eine dieser Serien, der ich gerne eine zweite Staffel gegönnt hätte, hieß "Surface" und wartete mit einer Reihe scheinbar aus dem Nichts auftauchender Kreaturen auf - darunter auch ein paar echte Mordstrümmer. Steh ich einfach drauf. - Also hat sich mal wieder der Kauf eines Comics (bzw. einer Graphic Novel) angeboten, weil es ein durchaus ähnliches Szenario zum Inhalt hat: Die auf sechs Teile angelegte Reihe "Carthago" des Franzosen Christophe Bec - ein Panoptikum für KryptozoologInnen.
Auf der Eröffnungsseite - und 24 Millionen Jahre vor unserer Zeit - zieht eine Schule Bartenwale durch vier Panels voller friedlichem Blau; doch einer fällt zurück und im letzten Panel schiebt sich ganz klein eine spitze Rückenflosse ins Bild. Beim Umblättern präsentiert sich ein blutiges Chaos, an dessen Ende der in zwei Hälften zerbissene Wal dem Meeresgrund entgegen sinkt. - Dieser Effekt, der hier nicht zum letzten Mal eingesetzt wird, wirkt wohlbekannt: Reißer-Autor Steve Alten ließ seine erfolgreiche "MEG"-Reihe damit beginnen, dass ein T-Rex ins Meer watet und dort von einem - wohl zeitreisenden - Riesenhai Megalodon zerfleischt wird. Am Beginn von "Jurassitsch Park 3" kriegt ein T-Rex von einem Spinosaurus eine auf den Deckel, und Roland Emmerich bewarb seinen "Godzilla" mit einem auf die Dino-Serie gemünzten Trailer, in dem ein imposantes T-Rex-Skelett in einem Museum für ehrfürchtiges Staunen sorgt, ehe sich ein riesiger Plattfuß vom Himmel senkt und es wie eine Assel zerquetscht (leider konnte der Film selbst es nie mit seinem Trailer aufnehmen). Die Aussage lautet stets: Ihr dachtet, das wäre schon groß - jetzt zeig ich euch mal richtig groß.
Da das Wal-Gemetzel von einer jungsteinzeitlichen Hetzjagd und anschließend einer im Jahr 1993 angesiedelten Passage gefolgt wird, in der ein Taucherteam bei Unterwasserbohrungen auf eine riesenhafte Höhle stößt und dort gefressen wird, ehe es zum ersten Mal in die Gegenwart geht, glaubt man schon an einen Dreifach-Prolog - tatsächlich sind wir längst mitten im Geschehen. Denn so klar die Optik der "Carthago"-Bände gehalten ist - auf Realismus bedacht gezeichnet von Eric Henninot und flächig koloriert von Delphine Rieu -, so komplex gestaltet sich der Handlungsaufbau. Bec verweilt nie länger als einige Seiten am selben Ort oder in derselben Zeit, sondern springt beständig zwischen der Gegenwart und Rückblenden hin und her. Der Hauptstrang der Erzählung dreht sich dabei um die Meeresbiologin Kim Melville, die von der Gruppe Adome - einem fiktiven "bewaffneten Arm" von Greenpeace - auf die Machenschaften des Konzerns Carthago aufmerksam gemacht wird. Offenbar ist Carthago im Zuge seiner Erdgasförderungen im Pazifik auf eine zoologische Sensation gestoßen, will diese aber mit allen Mitteln verschweigen, um weiter ungestört Gas hochpumpen zu können. Die Ermittlungen führen Kim und ihre Crew an einige der tiefsten Stellen der Erde - und in die mögliche Konfrontation mit zwei ebenso mächtigen wie geheimnisvollen Männern: Dem Carthago-Chef Snyder, der wegen seines entstellten Gesichts stets eine Skimaske trägt, und - huch! - dem ultrareichen Österreicher Feiersinger - genannt der hundertjährige Karpate, ein anscheinend zeitloser Sammler von kryptozoologischen Beweisstücken. In Band 1 treffen wir ihn in seinem verborgenen Privat-Museum an, in Band 2 in einer riesigen mobilen Unterwasserstation, die Kapitän Nemo vor Neid erblassen ließe. Durch deren Panorama-Blick auf den Marianengraben bekommen wir dann auch einiges zu sehen, was man im Filmbereich einen "Money Shot" nennen würde.
Neben diesem Hauptstrang führt Bec eine Vielzahl weiterer Schauplätze ein: Opferungsrituale und Tauchgänge im Golf von Djibouti in den 1930er und 1990er Jahren; ein deutsches U-Boot, das im Ersten Weltkrieg Bekanntschaft mit einem Kronosaurus macht; Aborigines, die vom bevorstehenden "Ende der Zeiten" sprechen und sich vor einigen äußerst ungewöhnlichen Felszeichnungen versammeln; Massenstrandungen von Walen in der Gegenwart; und nicht zuletzt eine Jagd auf den Yeti (der hier wirklich den Beinamen "der schreckliche Schneemensch" verdient) im Jahr 1987. Bei letzterer gibt die Kombination von tibetischen Mönchen und Kampfhubschraubern tolle Bilder ab - und der Ausdruck stiller Freude auf dem Gesicht des Lamas, als die angelieferten Sturmgewehre ausgepackt werden, ist unbezahlbar. In Band 2 beginnen die vermeintlich disparaten Rückblenden auch langsam damit, ein erstes Gesamtbild erahnen zu lassen. Und wenn man genau hinsieht, wird man auch einige Objekte aus handlungschronologisch früheren Episoden in späteren wiederfinden.
Bei einem der Tauchgänge schwimmt auch ein Liopleurodon vor Kims Objektiv - und bevor man sich wundern kann, durch welchen Effekt das Riesenreptil die Zeitalter in einer luftlosen Unterwasserhöhle überdauert haben mag, wird auch schon die "Erklärung" geliefert: Biologin Kim nennt es "einen der größten Raubfische des Oberjura". Autsch. Für einen Wissenschaftsthriller, der "Carthago" trotz einiger Mystery-Elemente sein will, ist das ziemlich peinlich. Nicht nur was die Faktizität, sondern auch was die Handlungslogik betrifft. Denn die Tauch-Crew begeistert sich nicht etwa über die Entdeckung eines 150 Millionen Jahre alten Meeressauriers, sondern ärgert sich darüber, dass dies sie bei der Suche nach dem 1,5 Millionen Jahre alten Megalodon behindern könnte. Das ist ungefähr so, als würden Astronauten auf dem Mars landen, dort ein Raumschiff aus einem anderen Sonnensystem antreffen und die Aliens mit den Worten begrüßen: "Tschulldigung, könnten Sie mal eben zur Seite rücken? Wir suchen hier grade nach Mikroben."
Es ist also nicht alles Gold, was bei "Carthago" glänzt, aber der Mosaik-artige Handlungsaufbau und die erbarmungslose Abfolge von Cliffhangern halten einen bei der Stange. Lese- bzw. Schaufutter für alle, die große Tiere klasse finden, große ausgestorbene Tiere noch besser, und große ausgestorbene wiedererweckte Tiere optimal.
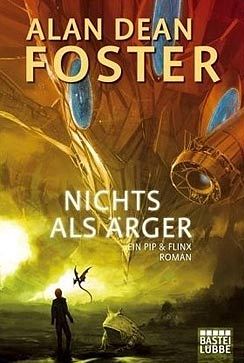
Alan Dean Foster: "Nichts als Ärger"
Broschiert, 350 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2010.
Und was gibt es Neues bei Pip & Flinx? Der Titel sagt es bereits, und niemand wird davon überrascht sein. Schließlich ist der mittlerweile 29-jährige Philip Lynx alias Flinx, der mit seiner giftspuckenden Mini-Drachin Pip durchs All zieht, ein echter "Trouble Magnet" (so auch der Originaltitel des 2006 erschienenen Romans). Gleich zu Beginn lässt der Autor kurz all die Komplikationen Revue passieren, die Flinx im Verlauf seiner fast schon 40 Jahre und bis zu "Trouble Magnet" zwölf Romane währenden literarischen Existenz widerfahren sind. Was gleichbedeutend ist mit einer Aufzählung all der Personen, Organisationen und Alienvölker, die hinter Flinx her sind. Diejenigen, die mit Alan Dean Fosters populärer Dauerbrenner-Serie bislang nicht in Berührung gekommen sind, werden hier vielleicht eine Seite lang die Orientierung verlieren. Aber zu deren Beruhigung: Für den Roman selbst spielt der große Handlungsrahmen - wieder einmal - keine Rolle.
Eigentlich befindet sich Flinx auf einer wichtigen Mission, nämlich eine gigantische Waffenplattform aus ferner Vergangenheit aufzuspüren, mit der das galaktische Homanx-Commonwealth gegen eine noch nicht näher spezifizierte Gefahr verteidigt werden soll. Aber irgendwie kommt Flinx immer was dazwischen. Das konnte schon mal ein dringend benötigter Urlaub sein - oder wie hier ethische Bedenken. "Ist's die menschliche Zivilisation überhaupt wert, gerettet zu werden?", fragt sich Flinx und ändert spontan den Kurs. Dass er ausgerechnet die wildwuchernde Pionierwelt Visaria, auf der jeder nur dem schnellen Geld hinterherrennt, ansteuert, zeigt, welche Antwort er auf die Frage insgeheim gerne hätte. Schließlich sind seine Zweifel zu einem guten Teil auch eine Entschuldigung dafür, dass er sich aus dem ganzen Weltgerette endlich mal ausklinken und ein schönes ruhiges Leben mit seiner Freundin Clarity verbringen möchte. Verdient hätte er's ohne Frage - und die genannte Gefahr, zumindest soviel ist bekannt, ist nichts, was in naher oder mittlerer Zukunft heraufziehen wird.
Wir erleben einen Flinx, der nicht nur erwachsener, sondern auch dunkler geworden ist - womit der sympathische Filou von einst langsam auch seinem Potenzial gerecht wird. Als Kind genetisch manipuliert, verfügt er über eine empathische Gabe, die sich in Form von Gefühlsprojektion durchaus auch als Waffe einsetzen lässt. Dazu kommt ein psychischer Verteidigungsmechanismus, den er zwar nicht versteht, der aber verheerende Auswirkungen auf etwaige Angreifer hat und Flinx nahezu unantastbar macht. Wie ein misanthropischer Halbgott lässt er sich durch die Menge treiben, spricht gar von affenartigen Wesen, die er zu seinen Vettern zählen musste, und wälzt im Stil von Q (Star Trek, nicht Bond) die Frage, ob die Menschheit eine Chance verdient.
"Nichts als Ärger" ist nur zur Hälfte ein Flinx-Roman. Breiten Raum nehmen die Erlebnisse einer Clique von Jugendlichen in Visarias Hauptstadt Malandere ein: Bislang haben sie sich als Kleinkriminelle irgendwie durchgewurschtelt, aber jetzt planen sie mit einem Überfall auf ein Depot voller eingeschmuggelter Erd-Antiquitäten den großen Coup. Schon bei der Planung merkt man, dass das unweigerlich ins Auge gehen muss - und natürlich gerät Trouble Magnet Flinx mitten ins Geschehen. Dass er nach dem Erstkontakt am Ball bleibt, liegt allein am Gang-Mitglied Subar: Naiv, zugleich aber berechnend, wie Subar ist, erinnert er den wider Willen faszinierten Flinx nämlich an dessen eigene wenig schmeichelhafte Jugend. Das klingt nach einer schönen Zusammenführung der Handlungsmotive - wird allerdings am Ende durch einen Überraschungsauftritt, der die ganze Q-Thematik plötzlich zur Nebensache degradiert, etwas getrübt. Diese Handlungsvolte war wohl dazu gedacht, Altfans von Pip & Flinx zu bedienen - für Neulinge kommt es leider wie ein Deus-ex-Machina-Effekt Marke "häh?" daher.
Bei einer TV-Serie würde man von einer "Villain of the Week"-Folge sprechen - also einer Episode, die im Gegensatz zu "Story Arc"-Folgen aus der großen Rahmenhandlung herausgelöst ist und im wesentlichen für sich selbst steht. Nur Anfang und Ende (gemeint sind jeweils wenige Seiten) bilden den Kitt, der "Nichts als Ärger" in die Flinx-Chronologie einfügt. Insgesamt ein nettes Abenteuer mit jugendlichen ProtagonistInnen, aber irgendwie nicht Fisch noch Fleisch. Die alten Pip & Flinx-Geschichten sind immer noch die besten.

Arkadi & Boris Strugatzki: "Gesammelte Werke 1 + 2"
Gebundene Ausgaben, 683 bzw. 684 Seiten, jeweils € 85,00, Golkonda 2010.
Oder: Broschiert, 906 bzw. 911 Seiten, jeweils € 13,40, Heyne 2010.
Zum Abschluss noch einen Kauf- und Schenktipp de luxe für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen - immerhin musste dem Werk der Brüder Arkadi und Boris Strugatzki schon vor 30 Jahren selbst der verknöchertste Deutschprof knurrend literarischen Rang zugestehen. Dass ich den Tipp jetzt im November bringe, liegt nicht zuletzt daran, dass die nächste Rundschau wohl erst kurz vor Weihnachten kommen wird - also möglicherweise für Panikkäufe zu spät.
Die große Strugatzki-Veröffentlichungswelle im deutschsprachigen Raum liegt inzwischen schon ganz schön lange zurück - seit heuer erscheint aber im Rahmen eines mehrjährigen Projekts eine umfangreiche, neuüberarbeitete Werkausgabe. Diese läuft in zwei Verlagen: Heyne bringt die Bände, die jeweils mehrere thematisch zusammenhängende Romane und Erzählungen umfassen, im Taschenbuch-Format heraus; der Berliner Golkonda-Verlag veröffentlicht parallel dazu seine Lizenzausgabe in gebundener Form für SammlerInnen. Wird die gesamte bis 2012 angelegte Edition abonniert, verringert sich der Preis pro Band übrigens von 85 auf 69 Euro.
Natürlich lässt sich das mehr als 30 Jahre umspannende gemeinsame Werk der beiden bedeutendsten Vertreter der russischen Science Fiction nicht so leicht unter einen Hut bringen respektive in einem schlanken Satz zusammenfassen. Doch es gibt einige immer wiederkehrende Motive und vielleicht ein zentrales Thema: Fortschritt (im neutralen Sinne) und Weiterentwicklung. Das zeigen vor allem die beiden strategisch geschickt ausgewählten Eröffnungsbände der Edition: Band 1 enthält die drei "Maxim-Kammerer-Romane" "Die bewohnte Insel", "Ein Käfer im Ameisenhaufen" und "Die Wellen ersticken den Wind". Maxim Kammerer ist ein Vertreter der Welt des Mittags, des leicht saturierten Utopias, zu dem die Erde des 22. Jahrhunderts geworden ist. Vor Herausforderungen stehen ihre BürgerInnen immer dann, wenn es zum Kontakt mit anderen Kulturen kommt. In "Die bewohnte Insel" ist Kammerer noch selbst der Abkömmling der avancierteren Zivilisation und wird damit konfrontiert, wie seine Welt hinter den Kulissen einer anderen an den Strippen zieht. In den beiden Folgeromanen kehrt sich die Perspektive um - hier ist man auf Erden eifrigst darum bemüht aufzuklären, ob und wie die Wanderer - eine ominöse Superzivilisation - Einfluss auf die menschliche Gesellschaft genommen haben könnten. Und Kammerer bekommt es auch mit dem Homo superior zu tun, einem neuen Zweig der Menschheit, der die große Mehrheit der "gewöhnlichen" Menschen hinter sich lässt - auch das ein Motiv, das im Werk der Strugatzkis mehrfach auftaucht.
Band 2 umfasst drei herausragende Einzelromane, wir bleiben aber beim Generalthema Entwicklung: In dem berühmten "Picknick am Wegesrand", das die Vorlage für den Tarkowski-Film "Stalker" bildete, bekommen die Menschen es einmal mehr mit den Hinterlassenschaften einer fremden Superzivilisation zu tun, die weit über ihren Horizont gehen. "Das Experiment" (auch: "Die Verurteilte Stadt"), gewissermaßen eine intellektuellere Variante des Themas von Philip José Farmers "Flusswelt", versammelt Menschen aus verschiedenen Abschnitten der Historie in einer Kunstwelt, in diesem Fall einer sich laufend verändernden und nicht verlassbaren Stadt. Sinn und Zweck des Experiments ist seinen TeilnehmerInnen nicht bekannt - auch nicht der Umstand, ob es überhaupt noch irgendwo Verantwortliche gibt, die sich darum scheren. In "Milliarden Jahre vor dem Weltuntergang" schließlich wird der Fortschritt der Zivilisation nicht nur thematisiert, sondern auch unterbunden: Ein mysteriöser Effekt sorgt dafür, dass WissenschafterInnen mit ihren Forschungen zum Wesen der Welt nicht weiterkommen, weil offensichtlich ein bestimmter Punkt nicht überschritten werden darf. - Jetzt doch noch der schlanke Satz, der alles zusammenfasst: Kann man gar nicht genug empfehlen!
Bis zur nächsten Rundschau ist hoffentlich der erste Band der neuen James Tiptree, Jr.-Edition schon heraußen, auf die freue ich mich besonders. Auf jeden Fall wird es aber um David Bowie als Muse der Phantastik gehen, und dazu kommt dann noch passend zur festlichsten Zeit des Jahres die eine oder andere geschmacklose Blutoper. (Josefson)