
Arthur C. Clarke: "Die Stadt und die Sterne"
Broschiert, 326 Seiten, € 9,30, Heyne 2011
Arthur C. Clarke als Inspiration für einen vom Lehrer belobigten Schulaufsatz: Das war die erste Begegnung Gary Gibsons, Autor der "Shoal"-Reihe, mit einem der Giganten der Science Fiction; hier geschildert im Vorwort zur Neuausgabe von "Die Stadt und die Sterne". Dem zufälligen Erstkontakt folgte bei Gibson die gezielte Suche nach weiteren - und echte Klassiker zeichnet es aus, dass jeder Leser von solchen oder ähnlichen Erinnerungen zu berichten weiß. In meinem Fall waren es vergilbte "Terra"-Hefteln, die ich während meiner ersten Welle der Science-Fiction-Begeisterung, so ab acht, aus irgendwelchen familiären Altbeständen zusammengeklaubt habe. Dass da schon einiges an Plunder dabei war, lag im Rückblick eher an Pech bei der Zufallsauswahl als an einer Schuld von "Terra" an sich. Mitten darunter stach aber plötzlich eine Erzählung heraus, die einfach irgendwie viel, viel besser war als der Rest und deren ambivalenter Schluss sich ebenso dauerhaft einbrennen sollte wie später die noch berühmteren letzten Worte von "Die neun Milliarden Namen Gottes". "Rettungsexpedition" ("Rescue Party") hieß die Erzählung, und der Name des Autors sagte mir damals natürlich noch rein gar nichts.
Zehn Jahre nach "Rescue Party" veröffentlichte Clarke "The City and the Stars", seine Variante des von vielen AutorInnen verwendeten Roman-Plots um das letzte Bollwerk der menschlichen Zivilisation. In Clarkes Fall heißt es Diaspar: Die Stadt, die die Ewigkeit herausgefordert hat und in deren abgeschottetem Inneren immerwährender Nachmittag herrscht. Das Bild des Nachmittags, in dem Müßiggang und Niedergang gleichermaßen anklingen (letzteres noch viel stärker bei Brian Aldiss' "Der lange Nachmittag der Erde") bringt die Atmosphäre an einem Ort voll von Wundern, aber ohne jede Überraschung auf den Punkt. Zehn Millionen Menschen führen hier ein vergnügtes Leben ohne jeden Sinn; 100 Mal soviele schlummern in den Matrizen der Gedächtnisanlagen und warten auf ihre zyklische Wiedergeburt. Eine instinktive Angst vor dem Draußen, gespeist von Erzählungen über das lange verwehte Imperium der Menschheit, das unter dem Sturm ungenannt bleibender Invasoren zerbrach, hält die BewohnerInnen davon ab, sich in die Wildnis hinter den Stadtmauern vorzuwagen. Solange zumindest, bis der Protagonist des Romans auf den Plan tritt: Seit unzähligen Jahrtausenden hatte kein Raumschiff mehr das Sonnensystem angesteuert; dort draußen, mitten unter den Sternen, mochten die Nachfahren der Menschen immer noch Imperien errichten und Sonnen zerstören - die Erde wusste es weder, noch wollte sie es wissen. Die Erde nicht. Aber Alvin.
Dieser Alvin ist ein ganz besonderer Bürger der Stadt, wie sich bald herausstellt, denn er ist vor 20 Jahren zum ersten Mal den Gedächtnisanlagen entstiegen; kein Wiedergeborener also, sondern das erste echte "Kind" Diaspars seit undenklicher Zeit. Und diese Frische trägt er in sich, denn als einziger möchte Alvin unbedingt wissen, was hinter den Stadtmauern liegt: Ein Entdecker und Wahrheitssucher in der vollen Bandbreite von naivem Optimismus bis zur Egozentrizität, ohne die sich letztlich kein Ziel erreichen ließe. Was genau Alvin draußen finden wird, wäre zum einen ein Spoiler, zum anderen aber ist es gar nicht einmal so wichtig, denn Clarke geht es nur um die Entdeckungslust an sich. So erweist sich auch ein gesellschaftliches Gegenmodell zu Diaspar, das Clarke zunächst als positive Alternative zu etablieren scheint, bloß als weitere Sackgasse. Was aber - wichtig! - keineswegs zu Resignation führt. Mögen wir uns auch am vermeintlichen Ende der Zeiten und auf einer verlassenen Erde befinden: keine Zeit für Melancholie. Was einst entdeckt und wieder verloren wurde, muss eben aufs Neue entdeckt werden. Dass Fragen viel wichtiger sind als dogmatische Antworten, zeigt sich nicht zuletzt auch an der Weise, in der Clarke das Thema Religion streift. Ist es ein Zufall, dass das letzte gläubige Wesen in der näheren galaktischen Umgebung ein Alien-Polyp ist und dem Schwindel eines falschen Propheten aufsitzt? Schwerlich, immerhin spricht Clarke von aufblühenden und wieder aus der Geschichte verschwindenden Kulten als Epidemien der Unvernunft.
Dieses zyklische Werden und Vergehen spiegelt sich übrigens auf der Mikro-Ebene in dem Polypen selbst wider, dessen Zellen in langen Abständen auseinanderfallen, um sich später wieder zu einem Kollektivwesen zusammenzusetzen. Gibson weist im Vorwort darauf hin, dass Clarke von den Werken des britischen Autors Olaf Stapledon beeinflusst war. Der entwarf bereits in den 30er Jahren mit Romanen wie "Die letzten und die ersten Menschen" oder "Der Sternenmacher" Chroniken ferner und fernster Zukünfte, in denen es um den zyklischen Auf- und Niedergang menschlicher Zivilisationen ging - ein Jünger aus der gegenwärtigen SF-Literatur wäre beispielsweise Alastair Reynolds, siehe "Das Haus der Sonnen". Klar kann man bei solchen Spekulationen nicht mehr von Hard SF sprechen, auch nicht bei Clarkes Roman mit seinen ähnlich gewagten räumlichen und zeitlichen Dimensionen. Von der allgegenwärtigen Telepathie - nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Robotern - einmal ganz abgesehen; in den 50ern war das eben noch ein vollkommen selbstverständlicher SF-Topos. Heutige AutorInnen lassen's halt mit Kommunikationsimplantaten funktionieren, so viel hat sich also gar nicht geändert. Wenn "Die Stadt und die Sterne" stellenweise ein wenig angejahrt wirkt, liegt es somit eher an der Nomenklatur als an den Ideen an sich.
Umgekehrt ist es verblüffend, wie viele Romanszenarien aus späterer Zeit Clarkes Diaspar ähneln. Edward Bryants "Cinnabar" (1976) etwa, noch so ein abgeschottetes Paradies voller Techno-Magie und Müßiggang, könnte eine direkte Schwesterstadt Diaspars sein; mit Abstrichen auch Greg Bears metaphysische "Stadt am Ende der Zeit" (2009). Oder William F. Nolans Welt-Metropole im Roman "Logan's Run" (1967): Für dessen Verfilmung mit dem dämlichen deutschen Verleihtitel "Flucht ins 23. Jahrhundert" wurde das Zusatz-Element der Erneuerung der rituell hingerichteten BürgerInnen eingebracht ... ein Schwindel leider, während man in Diaspar tatsächlich wiedergeboren wird. Wie auch - aktuellstes Beispiel - in der wandelnden Mars-Stadt Oubliette und dem State-of-the-Art-Transhumanismus von Hannu Rajaniemis "Quantum" (2011). Rajaniemi hat sich zwar die Arbeit gemacht, detailliert auf die technischen Erfordernisse einzugehen, wo Clarke gelinde gesagt vage bleibt. Doch das Ergebnis ist bemerkenswert ähnlich: Eine Stadt (inklusive BewohnerInnen), die weniger ist als vielmehr kontinuierlich per Daten konstruiert und in einer scheinbar stabilen Form gehalten wird. Einen Computer, der die Existenz der Materie selbst kontrollieren kann, hat US-Wissenschafter Ivan Sutherland 1965 als the ultimate display bezeichnet ... neun Jahre nach "Die Stadt und die Sterne": Soll keiner sagen, Arthur C. Clarke wäre seiner Zeit nur in Sachen geostationäre Satelliten voraus gewesen.
Unversehens ist man damit auch an der verschwimmenden Grenze von feststofflicher und virtueller Welt angelangt ... und damit bei "Matrix". Auch die Filmtrilogie aus den Jahren 1999 bis 2003 hat hier gewissermaßen einen Vorläufer - bis hin zu den Rollen, die einige ProtagonistInnen spielen. So fungiert in Diaspar der Spaßmacher Khedron als Element der kalkulierten Unordnung (hallo, Orakel!) ... und wenn Alvin als älteres Pendant Neos zum Erneuerer wird, dann ist dies auch hier durchaus vom System beabsichtigt.
Spätestens seit Oasis kennen alle die Redewendung "standing on the shoulders of giants". Clarke war so ein Gigant.

China Miéville: "Der Krake"
Broschiert, 734 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2011
Darf man einen Roman der Urban Fantasy zuschreiben, wenn sein Titelbild keine bewaffnete junge Frau im ärmellosen Leiberl zeigt? Vermutlich nicht, aber zweifelsohne ist der große China Miéville ein Autor der Urbanität. So gut wie alle seine Erzählungen handeln in fantastischen Städten - sei es der Moloch New Crobuzon in den beliebten Bas-Lag-Romanen, das siamesische Zwillingspaar Besźel/Ul Qoma in "Die Stadt & die Stadt" oder London, das in "Un Lon Dun" oder "Spiegelhaut" noch schattenhafte Schwesterstädte zur Seite gestellt bekam, in "Der Krake" aber fantastisch genug geschildert wird, dass es keine solchen Parallelwelten mehr braucht. Teilweise wähnt man sich im Roman übrigens fast wieder in New Crobuzon. - Und die nächste Stadt folgt auf dem Fuße, nämlich die extraterrestrische "Embassytown" im gleichnamigen Roman. Miéville abzuarbeiten (eine lohnende und sehr unterhaltsame Arbeit!) ist ständig mit einem Timewarp-Gefühl verbunden: Immer wenn im englischsprachigen Raum gerade die Diskussionen über das aktuelle Miéville-Buch abgeklungen sind, erscheint auf Deutsch das vorige. So geht's mir jetzt seit drei Romanen, und wenn "Embassytown" erst mal auf Deutsch vorliegt, wird der bemerkenswert produktive Autor mit Sicherheit schon den nächsten Titel veröffentlicht haben. Den Seinen gibt's der Herr eben im Schlaf - wobei der Herr in dem Fall Karl Marx wäre; außer China Miéville käme wohl so schnell kein anderer Autor auf die Idee, einen altägyptischen Uschebti - also eine Statuette, die einem Verstorbenen als Helfer im Jenseits mitgegeben wurde - die Weltrevolution im Totenreich ausrufen zu lassen. Und das ist nur eine der sozialen Unruhen, die in "Der Krake" brodeln.
Zum Romanhelden wider Willen wird der junge Billy Harrow, ein Kurator im Naturhistorischen Museum Londons, dessen Meisterstück die Präparierung eines acht Meter langen Architeuthis-Kalmars war. Und der ist eines Tages verschwunden, samt Behälter und einigen tausend Litern Formalin - dass im Museumsfundus dafür eine eingerexte menschliche Leiche entdeckt wird, fällt daneben kaum noch ins Gewicht. Rasch fühlt sich Billy vom Geschehen restlos überfordert, und tatsächlich fordert der rasante Strudel an Ereignissen auch beim Lesen einige Konzentration. Fragen hätte Billy (und wir mit ihm) genug, doch statt Antworten werden ihm stets nur kryptische Bemerkungen hingestreut, die ihn in seinen nächsten Schritt hineinstolpern lassen, ehe er noch den vorherigen so recht verstanden hat. Zu Billys großer Frustration scheint jeder, dem er begegnet, bei ihm ein Vorwissen vorauszusetzen, das er nicht hat oder an das er zumindest nicht mehr herankommt. Das gilt auch für das schräge Ermittlungsteam des Dezernats für fundamentalistische und sektenbezogene Verbrechen, das sich um den Fall des entführten Kalmars kümmert - unter ihnen eine rüpelhafte Hexe mit Amy-Winehouse-Frisur, die gelegentlich ein unsichtbares Geisterschwein an der Leine mitführt. Und zu allem Überfluss plagen Billy auch noch Ahnungen, dass sich etwas Dunkles zusammenbraut. Eine Spannung liegt über der Stadt - fast scheint es, als hätte der Autor die Riots des heurigen Sommers schon im Vorfeld gespürt.
Miéville entfaltet eine fiktive Welt, in der es vor Untergrundorganisationen, Kopfgeldjäger-Gruppen und miteinander konkurrierenden Weltuntergangskulten nur so wimmelt. So richtig dick kommt es aber erst, als die Post ein kleines Päckchen liefert, das sich so lange entfaltet, bis ihm zwei ausgewachsene Menschen entsteigen ... oder zumindest so etwas Ähnliches: Immerhin lässt einer davon seine Kiefer so weit aufschnappen, dass er einen Freund Billys im Ganzen verschluckt. Goss und Subby heißen diese beiden dämonischen Akteure und wirken ein bisschen von den Dominomännern in Jonathan Barnes' "Königshaus der Monster" abgekupfert. Nicht dass Miéville keine eigenen Ideen hätte, im Gegenteil: Wir staunen über computerunterstütztes Extrem-Origami und Drogenvisionen nach dem Konsum von Kalmartinte, Biomechanoide und eine sprechende Tätowierung, streikende Tiere und einen Geist, der sich nur in figürlichen Darstellungen manifestieren kann (und deshalb schon mal von der Nelson-Statue in eine Plastik-Actionfigur hüpft), Chaosnazis und TV-Serien-Polizisten, die als dienstbare Geister vom Bildschirm herabbeschworen werden. Was, wenn man erst mal im seltsamen, seltsamen Kosmos des Autors gefangen ist, keineswegs komisch, sondern genauso plausibel wirkt wie zu "Engeln" verdichtete Erinnerungen, die sich ihre Quasi-Körper aus Konglomeraten von Museumsmaterial zusammenschustern. "Wunder werden immer gebräuchlicher, Kumpel. Das sind die Enden der Welt." Plural.
Ein Wort noch zum wichtigsten Protagonisten des Romans: Das ist nicht Billy Harrow, und schon gar nicht ist es der Riesenkalmar, dem anfangs noch ein eigener Schwarzschild-Radius des Unheimlichen zugeschrieben wird, der sich im weiteren Verlauf aber als simpler MacGuffin entpuppt. Es ist London selbst, die - buchstäblich - lebendige Stadt: Die Straßen Londons sind steinerne Synapsen, handverdrahtet zum Zweck der Anbetung. Geheime Zeichensysteme, nur von dem zu erkennen, der sie zu lesen versteht. Was Miéville in "Die Stadt & die Stadt" noch als rein von Menschen getroffene semiotische Konvention schildert, wird hier ins Metaphysische überführt; London als Knotenpunkt göttlicher Mächte. Wachsam verfolgen die Londonmantiker die Regungen ihrer Stadt, und wenn ein Haruspex aus ihren Reihen die "Eingeweide" der Stadt für Wahrsagungen beschaut, dann legt er mit dem Betonschneider tatsächlich zuckende Riesenorgane frei. Im großen apokalyptischen Endkampf schickt das Stadtwesen dann seine eigenen Antikörper ins Gefecht und Miéville zertrümmert die Grenze zwischen Abstraktem und Konkretem endgültig: Es ist Urbanität unter Waffen.
Ähnlich barock wie der Requisiten-Fundus ist die Sprache. Um dem Malstrom an Eindrücken gerecht zu werden, wirft Miéville mit Eigenschöpfungen wie Squidität oder Urbopathie, die sich eher gefühls- als verstandesmäßig fassen lassen, nur so um sich, zudem macht er munter Substantive zu Verben, Verben zu Adjektiven undsoweiter. Eine Herausforderung für jeden Übersetzer, nicht nur weil sich ein Wortspiel wie Squidnapping nicht ins Deutsche übertragen lässt. Die langjährige Miéville-Übersetzerin Eva Bauche-Eppers war diesmal leider nicht mehr mit im Boot, dafür hat "Der Krake" offenbar gleich zwei NachfolgerInnen verbraucht. Einige KäuferInnen haben dies bereits beklagt - aber wie gesagt: Einen Text wie diesen in eine andere Sprache zu übertragen dürfte für jeden zur Herausforderung werden, und beim Lesen gilt das ganz genauso.
Ich hätte nie gedacht, dass ich an China Miéville auch mal etwas zu bekritteln haben könnte. Und natürlich ist es das Übliche: der Roman ist zu lang. Ist ja nicht so, dass hier eine ähnlich epische Abenteuerfahrt wie im Doppelroman "Die Narbe"/"Leviathan" unternommen würde. "Der Krake" hat mich unwillkürlich an Gordon Dahlquists "Glasbücher der Traumfresser" erinnert, wo ebenfalls geheime Organisationen unter der Oberfläche einer London ähnelnden Stadt bizarren Praktiken nachgehen. Und Dahlquists Roman war viel zu lang. Beim "Kraken" (im Original 2010 als "Kraken: an anatomy" erschienen) hätte es schon gereicht, die Nebenhandlung um eine - bezeichnenderweise den Namen Marginalia tragende - Bekannte Billys herauszunehmen. Die Kapitel um sie lesen sich, als hätte der Autor eine Novelle in den Roman eingearbeitet, in der das Geschehen aus einer zweiten Perspektive betrachtet wird; letztlich aber ohne große Bedeutung für dessen Ausgang zu haben. - Nichtsdestotrotz ist "Der Krake", ganz wie man's von China Miéville gewohnt ist, eine wilde Parforcejagd, gleichermaßen intelligent, humorvoll und erschreckend. Das wäre mein Vorschlag für eine Neudefinition von Urban Fantasy - aber bis es soweit kommt, bleibt das Feld wohl noch Detektivinnen überlassen, die Dämonen abfackeln und Werwölfe vögeln.
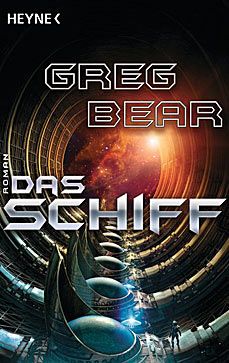
Greg Bear: "Das Schiff"
Broschiert, 478 Seiten, € 9,30, Heyne 2011
Nach aktueller Science Fiction wurde letzten Monat gefragt - ich würde dieses Buch empfehlen. Greg Bear, der zuletzt in seinem sehr nach Alterswerk riechenden Mastodonwälzer "Die Stadt am Ende der Zeit" mehr als einmal den Faden verlor, hat sich wieder auf einige Grundessenzen eines SF-Plots besonnen und einen turborasanten Roman um ein Generationenschiff geschrieben (2010 als "Hull Zero Three" veröffentlicht). Dabei bietet "Das Schiff" nicht weniger philosophische Anstöße als die metaphysisch verschwurbelte "Stadt" - nur sausen sie einem hier gewissermaßen wie die Querschläger eines Kampfes um die Ohren, den die ProtagonistInnen vom ersten bis zum letzten Kapitel ums Überleben führen.
Wir schließen uns zu Gruppen zusammen, fassen uns an den Händen und bilden schwankende, schwerelose Reihen in der Aussichtskuppel, rufen einander bei den Namen unserer Traumzeit und grinsen vor Freude, bis sich unsere Wangen verkrampfen. Um die Gesichter zu entspannen, ziehen wir grässliche oder komische Grimassen, wie Clowns. Bald werden wir neue Namen auswählen: Namen für das Land, das Meer, die Luft. (...) WIR! SIND! ANGEKOMMEN! "Das Schiff" beginnt mir einer kitschigen Vision der aus dem Kälteschlaf erwachten Weltraumreisenden, die über ihrer neuen Heimat einschweben. Fehlt nur noch eine nordkoreanische Jubelchoreographie - und genauso echt sind die Freudenszenen auch. Kurz darauf erwacht der namenlose Ich-Erzähler des Romans nämlich wirklich ... und glaubt in einem Albtraum gelandet zu sein: Rings um ihn platzen die organischen Säcke, aus denen die Reisenden "geboren" werden sollten, auf und ergießen ihre zuckenden Inhalte auf den eisigen Boden, wo sie sofort festfrieren und sterben. Der Erzähler büßt einige Hautfetzen ein, kann jedoch zumindest dieser ersten Hölle entkommen - dank einem dünnen kleinen (und ziemlich herrisch veranlagten) Mädchen, das ihn aus seiner Plazenta reißt und gnadenlos weiterpeitscht. Es folgt eine Hetzjagd durch gefrierende Schiffsregionen, aus- und wieder einsetzende Schwerkraft und vorwarnungslos wie eine Guillotine herabzischende Schotts. Leichen liegen herum, riesenhaften Insekten ähnelnde Kunstgeschöpfe lauern auf Opfer ... und hastdunichtgesehen sind die ersten 100 Seiten vorbei. Bear ist offenbar angetreten, das Tempo einer Kurzgeschichte auf der Länge einer Novelle und vielleicht sogar eines ganzen Romans durchzuhalten.
Ein besonderer Reiz liegt darin, dass der Erzähler - vom Mädchen Lehrer genannt - ohne Gedächtnis erwacht ist, also bei Null beginnt und parallel zu uns seine bizarre Umgebung kennenlernt. Dass "Das Schiff" im Präsens erzählt wird, wirkt daher auch weniger wie eine bewusste Entscheidung des Autors als vielmehr wie die einzig denkbare Möglichkeit. Äußere Gefahren zu überstehen ist das eine - die wahren Triumphe fühlt der Lehrer aber, wenn kleine Teile seiner Erinnerungen zurückkehren. Wie ein Kind kann er sich inmitten des atemlosen Geschehens über Begriffe und Redewendungen freuen, die wieder in seinem Gedächtnis auftauchen und erste Hinweise auf das Rätsel seiner Existenz bieten. Aber mit den Erinnerungen kommt auch neues Unbehagen (eine bezeichnende Kapitelüberschrift lautet Schlechte Nachrichten, und es kommt noch schlimmer), und als nach dem ersten Romanviertel eine leichte Beruhigung eintritt, ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme.
Ganz offensichtlich ist etwas mächtig schiefgegangen. Das ist dem Lehrer ebenso klar wie dem kleinen Häuflein anderer Überlebender, das sich um ihn versammelt; darunter einige körperlich veränderte Menschen und ein Kunstgeschöpf mit mörderischen Fähigkeiten, aber lauterem Charakter. Das Schiff ist krank, stellt einer von ihnen fest. Doch was konnte das gigantische Schiff - ein Konstrukt von drei jeweils zwölf Kilometer langen Archen, die mit einem Kometen bzw. "Eismond" verbunden sind - vom Kurs abbringen? War es ein Unfall, Sabotage oder ein interner Konflikt? Wer ist die ominöse Reiseleitung, und wer die nicht weniger rätselhafte Mutter, von der das Mädchen spricht? Ihre Suche nach Antworten wird die kleine Gruppe aus dem feindlichen Habitat, in dem sie erwacht sind, in den benachbarten Schiffskörper 03 (daher der Originaltitel) führen. Des Rätsels Lösung kommt dann nicht in Form einer einzigen großen Enthüllungspassage, sondern nach und nach, ganz wie die Erinnerungen der Romanfiguren.
Was die Action-Handlung betrifft, erinnert Bears Roman an so manchen Klassiker. Mit Arthur C. Clarkes "Rendezvous mit Rama" etwa teilt er die Erkundung eines Raumriesen, dessen monumentale Binnenarchitektur immer wieder beeindruckt. Wenngleich hier nicht unbeschwert durch die (Teil-)Schwerelosigkeit geturnt werden kann und der Gesamteindruck viel klaustrophobischer ist. Die Begegnung mit "Monstern" in einer Abfallbeseitigungsanlage hingegen - die kennen wir doch aus "Krieg der Sterne". Wurde George Lucas' Film seinerzeit die Plot-Struktur eines Video-Spiels zugeschrieben, dann ist der Vergleich auch hier nicht von der Hand zu weisen: Schließlich kämpfen sich Bears Figuren wortwörtlich von Ebene zu Ebene und von Gefahr zu Gefahr. Und wenn sie sich erst mal zu einem zentralen Punkt des Schiffs vorgearbeitet haben und ihrerseits beginnen, die Möglichkeiten der vorhandenen Supertechnik für sich zu nutzen, dann ist das gar nicht so weit entfernt von Philip José Farmers "Das magische Labyrinth" bzw. "Götter der Flusswelt": Endlich im geheimnisvollen Turm am Pol der Flusswelt angekommen, erfuhren Farmers ProtagonistInnen nicht nur den Hintergrund des großen Konflikts, der ihr gesamtes Leben als Wiedererweckte geprägt hatte. Sie mussten auch erkennen, dass jemand aus ihren Reihen falsches Spiel treibt - ganz wie es in "Das Schiff" der Fall ist.
Nachdem einem der Roman auf den ersten 100 Seiten mit Existenzialismus quasi ins Gesicht gesprungen ist, beschränkt er sich hinterher erst recht nicht mehr auf bloße Action um der Action willen. Bear konfrontiert seine RomanheldInnen damit, dass sie alles in Frage stellen müssen: Die Authentizität ihrer Erinnerungen, welche genauso "maßangefertigt" sein könnten wie ihre Körper, ihre Identität als eigenständig handelnde Personen (bzw. überhaupt als Personen) und letztlich die ethischen Rahmenbedingungen des hoffnungsvollen Kolonialisierungsprojekts an sich. Hübsch hässliche Einblicke ins Wesen des Menschen, verbunden mit großem visuellen Einfallsreichtum und durchgängig hohem Tempo machen "Das Schiff" zu einem rundum gelungenen Genre-Roman. Mich zumindest hat er gepackt.
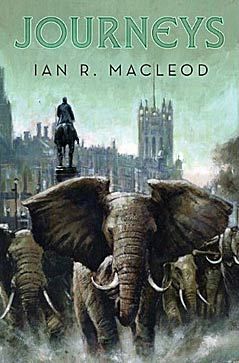
Ian R. MacLeod: "Journeys"
Gebundene Ausgabe, 231 Seiten, Subterranean Press 2010
"Aether" (im Original "The Light Ages") heißt der bislang einzige ins Deutsche übersetzte Roman des britischen Autors Ian R. MacLeod und handelt von der Ära der Industrialisierung in einer Welt, die ein bisschen magieerfüllter ist als die unsere. Diesen Hintergrund haben auch einige der insgesamt neun Erzählungen, die im Band "Journeys" zusammengefasst sind und im Zeitraum zwischen 2006 und 2010 entstanden. MacLeod räumt freimütig ein, dass ihm das Kurzformat mehr am Herzen liegt als das lange, und er ist auch richtig gut darin.
MacLeods Reisen gehen in verschiedene alternative Welten - zum Beispiel in "The Hob Carpet" zu einer vergessenen voreiszeitlichen Hochzivilisation, die der Beschreibung nach auf dem indischen Subkontinent angesiedelt sein könnte. Die Menschen leben hier in unvorstellbarem Luxus - alle Arbeiten (und sogar ein Teil der Körperfunktionen) werden ihnen von den Hobs abgenommen; Menschen auch sie, wenn auch vermutlich keine Vertreter des Homo sapiens. Die wimmelnden Scharen der Hobs werden noch achtloser behandelt als die Underpeople bei Cordwainer Smith: Kastriert und mit herausgeschnittener Zunge fungieren sie als Sklaven, Rohmaterial für Massenopferungen und Möbelstücke ... wie besagter Hob-Teppich, eine sexuell aufgeladene Bewegungs- und Fleischmaschine, die den erkrankten Protagonisten der Erzählung durch seinen Palast trägt. Und ihn für sein Leben prägt - bis er zum Darwin seiner Kultur und zum Außenseiter wird.
Eine Reise ganz anderer Art muss der junge Terry in "The Camping Wainwrights" über sich ergehen lassen, einer Erzählung, die gänzlich ohne Phantastik-Elemente auskommt und doch in Sachen Suspense-Faktor alle anderen Geschichten in den Schatten stellt. Alljährlich wird Familie Wainwright vom Papa auf verregnete Camping-Trips verschleppt, auf denen auch noch dauernd irgendetwas schief geht. Das wirkt anfangs ziemlich komisch - etwa wenn Terry vor seinem Vater Reisebüro-Broschüren unter dem Bett versteckt wie seine Altersgenossen die "Penthouse". Doch mit der Zahl der kleinen Camping-Missgeschicke wächst das Unbehagen. Langsam drängt sich der Eindruck auf, beim Vater handle es sich um einen menschlichen Poltergeist, der sich am Unglück der anderen weidet ... vom Autor wird dies immer hübsch offen gelassen und mit einigen schockierenden Wendungen versehen. Großartig! - "The Camping Wainwrights" bildet gewissermaßen ein Ende des MacLeodschen Spektrums - "On the Sighting of Other Islands" wäre das andere: Eine Legende in Miniatur-Form oder vielleicht besser gesagt eine Parabel von einer schwimmenden Stadt, die über das Weltmeer treibt, hin und wieder andere Städte sichtet und deren Umrisse wie Horoskope interpretiert, niemals jedoch zu ihnen in Kontakt tritt.
Analog zum zuvor genannten "Aether" steht auch das England von "The Master Miller's Tale" im Bann der beginnenden industriellen Revolution. Die Reise ist hier Folge einer Entwurzelung: Nathan Westover, letzter Vertreter der altehrwürdigen Zunft, die ihre Windmühlen noch mit Magie betreibt, verliert gegenüber den aetherbetriebenen Dampfmaschinen und Fabriken des neuen Zeitalters immer mehr an Boden. Müller und Mühle sind eins, und so droht Nathan nicht nur seinen Broterwerb, sondern sich selbst zu verlieren. In zorniger Verzweiflung schließt er sich einer ironischerweise Men of the Future genannten Untergrundorganisation an, die Sabotageakte gegen Maschinen durchführt, und nimmt einen Kampf auf, den er niemals gewinnen kann. - Veränderungen stehen auch in "Elementals" an, und wieder finden wir uns in einer Szenerie des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts wieder. Erst scheint es sich um einen nostalgischen Rückblick auf eine Ära kruder Feen- und Geistermoden zu handeln, doch rasch wird daraus eine Geschichte über einen gesellschaftlichen Wandel, der Gewinner und Verlierer hervorbringt. Und die neue Zeit fördert die Harten - sie wird mit einem mörderischen Betrug eingeläutet und mündet in Andeutungen über das große Geschäft der Zukunft: Krieg.
Melancholie ist die vorherrschende Stimmung in den meisten Erzählungen - so auch in "Taking Good Care of Myself", wo ein Zeitreisender dazu verpflichtet wird, als sein eigener Sterbebegleiter zu jobben. Oder in "Topping off the Spire": Hier muss ein mittelalterlicher Priester den Schlussstein auf eine neuerrichtete Kathedrale setzen. Panische Höhenangst hält ihn im Griff, und doch erkennt er in einem Moment der Erleuchtung, dass die Ausbreitung des Christentums die Wunder der alten Welt buchstäblich einmauern wird. Und der Aufstand der britischen Bevölkerung gegen ihre indischen Kolonialherren in "The English Mutiny", der ist natürlich zum Scheitern verurteilt - daran lässt die im Rückblick erzählte Geschichte von Anfang an keinen Zweifel. MacLeod geht es dabei nicht um die simple Pointe, die Geschichte des Kolonialismus umzudrehen, er illustriert, wie historische Meilensteine durch den Zufall gesetzt werden können: Eine Naturkatastrophe war es, die England so schwächte, dass es vom Mogulreich erobert werden konnte. Und banale persönliche Befindlichkeiten sind es, die in London die Revolution entfachen. Im Vordergrund steht dabei nicht die alternative Historie selbst, MacLeod geht es um die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren, dem schlichten Davey Whittings und dem charismatischen Adeligen Johnny Sponson, der zum Revolutionsführer und schließlich zum selbstherrlichen Pascha mutiert.
Statt dem eher oberflächlichen Leitmotiv "Journeys" sollte der Band vielleicht "Changes" heißen. Immer wieder beobachten wir aus den Augen von jemandem, der sich selbst als nicht besonders klug oder sonstwie bemerkenswert deklariert, wie sich eine andere, strahlendere Figur wandelt und ihre Aura Risse bekommt. So ist es mit Davey und Johnny, aber auch mit dem kleinen Terry und seinem dämonischen(?) Vater in "The Camping Wainwrights" oder dem Ich-Erzähler von "Elementals" und seinem die Elementargeister erforschenden Kollegen im Gentlemen's Club. Am stärksten tritt dies in der letzten Erzählung, "Second Journey of the Magus", zu Tage: 30 Jahre nach seinem ersten Besuch tritt Balthasar, der letzte noch lebende "Weise aus dem Morgenland", noch einmal die Reise nach Israel an. Und findet ein Land vor, in dem die Straßen mit Gold gepflastert sind und Engel Armeen zu Eroberung der gesamten Erde ausbilden. Hier hat Jesus das Angebot in Matthäus 4,5-9 angenommen - und MacLeod lässt den angehenden König der Welt darüber philosophieren, ob dieser Weg nun besser oder blutiger als der andere ist, der ihm offengestanden hätte. Gerät der Wink mit dem Alternativwelten-Zaunpfahl in "The Hob Carpet" noch ein wenig aufdringlich, so besticht "Second Journey" gerade durch seine ambivalente Conclusio. Ein Highlight in einer an Highlights nicht armen Story-Sammlung, empfehlenswert!

Carlton Mellick III: "Ultra Fuckers"
Gebundene Ausgabe, 124 Seiten, € 13,20, Festa 2011
And you may find yourself in a beautiful house, with a beautiful wife. And you may ask yourself - Well ... How did I get here? And you may tell yourself: This is not my beautiful house! And you may tell yourself: This is not my beautiful wife! - Was genau Tony und seine Frau Tammy im Autoradio hören, während sie Stunden über Stunden durch die gesichtslosen Straßen einer Gated Community irren, darauf geht der Autor nicht näher ein - aber vielleicht waren ja auch die Talking Heads darunter. Noch eine urbane Vision also, und es ist die mit Abstand gruseligste in dieser Rundschau. Nicht zuletzt, weil es genau genommen eine suburbane ist, und im Vorwort bekennt Carlton Mellick III mit Verweis auf seine eigene Biografie eine tiefsitzende Angst vor nagelneuen, ordentlichen Vorstädten ohne Seele.
Wir befinden uns wieder im Reich der Bizarro-Literatur, dem Genre, das dem Absurden gewidmet ist. Vermutlich ist es auch nur hier möglich, dass sich ein literarisches Mikro-Phänomen allmählich zur Welle entwickelt, die aus einem Pool von mittlerweile Dutzenden AutorInnen gespeist wird ... und trotzdem immer noch gefühlte fünfzig Prozent der Titel aus der Feder eines einzigen stammen. Der von Mellick natürlich, dem prominentesten Bizarro-Vertreter - hier in der Rundschau war er bereits mit den Kurzromanen "The Cannibals of Candyland" & "Teeth and Tongue Landscape" sowie der Storysammlung "Sunset With a Beard" vertreten; und das werden nicht die letzten gewesen sein. Der Mann ist eben einfach spitze! "Ultra Fuckers", im Original 2008 veröffentlicht, ist nach den "Cannibals" das zweite Mellick-Buch, das in deutscher Übersetzung erschienen ist. Und wieder hat der Festa-Verlag es in wunderhübscher Weise aufgemacht: Gebunden, mit dem Original-Cover und einem Lesebändchen versehen; dazu leuchten die Seiten in Augenkrebs erregendem Orange. Sieht aus wie eine kleine Bibel der Devianz.
Eigentlich sollte Tony nur seine Frau zu einer Dinnerparty ihres Chefs begleiten. Doch als sie in der frisch aus dem Boden gestampften Siedlung Eagle Hills angekommen sind, finden sie dessen Haus nicht. Stunden vergehen, während sie genervt und miteinander streitend zwischen Häusern, die alle gleich aussehen, auf Straßen herumkurven, die alle Pueblo Street oder Pueblo sonstwas heißen. Weitere Stunden vergehen, nachdem sie den Partybesuch in den Wind geschossen haben und nun ebenso vergeblich nach der Ausfahrt aus der Siedlung suchen. Anfangs ist das noch ziemlich komisch - doch spätestens nach der ersten Begegnung mit einer Bewohnerin der Siedlung, die Tonys Kontaktversuche mit viehischem Schweigen quittiert, wird es unheimlich. Dass Tammy verschwindet und ein Fast-Food-Automat die Warnung "Hüten Sie sich vor den Zyklopen" ausspuckt, verstört Tony sogar weniger, als es die stillen BürgerInnen von Eagle Hills tun, die entsprechend ihren identischen Häusern allesamt die gleichen Gesichter haben und die gleiche Kleidung tragen: Fleischeinheiten in Wohneinheiten - Stepford ist nichts dagegen.
Tony fährt in einem silbernen Sedan die Pueblo Canyon Road entlang. Er hat ein Drittel der Strecke zum nächsten Ausgang aus der geschlossenen Wohnanlage Eagle Hills hinter sich gebracht und ist sechsundfünfzig Stunden und zweiundzwanzig Minuten zu spät zu einer Dinnerparty. Aus Stunden sind Tage geworden, illustriert durch Mellick-typische Wiederholungselemente, und immer noch ist Tony im vorstädtischen Albtraum gefangen. Alleine einer fremdartigen Umgebung ausgesetzt zu sein, ist vielleicht das zentrale Motiv in Mellicks Werk. Nicht immer erhält der Protagonist Hilfestellung - doch hier naht sie in zweifacher Weise: Zum einen - siehe Titelbild - in Form eines einäugigen Mädchens mit Latexkleid und einer Irokesenfrisur aus lebenden Goldfischen. Zum anderen in der eines japanischen Noisepunk-Trios, den Ultra Fuckers. Es wird sich in schockierender Weise klären, warum es Tony unmöglich ist aus Eagle Hills hinauszukommen, und so werden endlich die Weichen gestellt für den finalen Kampf zwischen Ordnung und Chaos, zwischen Gut und Böse ... und natürlich sind "Chaos" und "gut" deckungsgleich, nicht dass wir uns missverstehen. Aber werden die Ultra Fuckers es wirklich schaffen, die Vorstadt zu ficken?
Im Anhang gibt es noch ein Interview mit dem Autor und ein paar erläuternde Worte von Phantastik-Autor und -journalist Christian Endres zu Bizarro im Allgemeinen und Carlton Mellick III im Besonderen - eine Art Ausgleich dafür, dass die Erzählung selbst nur 100 Seiten lang ist. Mellick selbst bezeichnet sich als "Rausnehmer" - also jemanden, der die Rohfassung eines Textes lieber durch Auf-den-Punkt-Kürzungen besser macht als durch ergänzende Einfügungen - und schreibt: Wenn ich ein Buch so knapp wie möglich halten kann, bin ich glücklich. Ich stehe nicht darauf, einen Roman mit Füllstoff und Schmus aufzublasen. Ich liebe den Mann! Und wie unnötig wäre Füllstoff auch - auf 100 Seiten wird hier mehr an Gesellschaftskritik, Interpretationsspielraum und philosophischen Denkanstößen - kurz gesagt: an Relevanz - geboten, als andere AutorInnen zwischen 800 plattquetschen können. Unterschwellige Ängste und Hoffnungen der Gegenwart im Kleid einer fiktiven Welt ans Licht zu bringen ist eigentlich das, was sich die Phantastik auf die Fahnen geschrieben hat. Wobei gerade im Romanbereich nur allzuoft vor lauter Kleid dessen Inhalt aus den Augen verloren wird. Die im Schnitt sehr kurzen Bizarro-Werke lösen das gegebene Versprechen hingegen auffallend oft ein - zumindest solche wie dieses hier. Wie Endres holprig, aber wahr im Nachwort sagt: Es sind Bücher, die wieder verstärkt etwas in einem berühren.
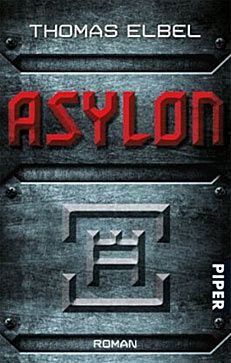
Thomas Elbel: "Asylon"
Broschiert, 441 Seiten, € 10,30, Piper 2011
Eine bzw. "die" letzte Stadt auf Erden, umgeben von einer Wüste ... klingt das bekannt? Dass "Asylon", Debütroman des deutschen Autors Thomas Elbel, in dieser Rundschau nicht unmittelbar hinter Arthur C. Clarkes "Die Stadt und die Sterne" gereiht ist, hat weniger damit zu tun, dass der Vergleich unfair wäre - er ist einfach nicht möglich. Wo es Clarke wirklich um die Zukunft und den möglichen Platz der Menschheit darin ging, zielt Elbel auf die Gegenwart ab und tut dies in Form eines Noir-Thrillers. Seine Stadt, erst spät im Roman als "Asylon" betitelt, ist auch kein hochtechnologisches Utopia, sondern ein Rattenloch. Eine Mauer, Minenfelder und Selbstschussanlagen sollen das letzte Bollwerk der Zivilisation gegen die Klimaflüchtlinge, die nach einer weltweiten Katastrophe angeblich noch durch die Einöde wanken, draußen halten. Nicht dass es drinnen so viel lebenswerter wäre: Asylon präsentiert sich als verwahrloster Architekturdschungel, der Rätsel in Sachen Statik und Ressourcenversorgung aufwirft - zumindest letzteres wird geklärt.
Asylon zerfällt in ethnische Viertel mit pittoresken Namen wie Thaitown, Balkana oder New Maghreb, die von mafiösen Clans mit Obermotzen wie Drei-Finger-Feng (da liegt ein Hauch Nick Knatterton in der Luft) beherrscht werden. Elbels originellste Idee sind die Leveller, eine der Polizei unterstellte, zugleich jedoch von ihr verachtete Spezialtruppe, die durch gezielte Tötungen für Machtausgleich zwischen den Clans sorgen soll. Dieses ungewöhnliche System funktioniert ganz gut - bis Masterleveller Torn Gaser eines Tages eine nicht abgesegnete Tötung in die Schuhe geschoben wird. Für Torn kommt es in rascher Abfolge knüppeldick: Er verliert seinen Job und steht fortan auf der Abschussliste der Clans, zudem erleidet seine Frau eine Fehlgeburt. Zumindest ist das die offizielle Version - sie selbst beharrt darauf, dass man ihr das Kind weggenommen habe, und verfällt dem Wahnsinn.
Zweite Hauptfigur des Romans ist die Technikerin Saïna, die - zunächst noch nichtsahnend - in zweifacher Weise mit Torn verbunden ist: Sie arbeitet in dem Krankenhaus, in dem Torns Frau entbindet, zugleich war sie die beste Freundin eines Minen-Opfers, das Torn zu Romanbeginn gefunden hat. Und schon stecken beide mitten in einem Geschehen, das sich um Politik, Lügen, gelöschte Identitäten, jede Menge Leichen und letztlich das große Geheimnis der Stadt dreht. Die Besetzung komplettieren einige Nebenfiguren in unerwarteten Doppelrollen, darunter ein Anwärter auf den fiesesten Psychopathen, den sich ein Autor nur ausdenken kann, ein Polizist, der fast genauso zynisch ist, und eine echt ehrliche Haut. Gelegentlich fällt die Personenzeichnung sehr plakativ aus, speziell was die StatistInnen betrifft. Sei es eine Harpyie in Krankenschwesternuniform oder ein "schmieriger" Gauner, der mal kurz durchs Bild huscht - man merkt zumindest immer gleich, wenn der Autor jemanden als unsympathisch verstanden haben will.
Was das Rätsel der Stadt betrifft, sei nur gesagt, dass wir hier nicht wie bei Andreas Brandhorsts vor kurzem erschienenem Roman "Die Stadt" bewusst im Unklaren gelassen werden. Alle, die eine eindeutige Antwort auf alle Fragen erwarten, werden diese auch erhalten. So ganz überraschend kommen die folgenden Plot-Wendungen dann zwar nicht (einen ersten sehr deutlichen Hinweis, dass die Dinge anders liegen dürften, als man in Asylon glaubt, gibt es am Ende des ersten Romanviertels), aber das tut der Spannung keinen Abbruch.
Probleme hat der Roman hingegen sprachlich: Immer wieder bremsen umständliche Formulierungen - ein unnötiges Attribut hier, eine Sprachunsicherheit da - die Dynamik der Situation ab oder lassen eine Stilblüte sprossen. Da gähnt nicht nur jeder Abgrund (warum Abgründe immer gähnen müssen, habe ich ohnehin nie verstanden), da gähnen dem Helden auch schon mal Mauern entgegen. Oder: Schneidender Grimm ergriff Besitz von ihm und benebelte seine Sinne. Und so weiter. Was sich als Einzelfälle betrachten (und vom Lektor ausmerzen) ließe. Problematischer ist hingegen, dass eine klar durchgezogene sprachliche Linie fehlt. Da flucht der Held - dem dreckigen Ambiente des Romans absolut angemessen - ordinär vor sich hin ... um gleich darauf auf seine vier Buchstaben zu fallen; und derlei Altbacken-Niedliches taucht immer wieder auf und beißt sich kräftig mit der Grind-Atmosphäre von Asylon. Kurz gesagt: Der Autor weiß, wie man eine solide Spannungsgeschichte konstruiert, hat aber noch nicht zu seiner Sprache gefunden.
... da das aber - mit Blick auf die durch die Bank positiven Reaktionen - niemanden groß zu stören scheint, wird Elbel mit Sicherheit die Gelegenheit bekommen, seinen Stil in weiteren Romanen zu schärfen. Es ist noch viel Luft nach oben.
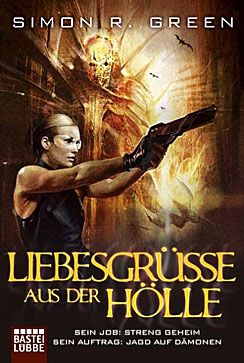
Simon R. Green: "Liebesgrüße aus der Hölle"
Broschiert, 446 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2011
"Warum bist du nicht tot?" "Ich bin drüber weg." - Auch im vierten Band seiner 007-goes-supernatural-Reihe um den Agenten Eddie Drood alias Shaman Bond (im Original "From Hell with Love", wie stets aus dem Titel eines Bond-Films abgeleitet) serviert Simon R. Green wieder Urban Fantasy mit einem Schuss ironischen Humor. Kurz innegehalten: Gibt's eigentlich auch eine andere? Ohne Humor oder ohne Schüsse? Egal, bei Green ist einfach der Schmäh gut, meistens zumindest, und mein letzter Eddie-Drood-Roman ("Krieg der Wächter") war ein einziges Vergnügen. Das durchaus an "Buffy" erinnernde Erfolgsrezept seiner Serie - nämlich pro Roman ein Apokalypse-Szenario zu entwerfen und dieses mit flapsigen Onelinern zu garnieren - hat der britische Autor erwartungsgemäß beibehalten. Und es ist Wohl und Wehe seiner Serie zugleich, wie sich noch zeigen wird.
Wer die Droods noch nicht kennt: Dabei handelt es sich kurz gesagt um einen in England ansässigen Familienclan, der die Welt seit Jahrhunderten vor übernatürlichen Umtrieben schützt und vor der Öffentlichkeit verborgen ein gewichtiges Wort in der Weltpolitik mitspricht; unterstützt von allerlei selbstentwickelter Supertechnik und seit kurzem auch einem außerdimensionalen Wesen mit dem mystischen Namen ... Ethel. - Das Weltuntergangspotenzial im aktuellen Roman wird in Los Angeles abgerufen, wo bei einer Auktion unter anderem die Apokalyptische Tür unter den Hammer kommen soll. Auf die hat es Möchtegern-Superschurke Doktor Delirium abgesehen, Alleinerbe einer Privatarmee und allseits ausgelachte Pfeife. Seine Weltherrschaftspläne dürfte er in Scott Seegerts Handbuch "Vordak der Unsägliche" nachgeschlagen haben, aber da auch ein blindes Huhn mal ein Korn findet, wird Eddie Drood schon zu Beginn des Romans ordentlich auf Trab gehalten: Unter anderem im Kampf mit einem Drachen, der dabei ein ebenso überraschendes wie unwürdiges Ende findet. Schade, das wird sich Peter Jackson mit Smaug nicht anstellen trauen.
Viel wichtiger ist jedoch der Umstand, dass Eddie im Zuge dieses ersten Kampfgetümmels zum ersten Mal von der Existenz von "Anti-Droods" erfährt, einem konkurrierenden Clan von Unsterblichen, der es sogar geschafft hat Eddies Familie zu infiltrieren. Mit verheerenden Folgen, denn schon kurz darauf wird die Matriarchin der Droods - eine Art Mischung aus Judi Dench und Josef Stalin - ermordet. Und schlimmer noch: Eddies Lebensgefährtin, die dissidente Hexe Molly Metcalf, wird der Tat beschuldigt und vom Schwiegerlynchmob getötet. Schluck, eine der Hauptfiguren tot. Oder so. Hat man "Liebesgrüße aus der Hölle" erst mal gelesen, kann man rekonstruieren, was Greens Plot-Konzept gewesen sein dürfte: Der trauernde Eddie startet einen Rache-Alleingang und für die schon aus früheren Bänden bekannten Blutbäder wird diesmal noch voller eingegossen.
Allein, der Gedanke versickert im routinierten Schreiben, und da ist Green mittlerweile zum Gefangenen seiner eigenen Schöpfung geworden. Von Erschütterung über Mollys Tod ist bei Eddie nämlich nicht viel zu bemerken. Ungebremst lässt er seine ironischen Scherzchen vom Stapel, und so nimmt man es Green eigentlich keine Sekunde lang ab, dass Molly wirklich für immer dahingeschieden bleiben wird. Warum auch, schließlich ist in einem Szenario, in dem sich Feenflüche in trautem Nebeneinander mit Subraumgeneratoren wiederfinden, ALLES möglich. Wie eingangs angerissen, ist dies Stärke und Schwäche der Drood-Romane gleichermaßen: Zum einen sind die Handlungsmöglichkeiten und einsetzbaren Mittel scheinbar unbegrenzt, Green kann frei von der Leber weg losfantasieren, und in seiner Revue von apokalyptischen Waffenkonzepten hätte ich zumindest über Mephistos Menuett gerne mehr erfahren. Zum anderen aber kann man irgendwie auch immer darauf vertrauen, dass sich letztlich schon ein quantenphysikalischer Höllenhut oder Dämonenpürierstab aus der Zukunft findet, der das Kind dann nach Hause schaukelt. Kein Wunder also, wenn der geplante Höhepunkt des Romans wie ein Soufflé in sich zusammenfällt. Was Green dann allerdings mit einer überraschenden Wendung auf den allerletzten Seiten wettmacht.
Dass der Plot unter seiner Vorhersehbarkeit leidet, heißt aber nicht, dass "Liebesgrüße aus der Hölle" nicht unterhaltsam wäre. Dafür sorgt schon die bewährte Mischung aus blutiger Action und Humor. Feuer, allgemeiner Aufruhr und ausufernde Vernichtung von Privatbesitz sind bei Drood-Einsätzen ohnehin stets garantiert, und diesmal wird in Form von Kapitel 7 sogar ein 23-seitiger Overkill geboten, der sich wie der Erlebnisbericht eines embedded journalist aus dem Inneren einer Faschiermaschine liest. Wie gehabt kontrastiert mit flapsigen Dialogen, als ginge es nicht um das Ende der Welt, sondern um den Ausgang eines Fußballspiels oder darum, mit welcher Telleranordnung man die Spülmaschine am vollsten kriegt. Oben drauf gibt's dann noch ein paar humoristische Highlights wie Eddies Begegnung mit einem versklavten Kobold im Hauptquartier des Feindes: "Ich brauche Informationen. Aufzeichnungen, Computer - kennst du Computer?" - "Ich bin ein Sklave, und nicht blöd. Ich lese jeden Monat die Wired." - "Verzeihung".
Im direkten Vergleich mit "Krieg der Wächter" scheint das Verhältnis von Gag-Anzahl zu Romanlänge diesmal nicht ganz ausreichend, da hätte wieder einmal das Wundermittel Kürzung einiges bewirkt. Zum Volumensausgleich würde sich dafür schön langsam ein Glossar anbieten. "Liebesgrüße aus der Hölle" ist zwar problemlos alleine zu lesen, doch tauchen laufend Begriffe aus früheren Romanen auf, die zumindest indirekt für die Gegenwart noch eine Rolle spielen, ohne aber neu erklärt zu werden. Sei es das Manifeste Schicksal, die Nulltoleranz, die Nightside (ein Verweis auf eine andere Serie Greens, die auf Deutsch bei Feder & Schwert erscheint), die Knights of London oder der Autonome Agent. - Ist nämlich ganz schön gewachsen mittlerweile, der Drood-Kosmos. Und auf Englisch wird nächstes Jahr schon der sechste Band erscheinen, auf Deutsch ist vorerst einmal Pause.
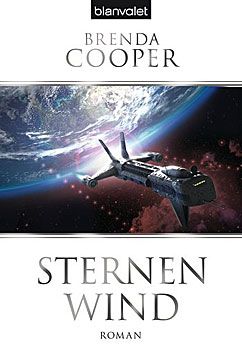
Brenda Cooper: "Sternenwind"
Broschiert, 432 Seiten, € 9,30, Blanvalet 2011
Geduld ist etwas anderes als Vergebung - einer der wichtigeren Sätze in Brenda Coopers Kolonial-Saga "Sternenwind", und hinter ihm steht eine jahrzehntelange Leidensgeschichte. Der alles in allem sehr erdähnliche Planet Fremont wurde einst von ein paar tausend Menschen besiedelt, die sich ihre körperliche Ursprünglichkeit bewahren wollten, während draußen in der Galaxis genetische Modifikationen längst ein Muss sind. Als in einer zweiten Welle just solche Modifizierte auf Fremont landeten, führte dies zu einem verlustreichen Krieg und der Vertreibung der Neuankömmlinge. Als Erbe des Konflikts sind sechs verwaiste Kinder - darunter Ich-Erzählerin Chelo - auf Fremont zurückgeblieben, die von den SiedlerInnen nolens volens adoptiert wurden. Jahre später, als aus den Kindern Teenager geworden sind, die sich nicht mehr so leicht kontrollieren lassen und überdies allmählich die Möglichkeiten ihrer diversen genetischen "Aufwertungen" entdecken, wächst das wechselseitige Misstrauen und mündet in einen offenen Konflikt.
Das wäre die gesamte Handlung in einem Absatz zusammengefasst - nun also zum Drumherum. Die US-Autorin Brenda Cooper hat bislang noch keine Bibliotheken gefüllt, kann aber immerhin schon auf einen SF-Roman zurückblicken, den sie gemeinsam mit Star-Autor Larry Niven geschrieben hat ("Building Harlequin's Moon"). "Sternenwind" (im Original "The Silver Ship and the Sea") war ihr erstes längeres Solo-Werk und bildete 2007 den Auftakt zu einer mittlerweile bereits abgeschlossenen Trilogie. Der englische Titel weckt fantasyeske Assoziationen, und das Low-Tech-Ambiente von Fremont sowie Teile des Plots scheinen dies zu stützen - mit Science Fantasy hat der Roman dennoch nichts zu tun. Hier gehen keine Telepathen auf esoterische Trips oder möblieren Alien-Dynastien ihre steinernen Burgen mit hochtechnologischen Versatzstücken. Cooper achtet sorgsam darauf, dass sie nicht in die Magie abdriftet - selbst da, wo dies zunächst den Anschein hat: Den Wind lesen nennt die Autorin nämlich die Gabe zweier genmodifizierter Kinder, sich geistig in die Datenströme des Fremontschen Umwelt-Monitorings einzuklinken. Später wird beiläufig erwähnt, dass die betreffenden Kinder kommunikationsfähige Nanomaschinen im Blut haben - Handwaving würde man im Englischen eine solche Schnell-Erklärung wohl nennen, aber immerhin.
Insgesamt wirkt das Bedürfnis der kleinen Kolonie nach dichtestmöglicher Simultan-Info über ihre Umwelt doch ein wenig aufgesetzt - schön, wenn man weiß, wann Meteoriteneinschläge und Erdbeben bevorstehen. So richtig sinnvoll wäre es aber nur, wenn man auch die technischen Mittel hätte, auf solche Bedrohungen zu reagieren. Das Netzwerk an "Datenkapseln" bleibt aber das einzige permanent genutzte HighTech-Erbstück aus der Vergangenheit, ansonsten geht es eher bukolisch zu. Da wird die Handwerkskunst gepflegt, Tauschhandel betrieben und auf Gebras genannten klugen Huftieren geritten; die Amischen hätten sich hier durchaus zuhause gefühlt. Und Fremont ist auch keineswegs die Höllenwelt, zu der sie im Klappentext stilisiert wird: Weder Vulkanausbrüche noch Meteoriteneinschläge spielen für die Handlung eine Rolle, das Fremontsche Gras, das Arme und Beine bis auf den Knochen aufschlitzen kann, fügt an einer einzigen Stelle Chelo ein paar kleinere Ritzer zu (die hätte mal sehen sollen, was die verdammte Mini-Palme meiner Mama, die wir jeden Herbst aus dem Freien in den Wintergarten zurückschleppen mussten, mit mir gemacht hat!), und die örtlichen Raubtiere sind weder so gewaltig, wie es der Klappentext suggeriert, noch so fremdartig, wie Cooper glaubt. Noch vor 12.000 Jahren haben unsere Vorfahren Exotischeres gesehen. Alles im Rahmen also.
Vieles in Coopers Roman ließe sich unter dem Stichwort "soft" zusammenfassen. Letztlich gilt dies auch für das Human Drama, auch wenn hier die eigentliche Stärke des Romans liegt - im Hoffen, Bangen und Mitleiden mit grundsympathischen Identifikationsfiguren als ProtagonistInnen. Dass wir durchgehend bei einer Perspektive - der von Chelo - bleiben, ist ein mindestens so Young-Adult-typisches Element wie das Alter der ProtagonistInnen selbst oder der Plot, der sich um Reifung und Selbstfindung unter erschwerten Umständen dreht. Der zentrale Satz des Romans, exakt in dessen Mitte platziert, lautet folgerichtig: "Doch zuvor musst du lernen, wer du bist, und entscheiden, was du willst" - und so durchleben Chelo und ihre fünf Unterartgenossen inmitten all der SF-Elemente eben auch ihr persönliches "Dawson's Creek"-Szenario. Wirklich reif ist dann die Auflösung des Konflikts, nicht zuletzt weil Cooper dankenswerterweise darauf verzichtet, die erwachsenen KontrahentInnen ihrer Hauptfiguren als eindimensionale Bösewichte zu schildern.
Was "Sternenwind" auszeichnet, ist die langsame und überaus glaubhaft geschilderte Eskalation des Konflikts innerhalb der Kolonie - bis hin zum dramatischen Höhepunkt, wenn sich Familienmitglieder unter Waffen gegenüberstehen. Allerdings wäre daraus vor 30, 40 Jahren höchstens ein 200-Seiten-Roman geworden, und es hätte nichts gefehlt. Nichtsdestotrotz hatte Cooper Größeres im Auge - wie gesagt handelt es sich um den ersten Band einer Trilogie, der zweite ("Das silberne Schiff", im Original: "Reading the Wind") wird im März erscheinen.
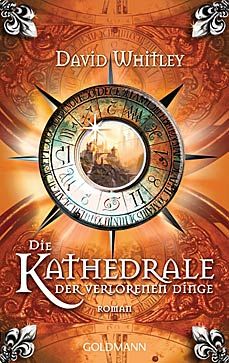
David Whitley: "Die Kathedrale der verlorenen Dinge"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Goldmann 2011
Three times lucky! An dieser Stelle war ursprünglich Ann Aguirres "Die Enklave" (Blanvalet) eingeplant. Ihren postapokalyptischen Roman will die US-Autorin als "romantische Dystopie" verstanden wissen - und fast so dümmlich wie diese unsägliche Wortkombination war er dann leider auch. Ging gar nicht. Als Ersatz bot sich die Storysammlung "Die darbenden Schatten" der Deutschen Eddie M. Angerhuber (Atlantis) an, das war dann eher eine Frage des persönlichen Geschmacks. An schreiberischer Intelligenz ist Angerhuber Aguirre turmhoch überlegen, und die straighter erzählten Horror-Geschichten in der Sammlung haben Qualität. Leider bin ich aber an denen gescheitert, in denen das Grufti-Pathos über Weltekel, Niedergang und traulich quakende Frösche gar zu sehr an die Oberfläche steigt, und habe das Buch vorzeitig zugemacht. "Die Enklave" hat ihren Platz in der Altpapiertonne gefunden (soviel zum treuherzigen Nachwort der Autorin: "Ich hoffe, meine Apokalypse hat euch gefallen"), "Die darbenden Schatten" ruht für eine eventuelle spätere Verwendung in der Nähe der Christian-Death-Platten, die irgendjemand - vermutlich ein vergessenes, sehr viel jüngeres Ich - in mein Regal gehext hat. Und plötzlich klafft da in der Rundschau eine Lücke.
Aber - Ka-ching! - schon liegt das nächste Buch auf dem Tisch, und das passt sogar ganz wunderbar zum diesmonatigen Urbanitätsschwerpunkt: Nämlich die Fortsetzung des vor zwei Jahren erschienenen, überraschend guten Fantasy-Romans für jüngere LeserInnen "Die Stadt der verkauften Träume" von David Whitley; und der Brite hält sein Niveau. Am Ende des ersten Bands haben die beiden Früh-Teenager Mark und Lily die seltsame Stadt Agora verlassen - versehen mit einem höchst unklaren Auftrag und nicht ganz freiwillig. Speziell Mark möchte um jeden Preis in die Stadt zurück. Geht aber nicht. Nachdem sie also erst einmal die gar nicht so kleine Überraschung verdaut haben, dass es außerhalb Agoras tatsächlich eine Welt gibt, irren die beiden hilflos umher, bis sie in das Dorf Aecer gelangen und dort ein Gesellschaftsmodell vorfinden, das dem Agoras komplett entgegengesetzt zu sein scheint. Waren die BewohnerInnen Agoras für jede Alltagsverrichtung zum Eingehen von Handelsverträgen verpflichtet und glitt ein wachsender Teil der Bevölkerung in die Verschuldung ab, so präsentiert sich Aecer als egalitäre Gesellschaft, in der jeder gleich viel (bzw. wenig) hat und alles dem Gemeinwohl untergeordnet wird. Schon bald wird sich aber zeigen, dass auch Aecer eine dunkle Seite aufweist.
Während im ersten Band Mark im System aufging (bis es ihm übel mitspielte) und Lily eine dissidente Rolle einnahm, so ist es nun sie, die sich mit der neuen Umgebung wesentlich besser arrangiert als Mark, dem die rituellen Gebete im Dorf und der allgemeine Harmoniezwang von Anfang an unheimlich sind. Und das ist alles andere als eine Zufallskonstruktion: Der Autor arbeitet extrem viel mit Dualismen - etwa mit dem von Stadt und Land und ihren gegensätzlichen Gesellschaftsmodellen oder mit der Gegenüberstellung des Ordens, dem der örtliche Priester angehört, und des Zirkels von "Hexen", die in der Wildnis außerhalb Aecers und verwandter Dörfer das ungezügelte Leben verkörpern. Der ausgeprägteste Dualismus ist natürlich der von Mark und Lily selbst - im letzten Kapitel von "Die Kathedrale der verlorenen Dinge" und insbesondere den beiden Schlusssätzen wird dies noch einmal extrafett unterstrichen. Mark und Lily wissen, dass sie in einem Spiel als Protagonist und Gegenspieler vorgesehen sind ... wenn auch nicht, was das bedeutet, und ohne dass es ihre Freundschaft gefährden würde. Es geht nicht um Gegnerschaft - ihre mysteriöse Funktion sollen sie gleich und entgegengesetzt wie Waagschalen ausüben. Das Thema Gleichgewicht wird ihnen überall begegnen, und so langsam beginnen sie dies als Tarnbezeichnung für Stagnation und Ungerechtigkeit zu betrachten: "Keine Namen, keine Gesichter - sie beherrschen uns durch Unwissenheit, lassen uns alle glauben, nichts könne sich jemals ändern", denkt Lily schließlich. So sehr der Autor auch alles offen hält (Band 2 endet noch abrupter als Band 1), schält sich doch langsam heraus, dass Mark und Lily ein notwendiges Element der Unruhe verkörpern.
Ein Drittel des Romans handelt in der zurückgelassenen Stadt, als ProtagonistInnen wechseln sich Figuren ab, die das Geschehen im ersten Band maßgeblich beeinflussten; wer den nicht gelesen hat, könnte hier Anschlussschwierigkeiten bekommen. Unruhen und Umbrüche, sowohl innerhalb von Agoras Polit-Kaste als auch auf der Straße, läuten das Ende des vermeintlichen "Goldenen Zeitalters" Agoras ein. Dabei spielt die abwesende Lily eine ungeahnt wichtige Rolle: Dass sie inmitten eines erbarmungslos kommerziellen Systems das erste Almosenhaus für Mittellose geleitet hatte, lässt sie rückwirkend - inklusive ihrer ersehnten Rückkehr - zu einer eindeutigen Heilandsfigur mutieren. Und so etwas wird bekanntlich gerne instrumentalisiert, vor allem wenn der/die Abwesende sich nicht mehr selbst dazu äußern kann. Die religiöse Motivik ist unverkennbar - diejenigen, die Lilys Wirken auf höchst unterschiedliche Weise auslegen oder sich zunutze machen, tragen Namen wie Crede, Theophilus oder Benedicta. Generell haben Eigennamen in Whitleys vor Allegorien und Symbolismen strotzendem Roman so einige Aussagekraft über den Charakter des betreffenden Menschen oder Orts.
Sollte jetzt jemand den Eindruck bekommen, dass David Whitley seinen Roman ein wenig auf der abstrakten Seite angesiedelt hat, dann ist das gar nicht so unberechtigt. Auf ausschweifende Beschreibungen legt er jedenfalls keinen Wert, zudem ist die Sprache klar und einfach gehalten ... aber absolut angemessen. "Die Kathedrale der verlorenen Dinge" ist als Young Adult gelistet und die Aufmachung der Originalausgabe ("Children of the Lost", 2010) betont dies stärker als die deutsche Ausgabe. Doch Whitley bestätigt damit nur den Trend der letzten Jahre, dass aus dem YA-Fantasy-Bereich immer öfter Bücher kommen, die auch für Erwachsene interessant sind. Die Zukunft der menschlichen Gesellschaft und die Rolle des Einzelnen darin ... der Vergleich mit "Die Stadt und die Sterne", der sich innerhalb dieser Rundschau einfach anbietet, mag auf den ersten Blick schräg wirken. Aber auch wenn Whitley letztlich vermutlich auf andere Antworten kommen wird als einst Arthur C. Clarke, so stellt er doch dieselben Fragen. - Der Abschlussband "The Canticle of Whispers" soll noch heuer erscheinen. Wie hieß es am Ende der "Es war einmal der Mensch"-Folgen doch immer? Ihr müsst unnnnnbedingt gucken, wie's weitergeht.
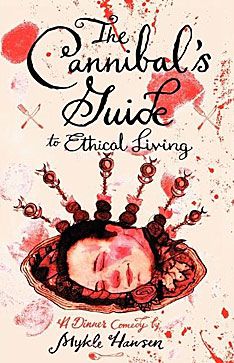
Mykle Hansen: "The Cannibal's Guide to Ethical Living"
Broschiert, 165 Seiten, Eraserhead Press 2011
Was sag ich immer über die Bedeutung des ersten Satzes einer Erzählung? Erst mal den hier überbieten: I've got to stop eating millionaires. Bizarro-Autor Mykle Hansen, der mit der (Selbst-)Zerfleischungsorgie "Help! A Bear Is Eating Me!" einen der lustigsten, weil bösesten Romane der letzten Jahre vorgelegt hatte, ist dem Thema Gaumenfreuden treu geblieben, und auch im zweiten Gang liegt Menschenfleisch auf dem Teller. (Dazwischen gab es noch die Storysammlung "Rampaging Fuckers of Everything on the Crazy Shitting Planet of the Vomit Atmosphere", das die Bizarro-typische Titelfindung unappetitlich aufs Korn nahm, aber das war bloß der Magenbitter zwischendurch.)
Diesmal geht es um den renommierten Gastro-Kritiker Louis de Gustibus, der von seinem alten Bekannten André auf dessen schwimmendes Luxus-Restaurant "L'Arche" eingeladen wird. Und sich dort mit Andrés ganz spezieller Menükarte konfrontiert sieht. Als literarische Bezüge führt Hansens Verlag Michael Pollans "Das Omnivoren-Dilemma" und Jonathan Safran Foers "Tiere essen" an, aber neben diesen eher harmlosen Büchern und galligen Filmkomödien wie "Eat the Rich" oder "Last Supper" liegt wohl auch Jean Ziegler nicht fern. Siehe etwa Andrés Bild von Finanzjongleuren als "Kühen, die einander melken, ohne sich zwischendurch Zeit zum Grasen zu nehmen". Man beachte: Es geht nicht einfach nur darum Menschen zu essen, sondern ausschließlich Millionäre, und in Andrés Suada zur Begründung seiner Essgewohnheiten klingt jede Menge echte Verbitterung des Autors über ökonomische Missverhältnisse an.
Ein paar Argumente gefällig? Aber bitte: Schließlich sind in einer zu Tode geschröpften Welt Millionäre die letzte gedeihende Megafauna des Planeten, und: They were not raised in stacked boxes, unable to stand, injected with growth hormones and forced to shit upon one another. Millionaires are the definition of free-ranging; they're as ethically clean as they are flavorful and nutritious. Des weiteren ist das Team von "L'Arche" sehr bemüht, Millionären die Leidensfähigkeit zurückzugeben, die diese an den Rest der Menschheit "verloren" haben: Here at L'Arche we return their lost suffering to them. We help them to understand how the other half hurts. That is but one of the many elite services we provide. - Und derart zündende Argumente werden schon früh im Roman verballert; man fragt sich doch, was da noch kommen mag!
Die Antwort liegt im äußeren Rahmen, in dem André seine Schilderungen - "The Cannibal's Guide to Ethical Living" ist wie schon zuvor "Help! A Bear Is Eating Me!" in Monolog-Form geschrieben - abspult. Denn Louis und André führen nicht etwa ein philosophisches Tischgespräch in kultiviertem Ambiente, hier ist schon vor Beginn des Romans alles den Bach runter gegangen: Am Boden wimmeln Ratten durch Blutlachen und vor der Kombüse tobt Psychopath Marko, der Kapitän des Restaurantschiffs. Auf der nahegelegenen Insel Cristobal Minor - irgendwo in den verseuchten Gewässern des Great Pacific Garbage Patch - haben sich bewaffnete Eingeborene zusammengerottet und noch weiter draußen ziehen raketenbewehrte Millionärsyachten ihre Kreise. Ein mehrfacher Belagerungsring, und in dessen Zentrum liegt der arme Louis de Gustibus gefesselt und geknebelt unter Deck. Geknebelt zumindest, solange er nichts zu schlucken bekommt.
"The Cannibal's Guide to Ethical Living" gerät zu einem intensiven (Entschuldigung für das grässliche Wortspiel) Speisekammerspiel, in dessen Verlauf die vergangenen Geschehnisse und das Beziehungsgeflecht zwischen den Protagonisten langsam aufgedröselt werden; auch das eine Struktur, die Hansen aus "Help! A Bear Is Eating Me!" übernommen hat. Besonders schauderhaft dabei ist Andrés zwiespältiges Handeln: Zum einen will er Louis vor dem tobenden Marko schützen, zum anderen erweist er sich mit seinen "Rettungsmaßnahmen" als die viel konkretere Gefahr. Das Dilemma des Monats: Was tun, wenn man von einem psychisch labilen Kannibalen als Versteckmöglichkeit wahlweise den Ofen oder einen großen Topf angeboten bekommt? Dazu hagelt es jede Menge Pointen, blasphemische Ausflüge - etwa über Adam, Eva und die berühmte Rippe - und Sätze, die die Absurdität der Situation derart auf die Spitze treiben, dass man einfach wegbricht: "Just open wide, bite down ... no, don't spit it out Louis! Eat your millionaires, they're good for you."
Vor genau zehn Jahren und vier Monaten hat ein einziges Buch (der Titel ist mir mittlerweile leider entfallen) ausgereicht, mich zum Vegetarier zu machen. Bin ich froh, dass ich mittlerweile nicht mehr so leicht zu beeinflussen bin.

Sascha Mamczak, Sebastian Pirling & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction Jahr 2011"
Broschiert, 1.307 Seiten, € 30,90, Heyne 2011
Ich habe schon lange geargwöhnt, dass Heynes "Science Fiction Jahr" der heimliche neunte Planet des Sonnensystems ist - die Masse spricht eindeutig dafür. Und ein zweites Indiz schält sich auch langsam heraus: Es vollendet allmählich seine Bahn durchs Sonnenjahr. Was damals in den 80ern für eine Veröffentlichung zum Jahreswechsel geplant war, rutschte dann in den Frühling und hat sich anschließend so nach und nach durch den Sommer bis in den Herbst vorgearbeitet; Stichdatum war heuer September. Es ist absehbar, wann der Orbit vollendet sein wird ... vorausgesetzt es kommt nicht alles ganz anders, denn im Vorwort der aktuellen Ausgabe fällt eine ominöse Andeutung über ein neues Konzept für dieses nach wie vor unverzichtbare Stück Sekundärliteratur. Hauptsache, es bleibt erhalten!
Und diesmal geht es mitten hinein ins Herz des Genres - der heurige Themenschwerpunkt heißt "Future Histories". Die können von einigen hundert (Robert A. Heinlein) bis zu Milliarden Jahren (Olaf Stapledon) in die Zukunft reichen; unter den Autoren, die sich dem Thema widmen, findet sich unter anderem auch Stephen Baxter, der selbst schon sehr, sehr langfristige Ausblicke in die Zukunft unternommen hat. Die Herangehensweisen sind erfrischend unterschiedlich: Während "Vilm"-Autor Karsten Kruschel in seinem mit zahlreichen Beispielen gespickten Beitrag argumentiert, dass Future Histories und die SF im Allgemeinen nie auf die Zukunft abzielen, sondern Spielwelten zum Verständnis der Gegenwart entwerfen, nimmt Jahrbuch-Herausgeber Sascha Mamczak eine Gegenposition ein: Er betont, dass Future Histories, egal wie unterschiedlich, in erster Linie zeigen, dass es überhaupt irgendwie weitergeht, und die Zukunft damit als beeinflussbaren Prozess darstellen. Stets spannend sind Texte des kanadischen Querdenkers John Clute. In "Die helle und die dunkle Seite des amerikanischen Traumes" widmet er sich dem verblüffenden Beziehungsgeflecht zwischen Future Histories aus dem "Goldenen Zeitalter" der Science Fiction, Verschwörungstheorien und der Gedankenwelt von Scientology. Den Themenblock ergänzen Porträts der großen Autoren Heinlein, Stapledon, Asimov (eine Paperback-Ausgabe von dessen "Foundation"-Trilogie erscheint im Jänner bei Heyne) und der Brüder Strugatzki. Fehlt da noch ein Name? Richtig: "Perry Rhodan". Ein Beitrag ist auch der Heftserie gewidmet, die heuer in der Realzeit ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, an Handlungszeit aber bereits Dimensionen überspannt, dass im Vergleich dazu die Historie sämtlicher "Star Wars"-Buchreihen zusammengenommen wie eine Momentaufnahme wirkt.
Zum Schwerpunkt Literatur gehören neben 100 Seiten Buchrezensionen und den Marktberichten im Schlussteil des Wälzers noch Interviews mit zwei Autoren, die die LeserInnenschaft immer wieder polarisieren: Zum einen Peter Watts, Autor der gelinde gesagt grimmigen "Rifters"-Trilogie, der offenbar auch im wirklichen Leben recht streitbar veranlagt ist. Zum anderen Adam Roberts, den man im deutschsprachigen Raum leider fast nur noch als Autor von Genreparodien wie "Der kleine Hobbnix" oder "Star Warped - Die Krieg der Sterne-Parodie" kennt. Dabei veröffentlicht der Brite am laufenden Meter Romane, die mit Einfallsreichtum in Sachen Setting und Struktur verblüffen - mit "Yellow Blue Tibia" und "Swiftly" war er hier schon vertreten, nächsten Monat folgt sein brandneues Werk "By Light Alone". Außerdem nimmt SF-Biograf Gary K. Wolfe das Subgenre Weltuntergangsroman näher unter die Lupe, das er im übrigen eher als Weltneugeburtsroman betrachtet. Was er mit zahlreichen Beispielen illustriert - und jüngere LeserInnen mögen vielleicht staunen, dass in einem 35-seitigen Essay über Apokalypsen kein einziges Mal das Wort "Zombie" fällt.
Traditionell behandelt das Jahrbuch den Filmbereich genauso umfangreich wie die Literatur; immerhin ist hier vor allem die SF sehr viel stärker im Mainstream verankert als beim gedruckten Wort. Neben gut 150 Seiten Filmrezensionen (erstaunlich, was alles nur auf DVD erscheint!) gibt es heuer Beiträge unter anderem zu "Metropolis" und - ein Nachtrag zum Franchises-Schwerpunkt des Vorjahres - zu "Alien". Im Zentrum steht dabei die aberwitzig pleiten- und pannenreiche Entstehungsgeschichte von "Alien 3" - und wir erfahren, was wir so alles an unverwirklicht gebliebenen Ideen verpasst haben: Zum Beispiel ein Alien im Einkaufszentrum, einen Planetoiden aus Holz oder ein ... Alien-Schaf. Einem interessanten, weil selten behandelten Thema hat sich Uwe Neuhold in einem ausführlichen lexikalischen Teil gewidmet, nämlich den "Soundwelten der Science-Fiction-Filme". Was nicht nur auf die Musik bezogen ist, sondern auch auf Toneffekte wie etwa das bekannte "Warp-Geräusch". Vergnügliches Highlight in der Aufzählung ist der "Wilhelm-Scream": ein Schmerzensschrei aus einem 1953er Western, der seitdem wieder und wieder recycelt wurde, wie Neuhold in einer dreiseitigen Aufzählung von Filmtiteln zeigt. Weniger informativ, weil gnadenlos subjektiv ist hingegen Peter M. Gaschlers 46-seitige Rückschau auf die Phantastik-Serien des vergangenen Jahrzehnts, geschrieben in einem fannishen Jubel-Trubel-Ton, der wohl als mitreißend gedacht ist, aber auf Dauer ziemlich ermüdet. Und vermutlich will auch nicht jeder in die Schlafzimmer der HeldInnen von "Mutant X" springen.
Womit wir schon mitten im Schwerpunkt "Medien" wären, zu dem auch Rezensionen von Comics (80 Seiten), Hörspielen (50 Seiten) und Computerspielen (knapp 80 Seiten, ergänzt um zwei Hardware- bzw. Design-bezogene Beiträge) zählen. Und wer die "Mystery"-Rubrik der "Bild"-Zeitung nie gesehen hat, wird nach dem Lesen von Hartmut Kaspers Beitrag "Aliens, Nazis, Wunderwaffen und Kim Wilde" bedauern, dass er da echt was verpasst hat. - Seitenzahl-bezogener "Verlierer" der aktuellen Jahrbuch-Ausgabe ist die Wissenschaft, die dafür im Vorjahr dick vertreten war. Heuer gibt es unter anderem ein Interview mit dem Physiker, Philosophen und TV-Präsentator Harald Lesch. Interessant zu sehen, wo auch dem freundlichen Professor das G'impfte aufgeht - nämlich beim Wahnsinn der Finanzjongleure ("Es kann nicht sein, dass irgendjemand auf der Welt mit Gewinnerwartungen von 25 Prozent pro Jahr agiert. In der Medizin nennt man ein solches Wachstum Krebs ..."). Und Frank Schätzings doch-kein-zweiter-"Schwarm"-gewordene 1.300-Seiten-Monstrosität "Limit" fasst er in einer Kürze zusammen, dass man nur den Hut davor ziehen kann: "Nett ist die kleine Schwester von sch...".
Die Themenliste für die nächste Rundschau liest sich wie eine Sammlung klassischer B-Movies: Aufstand der Maschinen! Goldrausch im All! Angriff der Krakenmonster! Und - huch? - photosynthese-taugliches Kopfhaar. Wie ist das denn da reingerutscht? (Josefson)