
Steve Alten: "Das Ende"
Broschiert, 720 Seiten, € 10,30, Heyne 2012 (Original: "Grim Reaper: End of Days", 2010)
Meistens ist das erste Buch in der Rundschau ein Vorzeigestück, das man gerne auch mal gut sichtbar auf dem Kaffeetischchen herumliegen lässt. Aber wir schreiben 2012, und das Jahr kann man natürlich nur so beginnen, wie es nicht enden wird: mit einer Apokalypse. Und Bestseller-Autor Steve Alten ist der richtige Mann für den Job, um reißerische Themen war er schließlich nie verlegen. Seine Schriftsteller-Karriere hatte der Amerikaner in den 90ern mit der "MEG"-Reihe gestartet; als Hauptattraktion fungierte darin der Riesenhai Megalodon, der zum Schrecken der Wale der Welt aus dem Himmel der ausgestorbenen Tiere zurückkehrt. Mit haarsträubenden Begleiterscheinungen. Eher zum Schrecken der LeserInnen hat Alten aber mittlerweile die Spiritualität und insbesondere die Kabbala für sich entdeckt. Bedeutungsschwangere Zahlen spielen in "Das Ende" daher eine große Rolle, und mit 2012 allein ist es nicht getan. Alten hat überdies - und sogar beinahe richtig - zurückgerechnet, dass das ominöse Maya-Datum genau 666(!!!) Jahre nach der als "Schwarzer Tod" in die Geschichte eingegangenen Pestepidemie des Spätmittelalters liegt. Da ist ein Zusammenhang doch wohl offensichtlich.
So bricht die Pest erneut aus, und zwar in Manhattan, wo Weltuntergänge meistens starten. Allerdings handelt es sich um eine Scythe genannte biotechnisch aufgemotzte Variante des alten Pestbakteriums. Einem Klüngel von Verschwörern aus höchsten US-Kreisen erschien die Freisetzung des Erregers als gute Idee (Stichwort "Politik der Angst"). Allerdings laufen ihnen dann die Ereignisse davon, weil sich eine am Scythe-Programm beteiligte Biologin, Mary Louise Klipot, in religiösem Wahn den Erreger schnappt und ihn eigenhändig - und somit nicht ganz den Planungen entsprechend - unter die Leute bringt. Manhattan wird abgeriegelt, und inmitten der wie die Fliegen umfallenden Menschenmassen sind neben Mary Louise auch die übrigen ProtagonistInnen gefangen: Leigh Nelson, Ärztin in einem Krankenhaus für Kriegsveteranen, und Patrick Shepherd, einer von dessen Insassen und die eigentliche Hauptfigur des Romans. Er ist ein traumatisierter Soldat, der über die Jahre hinweg von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz transferiert wurde und zuletzt seine Hand verloren hat - der Grund, warum er zu diesem allesentscheidenden Zeitpunkt in Leighs Umfeld gelandet ist. Patrick ist übrigens die Reinkarnation von Jim Morrison. Das war zwar jetzt ein Spoiler, aber das sag ich hier deshalb, weil es sich beim Doors-Sänger eh nur um die unwichtigste von Patricks früheren Existenzen handelt, es überdies erklärt, warum Alten ständig Doors-Lyrics zitiert ... und vor allem, weil es schon im Kleinen ganz gut illustriert, in welche Untiefen Alten sich im Verlauf seines Romans begibt.
Bleibt als letzte Hauptfigur Bertrand DeBorn, langjähriger Sicherheitsberater der US-Regierung und gewissermaßen das personifizierte Böse. Wir erfahren, dass DeBorn - einmal fällt das Wort "Illuminati" - bei nahezu allen brisanten Ereignissen der vergangenen Jahrzehnte an den Strippen gezogen hat, vom Sturz des Schahs über den Georgien-Krieg von 2008 bis zum Ausbruch der Schweinegrippe in Mexiko. Einen Grundzug von Verschwörungstheorien bringt dies hervorragend auf den Punkt: Multikausale Ereignisfolgen werden auf eine einzige Ursache zurückgeführt, und schon ist die komplizierte Welt für jedermann verständlich geworden. Dabei sind die Übergänge in "Das Ende", das auf eine explizit politische Note setzt, fließend. Am einen Ende des Spektrums steht Altens Kritik an unleugbaren Missständen - zum Beispiel dem allgemeinen Desinteresse gegenüber den invaliden KriegsheimkehrerInnen. Das setzt sich fort in weder beweis- noch widerlegbaren Aussagen, etwa dass die zumindest gerne als "Nebenwirkung" in Kauf genommene Erdöl-Erschließung des Irak das eigentliche Kriegsziel gewesen sei. Und mündet schließlich in das volle 9/11-Verschwörungsprogramm. Europäische LeserInnen dürfte dies allerdings weniger polarisieren als die US-amerikanischen, unter denen Altens Buch einen Sturm ausgelöst hat.
Was setzt man nun einem verschwörerischen Geheimbund entgegen? Aufklärung etwa und umfassende Informierung der Öffentlichkeit? Nein, einen anderen Geheimbund natürlich - der aber ein guter ist. Was man unter anderem daran merkt, dass er übernatürlichen Segen erhalten hat. Im konkreten Fall handelt es sich um eine Neunzahl weiser Männer, die seit Jahrhunderten über die Menschheit wacht und der Alten einige positiv besetzte Figuren der Historie angehören ließ. Unter anderem auch Aristoteles, der zwar ein Jahrhundert vor der Zeit lebte, in der der Bund laut Roman gegründet wurde, aber wer wird das schon so genau nehmen. Immerhin lässt Alten auch sämtliche Iraker Farsi sprechen. Aber zurück zur Spiritualität: Sie bildet neben der Thriller-Handlung und der politischen Message das dritte der Elemente, die Alten in seinem Roman zusammenführt oder besser gesagt mit Ach und Krach ineinander verkeilt. Drei sind mindestens eines zuviel, und ich würde beim Streichen für den Mystizismus stimmen. Alleine schon deshalb, weil er die anfangs noch spannende Handlung zunehmend verschwurbelt und schließlich ganz aus dem Ruder laufen lässt.
Die Kabbala mag Alten fasziniert haben, aber mit welcher Für-gelangweilte-Westler-Modevariante hat er sich befasst? Selbst wenn man die spirituellen Elemente akzeptiert, stolpert man immer wieder darüber, dass sie in sich völlig unzusammenhängend sind. Beispiel aus dem Mund eines der Weisen: "Wenn eine kritische Masse erkennt, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, dann wird die Welt von Grund auf verändert werden, und wir werden Unsterblichkeit erlangen." Grade war noch vom Kampf zwischen "Gut" und "Böse" die Rede, wie kommt da plötzlich die Unsterblichkeit ins Spiel? Leider ist das nur willkürlich zusammengeklaubtes Gefasel aus dem esoterischen Supermarkt, bla bla Licht Gottes und Negativität bla. Und hinter dem Licht verbergen sich keineswegs so menschenfreundliche Urteile über andere: Wenn ein Haufen reicher BürgerInnen auf einem Floß aus Manhattan fliehen will und von einer Militärdrohne totgebombt wird, heißt es kühl: Die hatten ja auch ein negatives Leben geführt. Dass deren Kinder und Dienstboten ebenfalls an Bord waren, relativiert das Urteil nicht; offenbar gibt es so etwas wie spirituelle Sippenhaftung. Und irgendwie symbolisch für die größenwahnsinnige Anmaßung, die aus dem Glauben, die Wahrheit gesehen zu haben, entspringen kann, schlüpft Patrick am Ende in eine gelinde gesagt PROMINENTE neue Rolle. Das zu verraten wäre jetzt allerdings ein unzulässiger Spoiler.
Meistens ist es keine gute Idee, einen großen Roman schreiben zu wollen. "Am Ende" enthält allerlei Halbgares, das die Kernhandlung - immer noch der gelungenste Teil des Ganzen - wohl aufwerten sollte. Seien es Auszüge aus einer mittelalterlichen Chronik, Doors-Zitate oder extensive Verweise auf Dante Alighieris "Inferno". Da werden die Romankapitel gemäß den Höllenkreisen eingeteilt, und wo bei Dante Vergil durch die Unterwelt führte, da hat Patrick einen Virgil Shechinah als Begleiter. Alles ein bisschen dick aufgetragen. Im Vorwort des Romans schreibt Alten: Außerdem wurde mir klar, dass "Das Ende" weit mehr sein sollte als bloß ein Thriller. Und das ist es auch geworden, nämlich ein zu langer und mit viel zu viel unnötigem Ballast vollgestopfter Thriller. Das ultimative Urteil über das Buch hat aber Altens Ko-Autor Nick Nunziata im Nachwort gesprochen und rundet damit den Themenkreis Anmaßung aufs Schönste ab: Dantes "Hölle" aus der "Göttlichen Komödie" ist bereits für sich genommen ein tiefes und dunkles und zeitloses Werk, doch seine Kombination mit realen Gefahren spezifisch moderner Ausprägung verleihen ihm noch eine weitaus tiefere Bedeutung. Mit anderen Worten: Steve Alten hat Dante besser gemacht. Endlich.
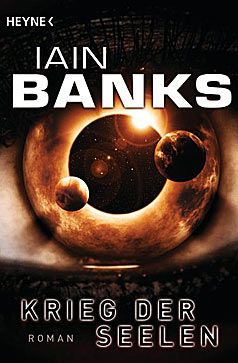
Iain Banks: "Krieg der Seelen"
Broschiert, 799 Seiten, € 16,50, Heyne 2012 (Original: "Surface Detail", 2010)
And now for something completely better. Endlich wieder ein waschechter Kultur-Roman von Iain Banks! In "Krieg der Seelen" lernen wir wieder neue Facetten dieser galaktischen Meta-Zivilisation aus Menschen, Menschenähnlichen und Künstlichen Intelligenzen kennen. So hören wir darin auch zum ersten Mal von einem ideologischen Konflikt, der zwischen den Nachbarzivilisationen der Kultur tobt und sich um das Konzept der virtuellen Höllen dreht.
Virtuelle Paradiese, in die man nach dem Tod eine digitale Bewusstseinskopie uploadet, hat ja jeder (Autor). Banks mit seinem Sinn für schwarzen Humor - "Dies bereitet mir weitaus mehr Freude als Ihnen Schmerz ..." - liefert nun auch das Gegenstück dazu: Einige Spezies waren eben der Meinung, dass sie ihre BürgerInnen leichter zu moralischem Verhalten animieren können, wenn sie ihnen für Ungehorsam eine virtuelle Weiterexistenz nach dem Tod in endloser Qual androhen (und das dann auch beinhart realisieren). Andere Spezies finden dies abscheulich, und um einen milchstraßenumspannenden Krieg zwischen Höllenbefürwortern und -gegnern zu verhindern, trägt man den Konflikt auf eine streng regulierte Weise in eigens dafür eingerichteten virtuellen Kosmen aus. Soweit das Grundszenario, garniert wird es mit fantastischen Details wie einem orbitalen Ring, der mal eben eine Viertelmilliarde Kriegsschiffe ausspuckt, oder einem Meeting auf einem Boot aus komprimiertem Papier, das über einen Quecksilbersee dümpelt. Mit anderen Worten: "Krieg der Seelen" ist große Oper.
Passend dazu beginnt der Roman mit einem Mord auf der Opernbühne; irgendwo auf einem - vorerst - eher unwichtigen Planeten außerhalb der Kultur. Lededje Y'Breq, die dem skrupellosen Unternehmer Joiler Veppers als Mischung aus Statussymbol und Sexsklavin diente, ist ihrem Herrn davongelaufen, wird nun aber gestellt und getötet (immerhin erst, nachdem sie Veppers die Nase abgebissen hat, ein Auftakt nach Maß). Groß ist Lededjes Überraschung, als sie nach ihrem Tod wieder erwacht - zunächst als digitale Bewusstseinskopie im Speicher eines Kulturschiffs, schon bald stellt man ihr aber auch einen neuen Körper zur Verfügung. Für BürgerInnen der Kultur wäre das nichts Besonderes, im Fall Lededjes rätseln aber zunächst alle, wie auch sie als Außenstehende in den Genuss dieses Service kommen konnte. Die Besonderen Umstände, den Quasi-Geheimdienst der Kultur, kennen wir ja bereits. Nun aber tritt eine bislang nicht vorgekommene Schwester-Organisation namens Quietus, die auf den Themenkomplex "virtuelles Nachleben" spezialisiert ist, in Aktion und setzt die Agentin Yime Nsokyi auf Lededje an. Der Auftrag erhält besondere Brisanz, als Lededje beschließt, zu ihrem Peiniger zurückzukehren, um sich zu rächen. Bedauerlicherweise spielt der aber eine wichtige Rolle im Höllenkrieg, und die Kultur - die daran offiziell nicht teilnimmt, aber sehr eindeutig auf Seiten der Höllengegner steht - gerät wieder einmal in einen moralischen Zwiespalt: Ihre Sympathie gilt Lededje, doch Joiler Veppers wird noch für die größere Sache gebraucht.
Einmal mehr greift Banks also das Motiv vom Kampf der Ideologien auf, und einmal mehr - nach den sadistischen Azadianern in "Das Spiel Azad" oder den brutalen idiranischen Eroberern in "Bedenke Phlebas" - steht das Gegenstück der Kultur für eine Weltanschauung, die Gewalt gutheißt; gerne religiös verbrämt. Für die Kultur hingegen gilt Schmerz per se als amoralisch, sie zeigt sich wie gehabt hedonistisch, säkular, antihierarchisch und dezentral organisiert, trotz einiger dunkler Flecken in der Vergangenheit (aus denen man immerhin gelernt hat) unbeschwert und in Bezug auf Geheimnisse aller Art diskret wie ein Kreuzfahrtschiff voller besoffener Dänen. Es war ihr ihrem Wesen nach unmöglich, sich von Gesetzen einkerkern, von Geld arm machen oder von Führern in die Irre leiten zu lassen, heißt es in "Bedenke Phlebas", dem Roman, mit dem Banks 1987 seinen Zyklus begann, über die Kultur. Und es ist die vielleicht größte Leistung des Autors, dass er eine Gesellschaft schildert, die sich ganz dem Vergnügen und der Selbstverwirklichung hingibt und deswegen eben nicht - wie dies bei anderen AutorInnen praktisch die Regel wäre - in Dekadenz versinkt. Ganz im Gegenteil: Die BürgerInnen der Kultur erweisen sich gerade wegen ihrer uneingeschränkten Freiheit als hochintelligent und lebensfähig. Das darf man durchaus als politisches Statement werten.
Die Sprache, in der Banks seine Romane erzählt, ist der Weltanschauung der Kultur angemessen: Stets schwingt eine humorvolle Note mit, nichts wird allzu ernst genommen, auf Formalitäten wird gepfiffen. Vergnügt liest man, wie der statusbewusste Joiler Veppers von der Botschafterin der Kultur in ihrem Büro empfangen wird ... in der Aufmachung einer barfüßigen Putzfrau, und mit ihrem Kind an der Hand obendrein, wie unsagbar würdelos! Und die KIs, aufgrund ihrer überragenden Intelligenz de facto die wichtigsten BürgerInnen der Kultur, pflegen ohnehin eine ganz eigene Art von Humor - wie unter anderem das Raumschiff Aus dem Rahmen normaler moralischer Restriktionen fallend demonstriert, das Lededje auf ihrer Mission unterstützt. Die exzentrischen und sich manchmal durchaus unfreundlich verhaltenden KIs geben mitunter Rätsel auf. Ganz anders als bei Neal Asher, der in seinen Romanen eine im Prinzip sehr ähnlich organisierte Zivilisation entwirft, muss man ihnen jedoch nicht misstrauen, sondern kann sich darauf verlassen, dass sie die Grundgedanken der Kultur in bedingungsloser Loyalität ausleben.
Ein paar Nebenfiguren gibt es in "Krieg der Seelen" auch noch. Prin und Chay sind zwei Angehörige einer Zivilisation, die sich eine Hölle gebastelt hat - und was sie in dieser erleiden müssen, schildert Banks detailreich bis zum Würgereiz. Alles für die gute Sache natürlich. Zu guter Letzt wäre da dann noch der Krieger Vatueil, den wir bei der Belagerung einer Burg kennenlernen, um ihn dann auf vielen weiteren Kampfschauplätzen wiederzutreffen. Das sind die am wenigsten aufregenden Kapitel, und fast scheint es, als wäre Banks derselben Meinung gewesen, ätzt er doch einmal: Gegen langwierige Multiplayer-Kriegsspiele gab es seiner Ansicht nach nichts einzuwenden (...), aber er war der Ansicht, dass das, was in einem solchen Spiel geschah, kaum eine Rolle für die Realität spielte. Und genau wie ein solches MMORPG lesen sich die repetitiven Passagen um Vatueil auch, scheinbar losgelöst vom Rest des Buchs. Letztlich fügen sie sich natürlich trotzdem in den Rahmen ein, und mit der wahren Identität Vatueils serviert Banks treuen Altfans noch ein Zuckerl - und zwar mit dem LETZTEN WORT des Romans, also nicht versehentlich ans Ende blättern! Für alle anderen LeserInnen spielt dies übrigens keine Rolle.
Das Gesamturteil fällt einfach aus, mag es "Kultur"-LiebhaberInnen auch wie ein Sakrileg vorkommen: Ich habe "Krieg der Seelen" gemeinsam mit dem Klassiker "Bedenke Phlebas" gelesen. Das hier hat mir besser gefallen.
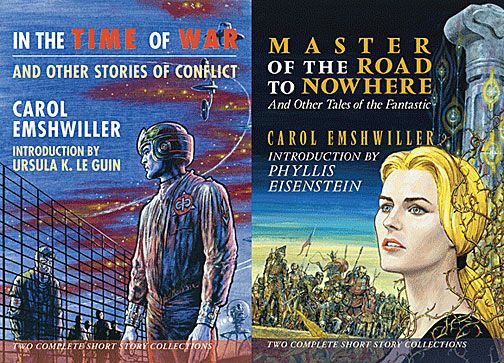
Carol Emshwiller: "In the Time of War" & "Master of the Road to Nowhere"
Gebundene Ausgabe, 294 Seiten, PS Publishing 2011
Das hier sind nicht etwa zwei Bücher, sondern Vorder- und Rückseite desselben. Soll heißen: Hat man sich bis zur Mitte durchgelesen, stößt man nach ein paar leeren Seiten plötzlich auf Schrift, die auf dem Kopf steht - also umdrehen und zurück zum "anderen Anfang" bitte. Das trennt nicht nur die beiden hier enthaltenen Storysammlungen, von denen eine in Zeiten des Krieges und die andere in denen "relativen Friedens" angesiedelt ist. Es handelt sich bei diesem "Doubleheader", wie der Verlag PS Publishing es nennt, auch um ein einst beliebtes und mittlerweile lange vergessenes Format: Eine nette Hommage an eine Veteranin des Genres, die seit mittlerweile über einem halben Jahrhundert aktiv ist.
Und doch ist die US-Amerikanerin Carol Emshwiller nie so ganz in die Liga der Berühmtheiten aufgestiegen (außerhalb des Phantastik-Geschäfts zumindest, innerhalb stellt sie eine wichtige Referenzgröße dar). Auf Deutsch ist meines Wissens außer der einen oder anderen Kurzgeschichte nie etwas von ihr erschienen, und selbst die sonst so zuverlässige Wikipedia lässt ihre Bibliografie erst in den 70ern einsetzen, obwohl Emshwiller die ersten Kurzgeschichten bereits in den 50ern veröffentlichte. Im Vorwort zur "kriegerischen" Buchhälfte "In the Time of War and Other Stories of Conflict" bringt niemand Geringeres als Ursula K. Le Guin die Hoffnung zum Ausdruck, dass Emshwiller dieselbe Ehre zuteil werden möge wie einst Philip K. Dick. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass auch der einmal beinahe in Vergessenheit geraten wäre. Spät käme der Erfolg für die 90-Jährige in jedem Fall, aber verdient hätte sie ihn ohne Frage.
Emshwiller stammt aus derselben Generation wie die 1987 verstorbene und ungleich berühmtere Alice Bradley Sheldon alias "James Tiptree Jr.". Beide Autorinnen hegten eine Vorliebe für das kurze Format, beide setzten stark auf eine menschliche Note und beide waren bzw. sind auch Meisterinnen in der Darstellung des Fremden. "They're not our kind" ist ein Satz, der hier in dieser oder einer ähnlichen Form öfter fallen wird. In der großartigen Titelgeschichte "Master of the Road to Nowhere" sind es Nomaden, die am Rande der übrigen menschlichen Gesellschaft leben und eine Sozialstruktur ähnlich einer Herde oder einem Rudel haben. In ihrem matriarchalisch geführten Verband wird stets nur ein einziger erwachsener Mann zugelassen - der muss sich nicht nur gegenüber zuwandernden Herausforderern behaupten, sondern auch alle Frauen der Gruppe gleichermaßen befriedigen. Als sich Our Big Man Janeson verbotenerweise in eine der Frauen "exklusiv" verliebt, müssen die beiden fliehen. Und auch wenn hier keine Aliens oder sonstwie anderen Spezies vorkommen, gelingt Emshwiller die Darstellung von fremdartigem Denken in beeindruckender Weise - die Geschichte gehört zum Besten, was ich in letzter Zeit gelesen habe.
"Master of the Road to Nowhere" wird aus zwei Blickwinkeln erzählt: Aus der Ich- und der Wir-Perspektive, letzteres ein auffallend oft verwendetes Element. Die ProtagonistInnen der einzelnen Geschichten sehen sich nicht nur als Individuen, sondern auch als VertreterInnen ihrer Art. Das können eher komische Alien-Invasoren sein ("The Perfect Infestation") oder Kinder, die sich in den Bergen verstecken, weil sie nicht ganz menschlich sind ("Quill"). Oder auch - in der melancholischen Parabel "All of us can almost ..." - riesenhafte Raubvögel, die noch von ihrem alten Ruf zehren, in Wahrheit aber längst zu plump zum Fliegen geworden sind. Das Wir kann aber auch in Konflikt mit dem Ich treten: Eben in der Titelgeschichte oder in "The New and Perfect Man". Hier haben Eltern Umgebung und Erziehungsplan ihres Babys derart "optimiert", dass dessen Heranwachsen einem Labor-Experiment ähnelt ... und das Ergebnis zwangsläufig ein geistiges Alien ist. Formal auf die Spitze getrieben wird der verinnerlichte Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv in "Repository", wo es an einer Stelle heißt: We will try to stop me.
Elf "Tales of the Fantastic" stehen neun "Stories of Conflict" gegenüber (alle hier versammelten Geschichten stammen übrigens aus den Nullerjahren) - und ich würde empfehlen, letztere verteilt zwischen den anderen zu lesen, denn in aller Regel münden sie nicht in ein Happy End. Eher schon in einen echten Magenschwinger. Wie "Killers", in dem ein Kriegsgefangener Zwangsarbeit in einem Dorf verrichten muss, das nur noch von Frauen und Kindern bewohnt wird. Das Grundmuster wiederholt sich in fast allen Geschichten: Jemand von der einen Seite der Front gelangt - durch welche Umstände auch immer - zu Menschen auf der anderen Seite, erlebt eine kurze Zeit des Friedens und wird letztlich doch vom Krieg eingeholt. Das kann ein harmloser Stotterer sein ("The Bird Painter in Time of War"), ein indoktrinierter Lehrer, der seine Schüler beim Front-Schauen verliert ("Logicist"), oder ein Psychiatrie-Patient, der von den Eroberern seiner Heimat aus einem letzten Widerstandsnest geholt wurde ("The Assassin, or Being the Loved One"). In "The General" ist es ein flüchtiger Offizier, und wenn sich seine Häscher über seine "Undankbarkeit" ereifern, dann kommt darin dasselbe Unverständnis des Wir für das Ich zum Ausdruck, wie es bei den fehlgeleiteten Eltern in "The New and Perfect Man" der Fall war.
"Who is the enemy? And more importantly, who are we?" Es ist ein anonymer Krieg, vor dem sich diese Episoden ereignen. Er ist kein Ereignis mehr, sondern ein Zustand; aus ihm zu flüchten gelingt (bis auf zwei Ausnahmen) nur kurzfristig, und zaghafte Versuche, ihn zu beenden, scheitern. Ausgetragen wird dieser ewige Krieg mit Cyborg-Implantaten ebenso wie mit Gewehren oder Schwert und Schild. Emshwiller interessiert sich nicht für fiktive Historien, Herrscher- oder Ländernamen, sondern nur dafür, ob der Krieg den ProtagonistInnen Raum für ihre Sehnsucht nach Glück, Liebe und Freiheit lässt. Meistens ist die Antwort in dieser wirklich beeindruckenden Storysammlung ein Nein.
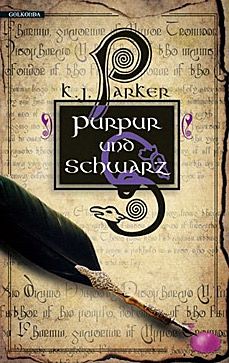
K. J. Parker: "Purpur und Schwarz"
Broschiert, 126 Seiten, € 15,40, Golkonda 2012 (Original: "Purple and Black", 2009)
Trotz des neuen Romans von Iain Banks waren es in dieser Rundschau die Werke zweier(?) Frauen, die den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen haben: Zum einen die Story-Sammlung von Carol Emshwiller, zum anderen dies hier. Nachdem mir aus gewöhnlich zuverlässiger Quelle bestätigt wurde, dass es sich tatsächlich um eine Autorin handelt, nehme ich diese Information mal grummelnd als Arbeitshypothese hin. Aber irgendwie nervig ist die Geheimniskrämerei um "K. J. Parker" schon. Vollstes Verständnis dafür, wenn jemand in der Öffentlichkeit nicht mit dem Namen aufscheinen will, der daheim am Türschild oder beim Brotjob in der Firmenbuchhaltung aufscheint. Aber wenn die Fama stimmt, dass es sich um eine Autorin handelt, die sonst unter anderem Namen schreibt und die betreffenden Werke nicht mit den als K. J. Parker veröffentlichten in Zusammenhang bringen will, weil sie so "anders" seien, dann geht es nicht mehr um Schutz der Privatsphäre, sondern nur noch um ein Marketingkalkül. Ob das ein ähnlich schützenswertes Gut ist, sei mal dahingestellt.
Aber gut, genug gegrantelt. Und das ist auch schon das einzig Negative, das mir hierzu einfällt. Ist ja kein Zufall, dass Parker trotz sinkender Fantasy-Quote in der Rundschau nun schon zum dritten Mal aufscheint; nach "The Company" und "Blue and Gold" erstmals mit einer Veröffentlichung auf Deutsch. Parker schreibt einfach die perfekte Fantasy für Science-Fiction-LeserInnen, nicht nur wegen des Fehlens von Magie und "Völkern", sondern vor allem wegen des Fehlens von schablonisierten Handlungsabläufen und Figuren, die sich in eine Archetypen- (oder Stereotypen-)Schublade stecken ließen. Kurz: Hier lässt sich nicht schon am Anfang absehen, was am Ende rauskommen wird, und das ist ausgesprochen befreiend.
Mit einigen Verweisen auf frühere Romane führt uns Parker wieder in jene präindustrielle Welt, die die einen als "antik" beschreiben (wofür einiges spricht, auch wenn die griechisch-römischen Namen da vielleicht einiges überdecken, das einer solchen Zuordnung widerspricht), andere als "mittelalterlich" (wozu wiederum andere Indizien passen), die dritten als "renaissancezeitlich". Machen wir's kurz: Es gibt hier börsennotierte Unternehmen, die Sklaven halten - jeder bestimme selbst, welches historische Etikett er der fiktiven Welt Parkers aufkleben will. Ökonomie und Politik sind jedenfalls die bestimmenden Kräfte, und im Vesani-Kaiserreich, das an früherer Stelle schon mal als Vesani-Republik beschrieben worden war, ist mit Nicephorus V. ein neuer Herrscher an die Macht gekommen. Eher unfreiwillig; nachdem sich der Rest seiner erlauchten Familie in Bürgerkriegen wechselseitig ausgelöscht hat, ist einfach niemand anderer mehr da. Nicephorus versucht das Beste aus der Situation zu machen und seinem Reich einen Modernisierungsschub zu verpassen - gleichzeitig gilt es seine brüchige Machtposition zu festigen, und dafür besetzt er wichtige Posten mit Freunden aus Studententagen. Einer davon ist Phormio, und der wird als Statthalter in eine von Aufständen bzw. Überfällen heimgesuchte Grenzprovinz geschickt. Wiederum höchst unfreiwillig.
Desillusionierung, eines der zentralen Elemente in Parkers Romanen, kann auch komisch sein. Etwa wenn sich Jungakademiker Phormio in seinem ersten Brief an Nicephorus über die mühsame Reise in "seine" neue Provinz beschwert und nebenbei die Frage "Du hast nicht zufällig ein Buch über's Regieren?" einbaut. Da werden Gefangene ins Innere einer Mühle und eines Uhrwerks geführt, um ihnen nichtvorhandene Folterinstrumente vorzugaukeln, da engagiert der Kaiser einen Fälscher, der ihn mit ausreichend offizieller Purpurtinte versieht, wenn ihm die hofeigene Bürokratie den Hahn abdreht, um ihn am Regieren zu hindern. Der Ton der Erzählung liegt also näher an dem von "Blue and Gold" als am kalten Zynismus von "The Company" ... andererseits hatte ja sogar der seine Pointen, und die Leichtigkeit von "Blue and Gold" sollte sich ihrerseits als trügerisch erweisen. Tatsächlich liegt bei Parker hinter so gut wie jeder Ecke eine Leiche (meistens hat sich der Mord dann ereignet, wenn man grade nicht hingeschaut hat), und auch in "Purpur und Schwarz" kommt es zu jeder Menge beiläufig erwähnter Gewalt. Persilweiße Fantasy-Helden sucht man bei Parker vergeblich - wie heißt es doch so schön: Mit dem Idealismus ist es wie mit den Pickeln und dem Wichsen: Das ist so eine Phase, die man durchmacht, und irgendwann wächst man da raus.
Mit der Form unterstreicht K. J. Parker ihre/seine erbarmungslos nüchterne Sicht der Dinge. "Purpur und Schwarz" ist als Briefroman geschrieben; eingeleitet wird die Korrespondenz zwischen Phormio und Nicephorus stets, wie es die Etikette gebietet ... worauf dann der eigentliche Inhalt im zwanglosen Umgangston zweier ehemaliger Kommilitonen folgt: "Phormio, Statthalter von Obertremissis, entbietet Seiner Heiligen Majestät Nicephorus V., dem Bruder der Unbezwingbaren Sonne, Vater seines Volkes, Verteidiger des Glaubens, Kaiser der Vesani, seine Grüße. (...) Gar keine Frage, Du bist ein Mistkerl durch und durch." Klar, dass das für Komik sorgt, doch Parker-Fans werden sich rasch fragen, ob diese eher oberflächliche Diskrepanz nicht auch eine tiefergehende vorbereitet. Immerhin ist die Autorin eine Meisterin darin, einem ProtagonistInnen vorzusetzen, denen man besser keinen Millimeter über den Weg trauen sollte. Wie sich dies in "Purpur und Schwarz" auswirken wird ... selber lesen. Es lohnt sich!

E. C. Tubb: "Die Sterngeborenen"
Broschiert, 144 Seiten, € 10,30, Atlantis 2011 (Original: "The Starborn", 1956)
Science Fiction, möchte man meinen, müsste besonders anfällig dafür sein, von der Gegenwart eingeholt zu werden und veraltet zu wirken. Das stimmt aber nur bedingt; bei Klassikern kann es oft schon reichen, über weniger wichtige Details hinwegzusehen. Zum Beispiel das Wording: Ich erinnere mich daran, einst mit der vollen Toleranz eines 9-Jährigen einen Roman von Hans Dominik weggeschmissen zu haben, weil darin von "Kraftwagen" die Rede war ("So ein Blödsinn, das heißt heute Autos, das weiß doch jeder."); da wäre ich heute wohl etwas bedächtiger mit meinem Urteil. "The Purple Cloud" von M. P. Shiel zum Beispiel hat mich als einer der besten Letzter-Mensch-auf-Erden-Romane beeindruckt, obwohl er über 110 Jahre alt ist und ich davor schon massenhaft modernere Bücher zum Thema gelesen hatte.
Auch "Die Sterngeborenen", 1956 veröffentlicht und nun in Neuübersetzung noch einmal auf Deutsch erschienen, schneidet überraschend gut ab. In seinem vielleicht bekanntesten Einzelroman schildert der 2010 verstorbene britische Autor Edwin Charles Tubb das Ende der 300-jährigen Reise eines Generationenschiffs - und erfüllt alle Richtlinien, die die aktuelle Bewegung der Mundane SF an eine Space Opera stellt: Es dürfen keine Technologien vorkommen, die nicht zumindest schon theoretisch ausgearbeitet sind (dementsprechend fliegt man mit Unterlichtgeschwindigkeit und simuliert Schwerkraft durch Rotation, was zu unterschiedlichen "Gravitationsstärken" in den verschiedenen Schiffssektoren führt). Und auch Aliens sucht man hier vergeblich. Tubb konzentriert sich ganz auf die Gesellschaft, die sich - seiner Ansicht nach zumindest - im Inneren eines hermetisch abgeschlossenen Mikrokosmos entwickeln muss: Als Erstes war der Name des Schiffes in Vergessenheit geraten, und es wurde nur noch "das Schiff" genannt. Das Gefühl für die Bewegung war verloren gegangen, und für die Besatzung waren die Metallwaben das gesamte Universum geworden, statisch, unverändert und unveränderlich. Sie lebten und starben in den Begrenzungen ihres metallenen Gefängnisses, und je mehr Zeit verging, desto irrealer und vager wurden Ziel und Zweck ihrer Reise.
Dass die Bord-Gesellschaft ihre dystopischen Aspekte hat, zeigt sich schon auf den ersten Seiten. Erst endet ein öffentlicher Prozess damit, dass nicht nur der verleumderische Ankläger, sondern auch sein zu Unrecht beschuldigtes Opfer hingerichtet wird. Dann holt sich ein anderes Crew-Mitglied seine Dosis Kafka ab, als es auf einen Mord hinweist und dafür verhaftet wird - noch dazu vom Helden des Romans. Jay West gehört der Psycho-Polizei an ("Psycho" ist der Name des Bordcomputers) und ist mehr als eine bloße Ordnungskraft. Im Geheimen geht er seinem eigentlichen Auftrag nach: Auf unverdächtige Weise alle diejenigen zu eliminieren, die Psycho für nicht mehr brauchbar befunden hat - darunter auch alle, die die 40 überschritten haben.
Dahinter steckt das erbarmungslose genetische Zuchtprogramm derer, die die Mission geplant haben. Es gibt strenge Regeln dafür, wann man zu heiraten und Nachwuchs zu zeugen hat und in welchem Sektor man sich aufhalten darf. Und eben auch dafür, wann man seine Schuldigkeit getan hat und die Bühne verlassen muss - auch wenn letzteres nicht offen ausgesprochen wird, sondern in der Praxis durch arrangierte Unfälle und ein ausgeklügeltes System von Schau-Zweikämpfen erledigt wird. Interessanterweise stellt Tubb die "Notwendigkeit" eines solchen Systems an sich nicht in Frage und widmet sich stattdessen den Folgen, die der Missbrauch der Regeln mit sich bringt. Die Philosophie dahinter ist kühl - man könnte auch sagen zynisch. Immerhin fallen hier Sätze wie "Ein starkes Volk konnte kein unmoralisches Volk sein". Und auch der Zweck der Kolonisierungsmission wird mit das Pflanzen von Männern und Frauen, Samen gleich, um zu sehen, ob sie überleben konnten mit mehr als nur einem Hauch Unmenschlichkeit beschrieben.
"The Starborn" mag William F. Nolans 11 Jahre später erschienenen Roman "Logan's Run" beeinflusst haben, in dem Sandmänner alle diejenigen eliminieren, die sich nicht mit 21 (in der Verfilmung "Flucht ins 23. Jahrhundert" mit 30) freiwillig entleiben. Hier wie dort setzt sich die Handlung in Gang, als der jeweilige Systemvertreter in einen Konflikt zwischen seinem Auftrag und privaten Interessen gerät. Ausgelöst natürlich durch ein weibliches Love Interest - allerdings wirkt dies bei Tubb eher wie eine Formalität: Es gibt den Anstoß zu den weiteren Geschehnissen, ist dem Autor aber nicht wichtig genug, um es in den Vordergrund der Handlung zu rücken. Die ist dafür in sich absolut stimmig: Die Enge des Schiffsinneren spiegelt das rigide Gesellschaftssystem wider, und dieses schränkt den individuellen Handlungsspielraum Jays entsprechend ein. Kein Akt des Widerstands bleibt ohne Konsequenzen - auf den Punkt gebracht in einer Passage, in der Jay, was er auch tut, einfach immer eine Leiche zu wenig zur Verfügung hat, um Psycho von seinen Schützlingen abzulenken.
E. C. Tubb hat in seiner ein halbes Jahrhundert umspannenden Schriftstellerkarriere jede Menge Romane veröffentlicht, von der Science Fiction bis zum Western. Nicht alle davon hatten die Qualität von "The Starborn"; eine gute Entscheidung des Atlantis-Verlags, seine Wiederveröffentlichungsserie mit diesem Werk zu starten. Und weitere Gustostückerln gibt es: Im Frühling folgt mit "Die Stadt ohne Wiederkehr" ("City of No Return") der nächste Band.
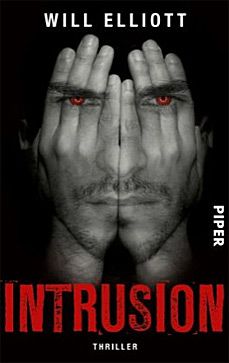
Will Elliott: "Intrusion"
Kartoniert, 296 Seiten, € 13,40, Piper 2012 (Original: "Nightfall", noch nicht veröffentlicht)
Gut fünf Jahre ist es her, dass der Australier Will Elliott beherzt seinen ersten Roman - einen aus dem Horror-Genre noch dazu - bei einem Literaturwettbewerb einreichte und überraschenderweise gewann. "Hölle" ("The Pilo Family Circus", hier die Nachlese) drehte sich um einen jungen Mann, der einen metaphysischen Zirkus und in diesem die dunkle Seite seines Ichs entdeckt; ein Preisregen folgte. In der Zwischenzeit ist Elliott nicht auf der faulen Haut gelegen. Unter anderem hat er ein Sachbuch über seine Schizophrenie-Erkrankung und den Beginn einer Fantasy-Trilogie geschrieben. Plus Texte, die im Original noch gar nicht veröffentlicht wurden. Wie diesen hier, von dem Elliotts heimatlicher Verlag meinte, dass er erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen sollte, weil er sich zu sehr von "Hölle" unterscheidet und die Fangemeinde vergrätzen könnte.
Dabei scheint "Intrusion" anfangs noch eine durchaus ähnliche Richtung einzuschlagen, denn wieder landet ein junger Mann in einer bedrohlich-surrealen - und etwas versifften - Parallelwelt. Aden Keenan wacht unversehens in der Badewanne eines fremden Hauses auf. Abgesehen von ein paar Erinnerungssplittern, die sich merkwürdigerweise alle um seinen Großvater drehen, weiß er nur noch, dass er Selbstmord begangen hat und eigentlich tot sein müsste. Stattdessen findet er sich in der abgefuckten Bude einer primitiv wirkenden Familie wieder, die sich schamlos dem Fressen und Vögeln hingibt; möglicherweise sind es Kannibalen. Würden sie es nicht mit der Angst zu tun bekommen, als sie Aden bemerken, könnte man glatt glauben, in einem typischen Torture Porn gelandet zu sein. Aber das ist nur der Anfang, und mit dem vermeintlichen Slasher-Szenario greift Elliott lediglich einen Fantasy-Topos der jüngeren Vergangenheit auf. Viele weitere - meistens altehrwürdigere - werden folgen.
Da hätten wir zum Beispiel eine "Muse", die Bilder malt, um sie anschließend zum Leben zu erwecken. Jemanden, der die Zeit anhalten kann. Einen soziopathischen Herzog (dessen selbstbeweihräuchernde Reden fast noch unerträglicher zu lesen sind als die Morde, die er im Blutrausch begeht). Einen herzöglichen Ratgeber mit sprechendem Schlangenstab, den vielschichtigen Meuchelmörder Slythe und sogar waschechte Drachen (wenn auch nur in ganz kleinen Nebenrollen). Und immer wieder manifest werdende Träume, das wichtigste Motiv des Romans. Dessen "deutschen" Titel würde man übrigens vermutlich gar nicht zur Kenntnis nehmen, ist man's doch gewohnt, dass Bücher oft genug auf irgendwas ohne größere Bedeutung umbenannt werden; Hauptsache, es klingt gut. Hinter "Intrusion" steckt aber offenbar Absicht, denn im Klappentext heißt es: "Für alle 'Inception'-Fans ist dieser Roman das perfekte Kinoerlebnis im Kopf". Je nun. Außer dass Träume darin vorkommen, haben die beiden Werke absolut gar nichts gemeinsam; und einen Traum hatte Martin Luther King auch. Die vermeintliche Connection zu Christopher Nolans SF-Wirtschaftskrimi sollte man vor dem Lesen also ganz schnell wieder ausblenden.
"Intrusion" ist eine surreale Dark Fantasy, und sie hat ihre Vorbilder. Mervyn Peake, Autor der "Gormenghast"-Romane, ist Elliotts erklärtes Idol. In manchen Passagen wähnt man sich aber auch mit Alice bzw. Aden im Wunderland. Und zumindest deutschsprachige LeserInnen dürften sich sogar an Michael Ende erinnert fühlen - dann nämlich, wenn sich eine Wall oder auch Vergessen genannte Grenze über das Land Nightfall, in dem all die genannten Figuren leben, schiebt und es Stück für Stück auffrisst - ganz so wie Phantasien in der "Unendlichen Geschichte". Viele der in "Intrusion" vorkommenden Orte und Figuren wirken allegorisch und vor allem die StatistInnen werden als nicht wirklich real dargestellt. "Sie sind bewegliche Teile, Kulisse, surrende, klackende Getrieberädchen, die ineinandergreifen, jedes an seinem vorgesehenen Platz, jedes austauschbar", erklärt Slythe Aden. Und fügt den entscheidenden Satz hinzu: "Du dagegen unterscheidest dich von ihnen, bist vielleicht sogar einmalig, und sei es nur deiner Wahnvorstellungen wegen." Kein Wunder, dass Aden bei allen Nightfall-BewohnerInnen, die ein bisschen Durchblick haben, für erhebliche Unruhe sorgt.
Es lässt sich nachvollziehen, warum Elliotts Verlag den Roman erst nach einigen anderen Veröffentlichungen herausgeben wollte. Er ist anders als "Hölle", und er hat seine Schwächen. Ein wenig problematisch ist, dass die Handlung im Lauf der Zeit zu sehr von der zentralen Hauptfigur wegdriftet, und auch die Massierung verschiedenster Fantasy-Versatzstücke überzeugt nicht wirklich: Da fehlt (um einen für den Roman wichtigen Begriff zu verwenden) die ordnende Hand eines Weltenmachers, wie sie beispielsweise ein China Miéville immer erkennen lässt, egal wie tolldreist er Motive und Requisiten miteinander verquirlt. Der ... öhm ... mit Metaphern überreich gesegneten Bewertung eines Amazon-Kunden "Durch 'Hölle' erwartete ich erheblich mehr, sticht Elliott doch dadurch bereits als gänzlich neu gearteter Autor aus der Masse heraus - mit 'Intension' hat er leider sehr viel von diesem zarten Pflänzchen eines gelungenen Rufes wieder in die Weiten der Vergessenheit gelegt" werde ich mich zwar weder inhaltlich noch formal anschließen. Aber es stimmt, dass sich Will Elliott in "Intrusion" nach mitreißendem Beginn etwas verzettelt hat. Dafür zaubert er dann noch einen Schluss hin, bei dem man unweigerlich einen Kloß im Hals verspürt. Vielleicht hätte er aus dem Stoff besser eine Kurzgeschichte gemacht.
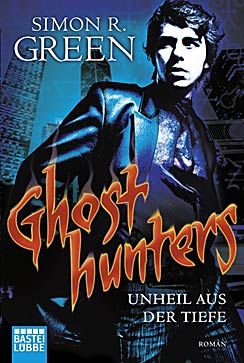
Simon R. Green: "Ghost Hunters: Unheil aus der Tiefe"
Broschiert, 286 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2011 (Original: "Ghost of a Chance", 2010)
"Wenn die Ghostbusters Kopfschmerzen haben, wenn die Scooby Gang in Panik ausbricht, wenn Mulder und Scully die Wahrheit draußen gar nicht erst nicht [sic] wissen wollen und die Psycho-Kommandos des SAS sich in der Ecke verkriechen und sich die Augen ausheulen. Wen holt man dann? Die speziell ausgebildeten Agenten des Carnacki-Instituts!" So legt Simon R. Green einem seiner Protagonisten den Masterplan für seine neue Romanserie "Ghostfinders" (auf Deutsch zu "Ghost Hunters" mutiert) in den Mund. Klingt nicht übermäßig neu, und generell neigt die Urban Fantasy ja mindestens so stark zur Wiederholung erfolgreicher Muster wie die High Fantasy. Da braucht's schon einen Zusatzanreiz, um sich einen Roman aus der Lawine an Veröffentlichungen herauszugreifen, und der Name Simon R. Green - Autor unter anderem der "Nightside"-, "Deathstalker-" und "Eddie Drood"-Serien - schien ein ausreichender Mehrwert zu sein. Leider belehrt uns Green mit "Unheil aus der Tiefe" eines Schlechteren. Und die Lektion fällt heftig aus.
Dass Green hier einige Motive aus seinen älteren Romanserien recycelt, zeigt sich spätestens, wenn die drei ProtagonistInnen - ein mittelmäßig beleumundetes Einsatzteam des Carnacki-Instituts - bei ihrer Vorgesetzten antanzen. Die residiert in einem versteckten Raum des Buckingham-Palasts, erinnert in ihrer Beschreibung ziemlich an Judi Dench und hält den dreien - ganz in "M"-Manier - Standpauken wegen ihrer jeweiligen privaten Marotten. James-Bond-Bezüge hatte Green ja eigentlich bereits in die "Drood"-Romane eingebaut, und in wesentlich witzigerer Ausführung obendrein ... scheint, als würden ihm langsam die Ideen ausgehen. Auch der Einsatz, auf den sich das Trio JC Chance, Melody Chambers und Happy Jack Palmer begeben muss, hätte genausogut Eddie Drood übertragen werden können (bzw. vielleicht sogar sollen): In der Londoner U-Bahnstation Oxford Circus hat sich apokalyptisches Grauen eingenistet, Massen von Passagieren sind entweder dem Wahnsinn verfallen oder wurden entführt und abgeschlachtet. JC & Co sollen nun herausfinden, welches hochrangige überirdische Wesen hinter der Attacke steckt; diverse Blutszenen folgen.
Der Subtext ist bei Werken der Phantastik immer besonders wichtig. Hier dreht er sich nicht um existenzielle Urängste, moralische Botschaften oder was nicht gar. Hier ist er an ITV oder die BBC gerichtet und lautet schlicht und ergreifend: Bitte mach aus mir eine Serie wie "Primeval" oder "Torchwood"!!! Was keine schlechte Idee wäre, weil spektakuläre Bilder vielleicht (aber auch nur vielleicht) von den platten Ideen, den platten Dialogen und den entsetzlich platten Charakteren ablenken könnten. JC der dandyhafte Draufgänger, Melody als Technikerin mit regem Sexualleben, Happy Jack der pillensüchtige Telepath mit Hang zur Paranoia: Alle drei werden zu Beginn samt ihrer Vita runterbeschrieben, und das war's dann auch mit der Plastizität. Es folgen abwechselnd Ortsbeschreibungen und Gespräche, das liest sich öfter als einmal wie ein hastig hingeklopftes Drehbuch.
"Wer seid ihr schwatzenden Kreaturen?", wird das überirdische Böse an einer Stelle fragen, und das richtet sich an unser Trio ebenso wie an zwei etwas später hinzukommende GegenspielerInnen von einer Konkurrenzorganisation. Es lohnt sich nicht einmal, deren Namen zu nennen; sie sind wohl als finstere Version des "guten" Teams gedacht, tatsächlich aber vollkommen austauschbare Kopien. Was insbesondere für die Gespräche aller Beteiligten gilt, die in ihrer Dauer-Frotzelei mit der Zeit ziemlich an den Nerven zerren. Es ist ja nichts Neues, dass Simon R. Green eine brutale Handlung gerne mit schwarzhumorigem Witz konterkariert, aber die Betonung liegt auf Witz, und der fehlt hier komplett. Während Green in früheren Werken doch immer wieder mit Esprit unterhielt, bewegt sich das Niveau des Schmähführens hier ausschließlich zwischen halblustig und vollblöd. Und die Übersetzung wertet den Roman auch nicht gerade auf. Ständig gibt es Doppelungen Marke "schockiert und bestürzt" oder "fest und solide", wie man sie sonst nur aus Interviews mit "kämpfenden und fightenden" Fußballern kennt. Zucker auch dieser Satz: Sie schritt durch die Welt, als beabsichtige sie bewusst, über jede Leiche zu gehen, die ihr nicht schnell genug aus dem Weg wich. Umpf.
Immerhin kann man der Übersetzerin eines zugute halten: Das weitaus Meiste, was an "Unheil aus der Tiefe" schlecht ist, hat der Autor selbst zu verantworten. Viel unterhaltsamer als der Roman selbst sind die Foren, in denen entsetzte Green-Fans spekulieren, was bei diesem Roman (und seiner den Reaktionen nach gleichermaßen missratenen Fortsetzung) schiefgegangen sein könnte. Die einen vermuten, dass er in Wahrheit gar nicht von Green geschrieben wurde, die anderen, dass der Text aus der Highschoolzeit des Autors übriggeblieben ist, die dritten, dass Green den Roman weniger geschrieben als per Telefon an den Verlag durchgegeben haben müsse. Allenthalben klingt bittere Enttäuschung durch, und das zu Recht. Nicht empfehlenswert.

John Love: "Faith"
Broschiert, 373 Seiten, Night Shade Books 2012
Frischer Wind fürs Genre Space Opera, und er bläst von außen: Der britische Autor John Love, der seinem Foto nach diesen Debüt-Roman in nicht mehr ganz so zartem Alter geschrieben hat, hält sich mit biografischen Angaben eher zurück, soll jedoch lange Zeit "im Musikgeschäft" gearbeitet haben; unter anderem gehörte er dem Leitungsteam des Londoner "Ocean"-Clubs an. Seinen Umgang mit der Wissenschaft bezeichnet Love selbst als "fuzzy", was sich an einigen Stellen bemerkbar macht. Dafür ist er originell. Was die beiden Raumschiffe, die sich hier auf über 300 Seiten ein Duell liefern, einander um die Ohren hauen, davon könnten sich selbst Neal Asher und Iain Banks noch Anregungen holen.
Gegen Mitte des 3. Jahrtausends hat sich von der Erde aus ein 29 Sternsysteme umfassender Commonwealth ausgebreitet. Dazu gehören auch die vier Systeme der Sakhrans, die einst ihr eigenes Imperium aufgebaut hatten, bis sie Ihr begegneten: Faith. It had come to them suddenly and without invitation; it would not be denied; and when it left them, which it did as suddenly as it came, they were ruined. They would never recover. On balance, Faith seemed a good name. Soweit die am Metaphysischen kratzende Erklärung für den Namen, den die Sakhrans dem Ding gegeben haben, das sich äußerlich als technisch überlegenes Raumschiff manifestierte. Als es damals schließlich gegenüber einem Philosophen sein wahres Wesen enthüllte, begann die sakhranische Gesellschaft zu zerfallen; die Sakhrans "wandten sich voneinander ab", wie es im Text heißt. Und nun, 300 Jahre später, kehrt Faith zurück. Wieder greift das anonym bleibende Raumschiff dieselben Planeten - mittlerweile hauptsächlich von Menschen besiedelt - an. Nun nennt man es nur noch Sie.
Allerdings haben sich die Menschen vorbereitet: Da gewöhnliche Raumschiffe im Kampf gegen Faith keine Chance haben, wurden sogenannte Outsiders gebaut. Die verfügen nicht nur über die Crème de la Crème der zeitgenössischen Waffentechnik, sondern auch über ganz spezielle Besatzungen: Hochbegabte Menschen und Außerirdische, die jedoch unter psychischen und/oder sozialen Störungen leiden (eine Idee, die bereits Peter Watts in "Blindflug" und seinen "Rifters"-Romanen zu Papier gebracht hatte). An Bord der "Charles Manson" hätten wir da den Kommandanten Foord, seine Waffenmeisterin Cyr und das Alien Smithson - alle drei sind begabt bis zur Genialität, und alle drei haben in ihrer Vergangenheit gemordet. Die ganz spezielle Chemie zwischen diesen labilen Persönlichkeiten prägt den Roman - da darf man sich nicht wundern, wenn beispielsweise ein Crew-Mitglied stundenlang in seinem Blut und ein anderes in seiner Scheiße auf der Brücke liegen bleibt, weil es den anderen nicht ins Konzept passt, sich darum zu kümmern. Das hier ist keine "Star Trek"- Crew, und die "Charles Manson" ist kein geselliges Schiff. Auf den ersten Blick scheint die Besatzung des Schiffs (von der wir nur die 6, später 5 Mitglieder der Brückencrew kennenlernen) den sich voneinander isolierenden Sakhrans zu ähneln. Doch während es von denen heißt, dass bei ihnen eine Gruppe stets weniger als die Summe ihrer Mitglieder sei, ergibt sich aus dem Zusammenspiel der PsychopathInnen etwas Einzigartiges. Und vielleicht sogar etwas, das Faith in ihre Schranken verweisen kann.
Es ist kein Zufall, wenn im Roman einmal der Name "Moby Dick" fällt. So wie sich bei Herman Melville der Weiße Wal aus dem Meer erhebt, so taucht Loves Faith am Horizont eines Planeten aus ihren Tarnfeldern auf. Sie und die "Charles Manson" bewegen sich im weiteren Verlauf des Romans in einem unaufhörlichen Tanz des einander Verfolgens und Belauerns, des Angreifens und Wiedervoneinanderablassens - bis zum Ende. Und mehr noch: Wie Kapitän Ahab gegenüber dem Wal fühlt auch Foord eine persönliche Beziehung, die ihn mit seiner Gegnerin verbindet; bei einem geglückten Angriffsmanöver hat er sogar eine Erektion. Und wie Moby Dick für alle (Romanfiguren, Autor, LeserInnen) mehr als nur ein Wal war - das heißt: für alle außer ihn selbst, wie das Duell wohl aus seiner Sicht ausgesehen haben mag? -, so dient auch das Mysterium Faith als die ultimative Projektionsfläche.
Faiths Geheimnis wird am Ende übrigens tatsächlich gelüftet werden. Ob das dann für jedeN als die ganz große Überraschung daherkommt, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall macht sich John Love ein Vergnügen daraus, Informationen zurückzuhalten. Bezeichnend dafür ist ein Kapitel zu Beginn, in dem immer wieder unverständliche Anspielungen auf üblen Geruch fallen, bis sich herausstellt, dass Faith eine für ihre Schönheit berühmte Stadt mit Tonnen von synthetischer Scheiße eingesprüht hat (übrigens ihre mit Abstand harmloseste Attacke). Foords Vornamen erfahren wir erst auf Seite 176, auch die optische Beschreibung der Sakhrans wird erst mit Verspätung nachgeliefert. Und bereits aus Kapitel 1 wissen wir, dass die Sakhrans das Geheimnis von Faith längst kennen - wir LeserInen werden allerdings bis zum Schluss hingehalten.
"Clever" ist das Wort, das Loves Stil vielleicht am besten beschreibt. Wenn jemand ein Buch mit den aufmerksamkeitsweckenden Worten His pregnancy convulsions dragged him out of unconsciousness beginnt, dann darf man diesem Jemand ruhig ein gewisses Maß an Berechnung unterstellen. Dass Ironie der hervorstechendste Zug der sakhranischen Kultur ist, kommt nicht von ungefähr, zudem spielt Love gerne mit Worten ("If it was a universe it was infinite; inside was neverending so outside, where they were, was neverbeginning."). Das ist oft geistreich, manchmal auch ein bisschen zuviel des Guten ... ergibt in Summe aber eine interessante neue Stimme in der Science Fiction. Halten wir den Mann mal unter Beobachtung.
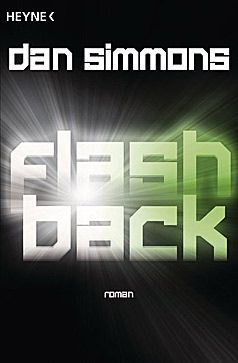
Dan Simmons: "Flashback"
Kartoniert, 637 Seiten, € 16,50, Heyne 2011 (Original: "Flashback", 2011)
In einer bestimmten Hinsicht ist dies die ungewöhnlichste Rundschau, die es bislang gab. Denn nach Steve Altens "Das Ende" und Simon R. Greens "Ghost Hunters" kommt hier die dritte Bombe, eine solche Horror-Quote gab's noch nie. Das war der Vorteil, als ich noch über CDs geschrieben habe, da konnte man eine unerwartet schlechte noch rasch durch eine andere ersetzen; Bücherlesen dauert halt leider deutlich länger, und so kam es zu dieser statistisch auffälligen Häufung. Das Erschrecken ist gleich, nur die Ursachen sind unterschiedlich: War es bei Green Lust- bzw. Ideenlosigkeit und bei Alten der Umstand, dass er sich in einem Konglomerat aus Eso-Geschwafel verstieg, so sind es bei Simmons - als Schöpfer von unter anderem "Hyperion" und "Ilium" mit Abstand der renommierteste Autor unter den dreien - die politischen Botschaften, die er einem in "Flashback" wieder und wieder und wieder aufs Auge drückt. Reads like a Fox News parody, schrieb ein Leser. Bedauerlicherweise ist es aber nicht als Parodie gemeint.
Bleiben wir zuerst bei der Thriller-Handlung, denn auf der Ebene funktioniert der Roman - anders als der von Alten - ohne Abstriche. Im Denver der 2030er Jahre wird Nick Bottom, Ex-Cop und nun glückloser Privatermittler, vom japanischen "Berater" Colorados engagiert, um den einige Jahre zurückliegenden Mord an dessen Sohn aufzuklären. Das hatte Nick schon zu seiner Zeit als Polizist vergeblich versucht, dennoch nimmt er den Auftrag an - vor allem weil er sich vom Honorar jede Menge Flashback kaufen kann. Die neue Droge, die es einem ermöglicht, Erinnerungen so zu erleben, als wären sie die reale Gegenwart, wird vom größten Teil der US-Bevölkerung konsumiert. Nick ist seit dem Tod seiner Frau schwer danach süchtig - so sehr, dass er sogar seinen Sohn abgegeben hat. Val, mittlerweile Mitglied einer Flashback-Gang, lebt bei seinem Großvater George Leonard Fox, einem Professor im Ruhestand, in Los Angeles. Als dort ein Bürgerkrieg ausbricht, versuchen sie nach Colorado zu gelangen, während Nick nach und nach den Zusammenhängen zwischen dem Mordfall, dem Tod seiner Frau und dem allgemeinen Niedergang der USA auf die Spur kommt.
Eines noch vorab, ehe die leidige Politik ins Spiel kommt: Simmons hat das Potenzial von Flashback der Droge nicht dafür genutzt, "Flashback" den Roman in eine Philip K. Dick-Richtung von unsicher werdenden Realitäten und Identitäten zu führen ... was ja auch denkbar gewesen wäre. Die Handlung der Romangegenwart und wiedererlebte Erinnerungen bleiben stets fein säuberlich voneinander getrennt. Bis auf den - in seiner Zweideutigkeit übrigens ausgesprochen gelungenen - Schluss müssen wir uns nie Sorgen um unsere Orientierung machen.
... und um die politische Orientierung ohnehin nicht, die bekommen wir vom Autor eingepaukt. Ich kann mich an das - inoffiziell geäußerte - Szenario eines mittlerweile pensionierten Bundesheer-Unteroffiziers erinnern, das in etwa so aussah: In Österreich leben soundsoviele AusländerInnen. Was wäre, wenn die sich alle verbünden und es zu einem Aufstand kommt? Kurz entstand damals vor meinem geistigen Auge eine Vision, wie sich slowakische Altenpflegerinnen, türkische Bäcker und Aushilfspfarrer aus Nigeria zu Brigaden zusammenfinden und die ganze eng miteinander verwobene Mischpoke die Macht im Land an sich reißt. So absurd das auch klingt - genau das serviert einem Dan Simmons in seinem Roman. Die Russenmafia und ultrareiche japanische Familienclans nagen ebenso am Leichnam der hilflosen USA wie Latinos, die - Reconquista! - die südlichen Bundesstaaten erobert haben. Auf den Straßen tummeln sich Hadschis und Taliban, die erzwungen haben, dass der 11. September als landesweiter Feiertag bejubelt wird ... was die US-Kids wegen ihres verpflichtenden Koran-Unterrichts auch für ganz normal halten. Und im Hintergrund dräut das mächtige Weltkalifat, zu dem sich einstmals verfeindete arabische Länder offenbar ganz problemlos zusammengefunden haben. Liberale Schwächlingsländer wie Kanada und die EU wurden durch gezielte Einwanderung längst in Satellitenstaaten umgewandelt, in denen die Scharia gilt, und nun droht Amerika dasselbe Schicksal. Anders Breivik sieht die Welt kaum anders.
Natürlich ist es völlig ok, wenn die Hauptfigur des Romans ein Rassist ist ("Japsen", "Handtuchköpfe", "Bohnenfresser"). Problematisch wird's dann, wenn auch alle anderen Figuren dieselbe Weltanschauung vertreten, sodass sogar in den Ohren des akademisch gebildeten Professoren-Opas orientalische Musik wie das Klagen von Gewaltopfern klingt. In Summe wird aus den Stimmen der Einzelfiguren eben langsam die Stimme des Autors. Und der lässt predigen bis zum Umfallen, zu jedem einzelnen Punkt und stets aus verschiedenen Kehlen, um auch ja den Wahrheitsgehalt zu bestätigen. Besonders abgesehen hat Simmons es auf die Präsidentschaft Barack Obamas, die im Roman als der Beginn des Untergangs herhalten muss. Die "übermäßigen" Sozialprogramme waren es nämlich, die die USA ausgeblutet haben; der Militär-Etat dürfte keine Rolle gespielt haben. Richtig schäbig wird's, wenn über "verhätschelte" Minderheiten wie die amerikanischen UreinwohnerInnen gesprochen wird, die solange mit geradezu verschwenderischer politischer Korrektheit behandelt worden waren, bis die muslimische Invasion kam und ihnen die Lebensmittellieferungen abstellte. Woraufhin alle verhungerten, weil ja alleine völlig lebensunfähig. Und auch für peinlich-kleinliche Randthemen ist sich Simmons nicht zu schade, etwa die groteske Kontroverse um die "dämonische" Pferdeskulptur am Flughafen von Denver, seit Jahren ein Dauerbrenner-Thema in den US-Medien. Der Leser mit dem "Fox News"-Verweis hatte schon recht: Das alles liest sich wie das Krakeelen eines alten Mannes, der seine Informationen aus einer recht einseitigen Quelle bezieht.
"Ich möchte aufwachen und sehen, dass ich in einem Land lebe, dessen Macht überall anerkannt wird - aber aus guten Gründen, nämlich weil es der Welt Gerechtigkeit bringt", verkündet Nick an einer Stelle mit tränennassen Wangen sein Manifest, und später ist auch von unserer weltweiten Verantwortung die Rede. Jaja, die Bürde des Weißen Mannes. - Aber spiegelt das alles nun wirklich die Meinung des Autors wider? "Hell, no!", schreibt Simmons auf seiner Website in einem ausführlichen Statement, das einige Medien als "Entschuldigung" bezeichnet haben. Seltsam eigentlich, denn relativiert wird da genau genommen gar nichts. Erst windet sich Simmons ziemlich herum, um dann erst wieder dieselbe Mischung aus einseitiger Betrachtung, Klischees und Ressentiments vom Stapel zu lassen - bis hin zur "necessary" healthcare samt Anführungszeichen. Aber einen Bestseller-Autor treibt dieses Thema vermutlich auch nicht so um wie Wenigerverdienende.
Give him this: Simmons could be the Tolstoy of the Tea party, schreibt die "Washington Post" in ihrer insgesamt noch recht freundlichen Bewertung des Romans. Eine ausgezeichnete Punkt-für-Punkt-Analyse des Romans und der darin enthaltenen Aussagen hat indessen Gerard Wood in der "Science Fiction World" geschrieben, die verlinke ich hier gerne. Erstaunlich, dass ein Genre-Medium strenger mit den politischen Aspekten des Romans umgeht als diverse renommierte Allgemein-Medien, die sich einem weniger prominenten SF-Autor wohl gar nicht erst gewidmet hätten. Da zehrt Dan Simmons wohl von seinem - zu Recht erworbenen - guten Ruf. Noch. Es wird einige gute Bücher brauchen, um diese Scharte auszuwetzen.
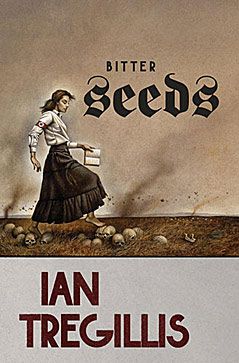
Ian Tregillis: "Bitter Seeds"
Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, Tor Books 2010
Manchmal kann ein Missstand doch noch zum Glücksfall werden: Dieses Buch hat seit mittlerweile eineinhalb Jahren ungelesen in meinem Regal herumgestanden - eine schwärende Wunde -, bis ich endlich Zeit dafür hatte. Dafür dauert jetzt das Warten auf den Nachfolgeband "The Coldest War" nur mehr sechs Monate. Was auch gut so ist, denn "Bitter Seeds" hat sich als echter Pageturner entpuppt. Und auch wenn sich darin ein großer Handlungsbogen schließt, bleiben am Ende doch diverse Fragen offen (inklusive der Identität einer äußerst mysteriösen Nebenfigur). Außerdem steht zu befürchten, dass die Romanfiguren den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben haben und ihnen - bzw. der ganzen Welt - noch wesentlich Schlimmeres bevorsteht.
Im 1920 angesiedelten Prolog seines Romanerstlings lässt uns US-Autor Ian Tregillis einen kurzen Blick auf die Kindheit der späteren ProtagonistInnen werfen. Da wäre zunächst der vaterlose Londoner Bub Raybould Marsh, den ein Geheimdienstoffizier unter seine Fittiche nimmt. Ein Stück davon entfernt, auf einem englischen Landgut, wird William Beauclerk, Enkel eines Herzogs, in die Familiengeheimnisse eingeweiht (Stichwort Hexerei). Und auf dem Kontinent werden Waisenkinder zu einer geheimnisvollen Sammelstelle gekarrt - unter ihnen ein grausames kleines Mädchen und ihr Bruder. Danach springt der Roman ins Jahr 1939 zum Spanischen Bürgerkrieg, um von nun an rings um die erwachsen gewordenen Hauptfiguren als Kriegschronik bis zum Jahr 1941 voranzuschreiten.
Weitestgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit wird der Zweite Weltkrieg auch mit anderen Mitteln als den bekannten ausgetragen: Blutmagie auf der einen Seite, diabolische Technologie auf der anderen. Denn die deutschen Waisenkinder wurden für ein experimentelles Programm rekrutiert: Durch die Götterelektron genannte Erfindung eines skrupellosen Wissenschafters haben sie - genauer gesagt die wenigen, die das Experiment überlebten - übermenschliche Fähigkeiten erlangt. Gretel, besagtes Mädchen, ist Hellseherin, während ihr Bruder Klaus durch Wände gehen kann; andere können sonnenheiße Energie abstrahlen oder Dinge kraft ihres Willens bewegen. Dank dieser Fähigkeiten ist Nazi-Deutschland das Kriegsglück holder als in der realen Historie: Die Evakuierung britischer Truppen aus Dünkirchen scheitert und mündet in ein Massaker, durch Gretels Hinweise spüren die deutschen Bomber zudem die britischen Radarstationen auf und erlangen die Lufthoheit. In der Stunde der Not weiß sich das Königreich nicht anders zu helfen, als auf die Warlocks zu setzen: Zauberer, die durch Verbindung mit metaphysischen Wesen die Naturkräfte beeinflussen können - und so hüllt sich die bedrängte Insel gewissermaßen in die schützenden Nebel von Avalon.
Polemisch formuliert könnte man den Plot als "Nazi-Cyborgs vs. britische Bluthexer" bezeichnen, aber hier kommt die eigentliche Qualität von "Bitter Seeds" ins Spiel. Denn die Absicht bestimmt den Ton, und Tregillis zielt weder auf Horror noch auf Actionseligkeit ab. Stattdessen ist "Bitter Seeds" ganz einfach ein Kriegsroman, mögen die Rahmenbedingungen auch exotischer wirken als die in unseren Geschichtsbüchern. Krieg bleibt dennoch Krieg. Tregillis blickt auf den Alltag der Menschen, die in solchen Zeiten leben müssen, es geht um Versorgungsengpässe, Evakuierungen und Trennung von Familien. Und ganz besonders um Opfer, die gebracht werden müssen ... oder die man zumindest bringen zu müssen glaubt. Denn die Eidolons, jene Wesen, die die Warlocks um Hilfe rufen, sind alles andere als Freunde der Menschheit. Als Manifestationen des Universums selbst betrachten sie die Menschheit als "Schmutzfleck" im Kosmos und verlangen für ihre Dienste einen hohen Blutzoll. Den die Entscheidungsträger Großbritanniens auch zu zahlen bereit sind - sie arrangieren Unfälle und schieben die Verluste unter der Zivilbevölkerung Nazi-Saboteuren in die Schuhe.
Hand in Hand mit der Fokussierung auf das Menschliche gehen glaubwürdige Charaktere. Die zudem alle etwas gemeinsam haben: Es steckt mehr in ihnen, als es zunächst den Anschein hat. Marsh führt dies noch in der einfachsten Form vor: Er wirkt auf seine Mitmenschen zunächst grobschlächtig, ist in Wahrheit aber hochintelligent, mitfühlend und ein liebevoller Familienvater ... was in Zeiten wie diesen leider zu Verlust führen kann. Der Schmerz darüber zu Zorn, und der zu noch mehr Leid. William wiederum scheint ganz der verwöhnte Oberschicht-Dandy zu sein, lässt hinter seiner verspielten Ausdrucksweise aber bald charakterliche Tiefe erkennen - er ist es auch, den der Preis, den Großbritannien für seine Strategie zu bezahlen hat, am tiefsten entsetzt. Und dann ist da noch die gänzlich undurchschaubare Gretel. Ist sie nun eiskalt berechnend oder sogar böse? Oder lebt sie nur durch ihre Orakel-Gabe in einem eigenen Wahrnehmungskontinuum, in dem das unveränderliche Zusammenspiel von Ursache und Wirkung jede moralische Bewertung unmöglich macht? In einer Nebenfunktion setzt der Autor sie überdies als Strukturelement ein - Gretels Überblicken von Zeit und Raum stellt Querverbindungen her, die sich dem Leser erst nach und nach erschließen.
Apropos Vorherbestimmung: So sehr die fiktive Historie auch von der realen abweicht, lässt der Autor es sich doch nicht nehmen, den Geschichtsverlauf immer wieder gleichsam auf Linie zu bringen. Vom Spanischen Bürgerkrieg als "Testlauf" für die Wehrmacht über die Winterkälte als Verbündeten der Sowjetarmee bis hin zur industriellen Massenvernichtung von Menschen fließen mehrfach Meme aus unserem Universum in die Romanwelt hinüber. Was auch so weitergehen dürfte, wenn Tregillis' Variante des Kalten Kriegs ansteht. Man darf auf die Fortsetzung gespannt sein: Mag "Bitter Seeds" im letzten Drittel auch etwas überstürzt wirken - die einzige größere Schwäche des Romans -, bleibt es dennoch ein sehr beachtliches Debüt.

Dirk van den Boom: "Kaiserkrieger" 2 - 4: "Der Verrat", "Der Aufbruch" & "Der Aufstand"
Broschiert, 220, 210 & 220 Seiten, jeweils € 13,30, Atlantis 2011
Und noch einmal Alternative History: 2010 schickte der deutsche Military-SF-Spezialist Dirk van den Boom für den Start seiner "Kaiserkrieger"-Reihe den Kleinen Kreuzer "Saarbrücken" aus dem wilhelminischen Deutschland durch ein Zeitloch ins Rom des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung ("Die Ankunft"). Drei weitere Teile sind seitdem erschienen - der nächste ist für Herbst angekündigt, und van den Boom denkt bereits jetzt über den als vorläufigen Abschluss geplanten Band 6 hinaus. Man hält ja kaum Schritt!
In "Die Ankunft" schlüpfte der vormalige Erste Offizier der "Saarbrücken", Jan Rheinberg, in die Rolle des Kapitäns und traf eine Entscheidung, deren Folgen sich nun nach und nach zu zeigen beginnen: Die Hoffnung auf eine Rückkehr ins 20. Jahrhundert hat man aufgegeben und versucht stattdessen ganz pragmatisch, sich auf möglichst lebenswerte Art in der neuen zeitlichen Heimat einzurichten. Was auf einen Pakt mit der vielversprechendsten Zivilisation dieser Ära hinausläuft: Dem Römischen Imperium, an dem allerdings die einsetzende Völkerwanderung nagt. Sicherheit gegen Know-how lautet die Devise - und auch wenn van den Boom seine Romane als Mischung aus Abenteuergeschichte und Strategiespiel in sehr straighter Weise heruntererzählt, steckt da doch eine hinreißend ironische Note im Grundkonzept der "Kaiserkrieger": Nämlich dass die Völkerwanderung ausgerechnet mit Technologie "Made in Germany" aufgehalten werden soll ... Band 2, "Der Verrat", endet mit Visionen von Dampfschiffen, Telegrafennetzen, Straßenbeleuchtung und Lokomotiven. Plus der Realisierung der ersten Schnapsbrennerei auf römischem Boden.
Aber Rheinberg und seinem Leitungsteam schwebt mehr vor als nur eine technische Modernisierung. Da wären noch Themen wie die Sklaverei oder religiöse Konflikte, die das Imperium schwächen. Immerhin schickt sich der trinitarische bzw. römisch-katholische Klerus gerade an, sich als Staatskirche zu etablieren und sämtliche anderen Religionen auszumerzen. In der realen Historie war es die größte "Leistung" des ansonsten wenig bemerkenswerten Kaisers Gratian, dieser Entwicklung Vorschub zu leisten. In van den Booms fiktiver Zeitlinie hingegen lässt sich Gratian von Rheinberg überzeugen, dass Vielfalt Stärke bedeuten kann. Der Konflikt mit Kirchenvater Ambrosius von Mailand, vom Autor als knallharter Machtmensch geschildert, ist damit vorprogrammiert. Eine zentrale Stelle von "Der Aufbruch" ist ein Disput zwischen Ambrosius und Rheinberg über das Wesen Gottes und des Menschen und das Verhältnis von Kirche(n) und Staat. Wo die Sympathien des Autors liegen, ist unschwer zu erkennen - während etwa den angreifenden Goten zugestanden wird, dass ihr Handeln der Notwendigkeit entspringt, und van den Boom sich bemüht, sie primär als Menschen und nicht bloß als Invasoren darzustellen, gibt es für das Machtstreben der Kirchenmänner keinen Pardon. Erst recht nicht für einen adeligen Meuterer an Bord der "Saarbrücken", der aus angeblicher religiöser Überzeugung - vermutlich aber eher aus persönlicher Geltungssucht - gegen Rheinbergs Politik der Toleranz rebelliert. Der wird wohl für den Rest der Serie als Rundum-Scheusal herhalten müssen.
Apropos Charaktere: Es fällt manchmal ein wenig schwer, die einzelnen Mitglieder von Rheinbergs Führungscrew voneinander zu unterscheiden, so nahtlos fügen sie sich in den großen Modernisierungsplan ein, den sie zusammen wie ein Uhrwerk abschnurren lassen. Da erweist es sich von Vorteil, dass der Autor ein breiteres Panorama aufgezogen hat. Denn in der Regel sind es die Nebenfiguren - der Gote Godegisel, der römische Schiffsjunge Marcellus (alias Wesleyus Crusherus) oder die Senatorentochter Julia, die sich in einen Fähnrich der Saarbrücken verliebt und ihn ohne böse Absicht zur Desertion und damit in eine lange beiderseitige Leidensgeschichte führt -, die aus nachvollziehbaren persönlichen Motiven heraus handeln. Im Vergleich zu den konzepttreuen Deutschen bringen sie damit ein dringend benötigtes Element der Instabilität in die Handlung ein und sorgen für unerwartete Wendungen.
"Kaiserkrieger" weist vom Grundkonzept her einige unverkennbare Parallelen zu David Webers "Nimue Alban"-Serie auf. Auch dort pickte sich der Vertreter einer High-Tech-Zivilisation unter den vorhandenen Staatsgebilden (in dem Fall denen eines vergessenen Kolonialplaneten) dasjenige heraus, das die besten Chancen auf Weiterentwicklung bot. Und auch dort wurde eine Kirche zum Hauptfeind der Modernisierung. Allerdings suhlt sich van den Boom - mit positiven Auswirkungen auf die Romanlängen - nicht derart ausführlich in strategischen und logistischen Abhandlungen wie Weber, dem für solche Passagen vermutlich längst ein eigenes Schreibprogramm zur Verfügung steht. Und auch wenn in "Kaiserkrieger" viel und durchaus brutal gekämpft wird, zeigt van den Boom auch nicht dieselbe Militärseligkeit. Nichts könnte das besser illustrieren als der Grund, warum in "Der Aufbruch" eine Expedition nach Äthiopien geschickt wird: Rheinbergs Männer haben den lauwarmen römischen Tafelwein satt und wollen e-n-d-l-i-c-h die Kaffeebohne ins Imperium holen.
So wie "Kaiserkrieger" angelegt ist, hat es das Potenzial zur Endlosserie - eine Art Military-Soap, die sich auf einer immer weiter von der realen Historie abweichenden Zeitlinie entlang bewegt. Nur ganz im Hintergrund lauert immer noch die Frage, was wohl passiert, wenn die "Saarbrücken" am Ende doch noch eine Rückreisemöglichkeit finden sollte und dann in einer völlig veränderten Gegenwart landet.
... soviel für diesen Monat, beim nächsten Mal widmen wir uns Stromausfällen, fleischfressenden Pflanzen und glücklosen Superhelden, bis denne!
(Josefson)