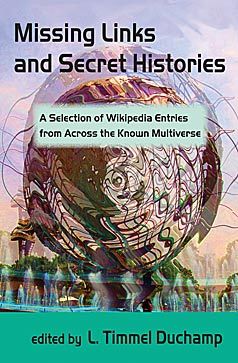
L. Timmel Duchamp (Hrsg.): "Missing Links and Secret Histories: A Selection of Wikipedia Entries from Across the Known Multiverse"
Broschiert, 224 Seiten, Aqueduct Press 2013
Both the Priesthood of Ilúvatar and the Church of the Elven Queen maintain that the Galadriel Apocrypha is not only heretical but also a danger to the proper functioning of the Cyborg Sphere. (...) The Ilúvatar AI, as always, has made no comment one way or the other.
Nanu, wo sind wir denn hier gelandet? "The Galadriel Apocrypha" von Kristin King belehrt uns, dass 300 Jahre nach dem Tod von Prophet Tolkien ihm zugeschriebene Texte ebenso wild diskutiert werden wie früher christliche Evangelien, ob sie denn nun kanonisch seien oder nicht. Insbesondere gilt dies für besagte Apokryphen, in denen die spätere Elbenherrscherin - zu diesem Zeitpunkt noch in den Unsterblichen Landen ihrer Kindheit ansässig - gerade ihre achtmillionste Gemme fertiggeschnitzt hat und zu der Einsicht kommt: Also irgendwie stagniere ich hier ...
Das Prinzip
Kings Text ist einer von über 20 Beiträgen zu einer Anthologie der ungewöhnlicheren Art: "Missing Links and Secret Histories" kommt als gedruckte Version der Wikipedia daher. Wenn auch einer Wikipedia, die entweder aus der Zukunft oder aus parallelen Gegenwarten gespeist wurde. Erst dachte ich noch: Naja, letztlich auch nichts anderes als eine Storysammlung mit irgendeinem roten Faden, und das mit dem lexikalischen Aufbau ist auch nicht wirklich neu. Immerhin hab ich damals in meiner Schulzeit brav "Das Chasarische Wörterbuch" von Milorad Pavic gelesen.
Aber die "Missing Links" sind nicht wirklich episch angelegt. Alle Texte folgen formal dem Aufbau eines Wikipedia-Eintrags: Also inklusive Inhaltsverzeichnis-Kasten, Quellenangaben (in denen sich immer wieder gute Gags verbergen), kritischer Anmerkungen ("This article has multiple issues") und Links vortäuschender Wortunterstreichungen. Und vor allem sind sie streng im Ton von Sachtexten verfasst - die Komik ergibt sich daraus, wie hier mit den Fakten umgegangen wird. Es empfiehlt sich, beim Lesen ein Fenster der capital-W Wikipedia, wie sie im Vorwort genannt wird, offen zu halten. Nämlich um zu checken, welche Begriffe hier eine reale Grundlage haben und einfach nur in einen völlig neuen Kontext gestellt wurden - und welche komplett frei erfunden sind.
Gott ist wie Barbara Cartland
Sehr hübsch ist Anna Tambours Biografie einer bekannten Persönlichkeit namens "God": Geboren auf einem Zwergplaneten, macht er eine problematische Kindheit durch, entwickelt früh his lifelong habit of creating, setting, and scattering Indiscriminate Destruction Devices (plagues, earthquakes, and assorted Pain, Death, and Destruction) und wird schließlich auf einen blauen Planeten deportiert. Dort versucht er sich als Buchautor, zieht sich allerdings nach seinem Blockbuster "Die Zehn Gebote" (albeit dictated à la Barbara Cartland) wieder vom Schreiben zurück. Eine ganze Reihe von Ghostwritern, die später behaupten, in seinem Namen geschrieben zu haben, lassen sich laut Tambour in ihrer Authentizität nicht bestätigen.
Jeremy Sim erklärt uns in einer weiteren Bio, "Thaddeus P. Reeder", wer jener geheimnisvolle "Dear Reader" war, an den sich AutorInnen des 19. Jahrhunderts so gerne wandten. In einem zweiten Beitrag, "Sanyo TM-300 Home-Use Time Machine", schildert Sim das Aufkommen von Zeitmaschinen, was unversehens ins Chaos mündet: Mitten im Text wird der Wikipedia-Eintrag nämlich "gehackt" und kippt in eine Warnung vor den Folgen des Zeitgereises. Und noch eine Autorin bricht den geschlossenen Kontext in Form eines Pseudo-Hacks auf: Lucy Sussex verheißt in ihrem sehr weirden Beitrag "La Cucaracha Rules" die Weltverschwörung der Kakerlaken.
Mash-Upocalypse Now
Marlon Brando dürfte für John C. Coyne die schwergewichtige Muse gespielt haben, um H. G. Wells' "Die Insel des Dr. Moreau" und Joseph Conrads "Herz der Finsternis" kurzzuschließen. Immerhin verkörperte Brando sowohl den Doktor als auch den Colonel Kurtz in der Conrad-Verfilmung "Apocalypse Now". Das Ergebnis der Querverbindung nennt sich bei Coyne "The Kurtz-Moreau Syndicate" und dreht sich um die Lieferung von Tiermenschen-Soldaten für die koloniale Eroberung Afrikas.
Dieser Text fasst einige Grundzüge der Anthologie sehr schön zusammen. Die Mehrzahl der Beiträge sind Mash-Ups, verknüpfen also bereits existierende Werke der Literatur auf neue Weise miteinander. Vor allem im 19. und späten 18. Jahrhundert bedient man sich gerne, bei Rudyard Kipling, Edgar Allen Poe, den Brontë-Schwestern, Marquis de Sade und so weiter und so fort. Anne Toole hat sich gar der legendären satirischen Novelle "Flatland" von Edwin Abbott Abbott angenommen - die darin geschilderte zweidimensionale Welt genießt mittlerweile ja Kultstatus.
Der rote Faden dabei ist zumeist, dass Romanfiguren - inklusive diverser Märchenwesen - als reale Personen behandelt und in eine mal mehr, mal weniger originelle Secret History gestellt werden. Mit augenzwinkernden Anspielungen sonder Zahl, versteht sich. Mark Richs Biografie der Mars-Prinzessin "Deja Thoris" von Edgar Rice Burroughs beispielsweise ist nicht nur unterhaltsamer, sondern auch von belesenerer Seite geschrieben als ihr Eintrag in der realen Wikipedia.
Mehr als nur ein Spielkasten
"Missing Links" ist kurz gesagt ein einziges intellektuelles Spiel. Nicht alle AutorInnen gehen dabei über das bloße Spiel um des Spiels willen hinaus - und die, die es tun, sind der feministischen Ausrichtung des Verlags Aqueduct Press entsprechend zumeist Frauen mit gesellschaftspolitischem Anliegen. Verlagsleiterin L. Timmel Duchamp etwa schildert in ihrem Beitrag die Neuentdeckung der Science Fiction in einem matriarchalischen Eugenik-"Utopia" des 25. Jahrhunderts. Während Nisi Shawl (die einzige Autorin, die ich zuvor kannte) in "The Five Petals of Thought" eine fiktive, von Frauen und ethnischen Minderheiten geprägte philosophische Bewegung beschreibt, die das 20. Jahrhundert beeinflusst habe. Oder ein 20. Jahrhundert, um genau zu sein.
Womit wir wieder beim Anfang und Kristin King angelangt sind: Sie lässt nicht nur Galadriel den goldenen Käfig erkennen, in dem sie als Elbin (oder Frau) sitzt. In einem zweiten Beitrag, "Mystery of the Missing Mothers", widmet sie sich der Frage, wie Frauen aus der Geschichtsschreibung rausgestrichen wurden. Das verkleidet sie allerdings als vergnügliches Puzzle um eine fiktive Autorin, deren Romanheldinnen und babylonische Gottheiten, die darüber räsonieren, welche Figur dieser Autorin denn die coolste sei. Viel postmoderner geht's nicht.
Wie gesagt: "Missing Links" ist ein Spiel, und wie bereit man ist mitzuspielen, hängt nicht zuletzt davon ab, wie stark der persönliche Bezug ist, den man zum jeweils behandelten Thema hat. In der vermutlich originellsten Anthologie des Jahres dürften aber für jeden einige Kleinodien enthalten sein. Zumindest für jeden, der so wie ich gelegentlich dazu neigt, auf der capital-W Wikipedia hängenzubleiben wie andere Leute vor der Glotze.
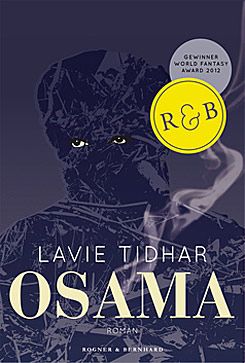
Lavie Tidhar: "Osama"
Gebundene Ausgabe, 302 Seiten, € 22,95, Rogner & Bernhard 2013 (Original: "Osama", 2011)
Whether he wanted to or not, Tidhar has effectively out-PKDed PKD, lobt die "Los Angeles Tribune" Lavie Tidhars vielbeachteten (no na, bei dem Titel ...) und mit dem World Fantasy Award ausgezeichneten Roman "Osama". PKD steht für Philip K. Dick und das Kompliment ist so gemeint, dass Tidhar die Plot-Techniken vom Meister der sich auflösenden Realität übernimmt, sich zudem aber auf einem stilistischen Level bewegt, das Dick nur zu gern erreicht hätte. Eine gute Zusammenfassung, und mehr sollte man von der Rezension auch nicht lesen - jedenfalls nicht vorab, denn sie enthält mehr Spoiler als eine minutiöse Filmhandlungsschilderung auf der Wikipedia.
Eine Schundromanfigur namens Osama
Lavie Tidhar, ein nach jahrelangen Weltreisen heute in England lebender Israeli, ist ein Mann vieler Facetten. Und zumindest eine davon sollte man vor dem Lesen von "Osama" kennen: Tidhar ist ein ausgemachter Fan von Pulps. Das reicht von jenen knallbunten Geschichten der 30er bis 50er Jahre, in denen die US-amerikanische Science Fiction ihre Wurzeln hat, bis zu den berüchtigten Stalagim: Nazi-Exploitation-Pornos, wie sie in Israel Mitte des 20. Jahrhunderts populär waren. Vergleichbares taucht auch in "Osama" auf, mag es "Ich war Kommandant Heinrichs Hure" oder "Bekenntnisse einer zugedröhnten Nymphomanin" heißen. Und mitten unter solchen Perlen des fiktiven Verlags Medusa Press findet sich auch eine ganz besondere Serie mit dem Titel "Osama bin Laden: Vergelter". Anders kennt man bin Laden in dieser Welt nicht.
Unwillkürlich drängt sich ein Vergleich mit Matt Ruffs ziemlich zeitgleich entstandenem Alternativweltroman "The Mirage" auf, in dem es ebenfalls keinen al-Qaida-Terror gibt (dafür jede Menge christlich-fundamentalistischen). Während einem dort aber die auf den Kopf gestellte Weltgeschichte förmlich ins Gesicht springt, setzt Tidhar auf eher subtile Details - die bin-Laden-Umdeutung ist da schon mit Abstand das auffälligste - und mehr noch auf Auslassungen. Später im Roman wird uns im Schnelltakt aufgelistet, was wir zuvor in dieser Welt alles vermisst haben und was ihr - neben dem Fehlen von Terrorismus und dessen Folgekriegen natürlich - eine so eigentümlich gemütliche Anmutung verleiht.
Hauptfigur und Plot
Joe - kein Nachname - lebt als Privatdetektiv in der laotischen Hauptstadt Vientiane so vor sich hin und liest ganz gerne mal einen der "Osama"-Romane von Mike Longshott. Da erscheint es fast wie ein Zeichen, als eines Tages eine Frau sein Büro betritt und ihn dafür engagiert, diesen Autor zu finden. Kurz darauf wird auf Joe geschossen - die erste Warnung. Weitere werden folgen und schmerzhafter ausfallen, wenn ihn seine Recherchen erst nach Paris zum geheimniskrämerischen Verleger von Medusa Press, dann nach London und schließlich nach New York führen. Wo unter anderem ein OsamaCon stattfindet, auf dem neben Weltverschwörungstheorien jede Menge bizarres Merchandising feilgeboten wird.
Im Zuge der Ermittlungen nimmt Joes Mission allmählich einen anderen Charakter an. Namenlose Anzugträger warnen ihn davor, eine Tür zu durchschreiten, durch die es kein Zurück mehr geben wird. Menschen scheinen direkt vor seinen Augen zu verschwinden, andere fragen ihn, ob er einer von ihnen sei. Und was als standardmäßige Mission einer Personenfindung begann, wird mehr und mehr zu einer Suche nach dem Wesen der Welt und seiner selbst. Ein typisch Philip K. Dick'sches Gefühl von "Irgendetwas stimmt hier nicht" liegt über allem. Originellerweise wird des Rätsels Lösung letztlich aber nicht bei Dick zu finden sein, sondern bei ... Astrid Lindgren, ausgerechnet.
Das Pulp-Paradoxon
Der arbeitslose Privatdetektiv mit Revolver und Whiskyflasche in der Schublade, die geheimnisvolle Schöne, die in sein Büro gestöckelt kommt, und die handgreiflichen Widersacher: Tidhar verwendet astreine Pulp-Topoi, um seine Handlung in Gang zu setzen. Nur schreibt er vollkommen anders. So wie die "Osama"-Pulps der Romanwelt nicht reißerisch, sondern als extrem nüchterne Aufzählungen von Daten und Abläufen geschrieben sind, so liegt auch "Osama", der Roman, weitab von Pulp-Stil. Am einsamsten fühlte er sich immer beim Fliegen. In einem Flugzeug kam er sich vor, als gäbe es ihn nicht. Von seiner Sprache her ist der Roman fast schon lyrisch gehalten. Er lebt von all den vielen Eindrücken, die jemand gewinnt, der die Muße hat zu sehen. Tidhars Reisejahre haben sich hier nachhaltig ausgewirkt.
Besonders hervorgehoben sei das Kapitel "Im Übergang", das wirklich wunderschön ist (sofern man das bei der Schrecklichkeit der darin geschilderten Ereignisse so sagen kann) und einen emotionalen Höhepunkt des Romans darstellt. Ein zweiter folgt ganz am Ende mit einer alleserklärenden Konfrontation, die Joe zu einer Entscheidung zwingen wird.
Gedanken über Terrorismus
Wer nur an des Rätsels Lösung interessiert ist, wird eine befriedigende bekommen. Was den Roman aber zu etwas Besonderem macht, ist, dass er weit über das bloße Wie-ist-es-denn-zu-dieser-Welt-gekommen-Spiel hinausgeht. Joe mag in einer beruhigten Parallelwelt leben - aber im Grunde erlebt er Terrorismus so, wie ihn die meisten von uns erleben: Als etwas, das anderen passiert, das nicht in unsere Welt gehört.
Und Joe mag die in den "Osama"-Pulps beschriebene Weltpolitik fremdartig vorkommen. Aber das hindert ihn nicht daran, über ihre Logik nachzudenken. Akte des Terrorismus werden von der einen Seite vielleicht nicht als Kriegshandlungen anerkannt; doch für eine Kriegserklärung reicht eigentlich schon eine Seite, denkt Joe.
Sei es, dass die Opferzahlen der Terroranschläge mit denen der Folgekriege verglichen werden, seien es die Schicksale derer, die in "Im Übergang" beschrieben werden: Tidhar vermeidet einseitige Betrachtungen und versucht allen Beteiligten ein Gesicht zu geben. "Osama" ist damit - trotz seiner pulpigen Züge - ein sehr nachdenkliches Werk über das Wesen von Terrorismus und Politik. Und eine Erinnerung daran, dass "Geschichte" nicht umsonst sowohl "Historie" als auch "Erzählung" bedeuten kann - beides ist letztlich ein Konstrukt. Großartiges Buch!
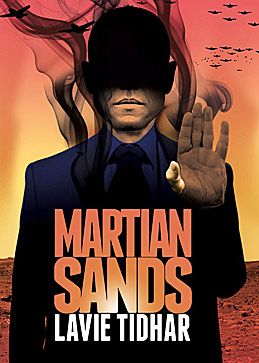
Lavie Tidhar: "Martian Sands"
Gebundene Ausgabe, 214 Seiten, PS Publishing 2013
"There is no timetravel. (...) This is an Einsteinian universe," Miriam said. And therefore, she thought, it is also a Jewish one. "Martian Sands" ist ein schöner Beleg dafür, wie belebend es für die Science Fiction sein kann, wenn nicht-angloamerikanische Perspektiven und Traditionen ins Genre eingebracht werden. Was im Falle des israelischen Autors Lavie Tidhar nicht nur die SF-Geschichte seines eigenen Landes meint (sein jüngster Roman enthält zum Beispiel Verweise auf den hierzulande vermutlich völlig unbekannten israelischen Genetiker und SF-Autor Ram Moav), sondern auch das, was Tidhar auf seinen extensiven Weltreisen aufgeschnappt hat. Siehe "Osama".
Tidhar ist, wie schon öfter gesagt, nicht auf ein bestimmtes Genre festzulegen. Das illustrieren frühere Werke wie "The Tel Aviv Dossier", "Cloud Permutations" oder die "Bookman"-Serie; letztere vor "Osama" bislang als einziges ins Deutsche übersetzt und meiner Meinung nach eigentlich Tidhars schwächstes Werk. Von Steampunk bis Fantasy war da alles dabei. In letzter Zeit hat sich der überaus schreibfreudige Autor aber verstärkt der Science Fiction zugewandt. Er veröffentlichte unter dem Schlagwort "Central Station" eine ganze Reihe Erzählungen rund um eine Art Weltraumbahnhof in Tel Aviv. "Martian Sands" gehört zwar nicht dazu, handelt aber in einer ähnlichen Zukunft.
Das Szenario
Ein paar Jahre nach der Besiedelung des Mars herrscht immer noch ein gewisser Pioniergeist, aber die Gentrifizierung schreitet voran. So wurde ein abgestürztes Raumschiff zum schicken Apartment-Komplex umgewandelt und ein Neureicher weist stolz auf ein paar Rostflecken an der Decke hin: "The impact of the landing killed the entire crew. This is all that's left of them." Mit kleinen Details wie diesem versteht es Tidhar, den gegenwärtigen Zustand der marsianischen Gesellschaft wunderbar verdichtet zu beschreiben. Ein anderes wären die offenbar nicht mehr gebrauchten Roboter, die in Hauseingängen um Ersatzteile betteln. Generell ist der Roman in einem ruhigen Ton voller aufmerksamer Beobachtungen geschrieben. Wenn es die Handlung verlangt, können sich die Eindrücke aber auch zum Hochtempo-Kaleidoskop verdichten.
Nationalstaaten gibt es noch, auf der Erde ebenso wie auf dem Mars. Wie etwa New Israel, das Simulacra historischer MinisterpräsidentInnen anfertigen lässt und wegen ihrer ikonischen Wirkung als "Avatare der Macht" einsetzt. Als aktuelle Bauchrednerpuppe fürs Volk agiert David Ben-Gurion, aber eine Golda Meir steht bereits in den Startlöchern. Dann wären da noch die mysteriösen Others: Deren Identität wird einigermaßen früh geklärt - aber spät genug, dass ich es hier nicht tue, um den Suspense nicht zu untergraben. Und schließlich die Born Again Martians (herrliche Idee!), die nach individuellen Erweckungserlebnissen glauben, reinkarnierte UreinwohnerInnen des Mars zu sein. Und sich daher entsprechend chirurgisch verändern lassen: nämlich mit einem zusätzlichen Paar Arme.
Die Born Again Martians träumen von einem grünen Mars der Vergangenheit, überzogen mit üppiger Vegetation, schiffbaren Kanälen und eleganter Architektur. Diese Visionen entsprechen ganz den "Barsoom"-Romanen von Edgar Rice Burroughs und sind nur ein Beispiel von vielen für das Tidhar-typische Spiel mit Literaturverweisen. Wir betreten eine Marihuana-Bar, die sich nach einem James-Tiptree-Jr-Titel passenderweise "Her Smoke Rose Up Forever" nennt. Und wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man sogar das Stück "Oz", das Tidhar in "Martian Sands" eingebaut hat.
Die Figuren
Vor diesem Hintergrund lernen wir ein knappes halbes Dutzend ProtagonistInnen kennen, deren Wege sich an einem entscheidenden Punkt kreuzen werden. Josh Chaplin ist ein junger Call-Center-Mitarbeiter, der der Kundschaft Dünger andrehen soll. Selling shit, das fasst sein bislang recht unbefriedigendes Leben zusammen. Carl Stone bzw. "K't'Amin" ist ein Roboter-Konstrukteur und zugleich ein "wiedergeborener marsianischer Krieger" ... mit anderen ein Worten ein vierarmiger Loser. Energischer und deutlich reifer als diese beiden zusammengenommen nimmt sich dagegen Miriam Elezra aus, die für die Regierung von New Israel arbeitet.
Und dann hätten wir da noch zwei eher ausgefallene "Charaktere": Zum einen Sam, eine intelligente Patrone(!), die für einige stilistisch wirklich mitreißende Passagen sorgt. Und schließlich der schwer fassbare Bill Glimmung. Der taucht nicht nur in der Realität der übrigen ProtagonistInnen auf, er ist zugleich der Titelheld unzähliger marsianischer Detektivgeschichten. Seinen ersten Auftritt hat er allerdings im Prolog des Romans, wo er unmittelbar vor dem Anschlag auf Pearl Harbor im Oval Office auftaucht und Franklin Delano Roosevelt einen Deal anbietet: Die Rettung von sechs Millionen Juden gegen eine Verkürzung des Zweiten Weltkriegs mittels Technologie aus der Zukunft. - Welcher davon ist nun der echte Glimmung?
Es wird Dick'sch
All diese Figuren treffen zur selben Zeit am selben Ort zusammen - bei einem Mordanschlag. Danach ist für sie alles anders. Für Miriam bedeutet das Herausfallen aus der bisherigen Realität Identitätsverlust. Sie hat plötzlich das Gefühl, in einem Glimmung-Film gelandet zu sein; das Golda-Meir-Simulacrum nährt diese Furcht noch und orakelt, dass hier irgendetwas "falsch" sei. Und für Josh bedeutet die Realitätsverschiebung: Auschwitz ...
Burroughs mag das Bühnenbild von "Martian Sands" mitentworfen haben. Die Geschichte selbst wandelt aber auf den Spuren von Philip K. Dick. Die Auflösung der Realität zieht sich praktisch durch dessen gesamtes Werk, ein paar direkte Inspirationsquellen für "Martian Sands" lassen sich aber herausfiltern. "Marsianischer Zeitsturz" liegt wegen des Settings nahe, auf "Ubik" wird explizit angespielt, und die "VALIS"-Trilogie liegt auch nicht fern. Nicht nur wegen der visionären Offenbarungen, die hier wie dort die Handlung beeinflussen. Sondern auch, weil das "VALIS"-Zitat "The Empire Never Ended" hier aufgegriffen und in einen neuen (und zugegebenermaßen banaleren) Kontext gestellt wird.
Metafiktion wird bei Lavie Tidhar also einmal mehr großgeschrieben. Und wenn sich die Romanfiguren an einer Stelle über die Struktur einer typischen Bill-Glimmung-Geschichte unterhalten, dann wird es niemanden verwundern, dass auch "Martian Sands" exakt diesem Aufbau folgt. Bei aller Spielerei vergisst Tidhar aber nicht, eine spannende Geschichte mit hochbefriedigender Auflösung des großen Rätsels abzuliefern. - "Martian Sands" ist insgesamt vielleicht nicht ganz so überragend wie "Osama", aber immer noch groß. Hui, was für ein Autor!

Royce Buckingham: "Die Karte der Welt"
Kartoniert, 608 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2013
Neulich merkte ein Rezensent in der SF-Zeitschrift "Locus" an, was für ein zweischneidiges Schwert die obligatorischen Karten in High-Fantasy-Romanen für ihn seien. Schön anzuschauen sind sie ja - aber in Kombination mit der Romanlänge beschwören sie die unheimliche Vorahnung herauf, dass jeder einzelne der darauf angegebenen Punkte auch tatsächlich abgeklappert werden wird. Das ähnelt dem Grusel, der einen befällt, wenn man zu spät bemerkt, dass man nicht in den Intercity, sondern versehentlich in den Bummelzug eingestiegen ist, der auf derselben Strecke bei jeder Milchkanne stehen bleibt.
In Royce Buckinghams brandneuem Roman "Die Karte der Welt" ist besagtes Objekt aber nicht bloß schmückendes Beiwerk, sondern das eigentliche Thema. Mit positiven Auswirkungen auf den Plot: Endlich mal wieder ein Fantasy-Roman, in dem es nicht (nur) ums Verteidigen, sondern vor allem ums Entdecken geht! Diese Variante kommt meiner Meinung nach gegenüber der anderen viel zu kurz. Und zu entdecken gibt es genug, wenn sich den RomanheldInnen hier neue Länder erschließen: Vergessene Völker, fleischfressende Rinder, blutsaugende Echsen und natürlich Kannibalen, kurz: All das, was man sich in unserer Welt einst vorstellte, wenn man bei unbekannten Regionen schlicht "Hic sunt dracones" eintrug. Klar, dass auch ein Drache dabei ist.
Die Mitwirkenden
Hauptfigur des Romans ist der 17-jährige Wexford "Wex" Stoli, der am äußersten Nordrand des Königreichs Abrogan als Sohn eines Schweinezüchters aufwächst. Zugegeben, ich wäre begeistert, wenn statt eines sympathischen Jungen vom Lande zur Abwechslung mal z.B. ein zänkisches altes Ehepaar mit der Gabe gesegnet wäre, als einzige das Abendland retten zu können - aber Fantasy dreht sich halt um Identifikation. Außerdem setzt der Roman ohnehin viel weniger auf Stereotypen, als man das auf den ersten Blick erwarten würde.
Wex jedenfalls ist enthusiastischer Maler; der Beschreibung nach übrigens Impressionist. Sein Talent kommt gelegen, als eine königliche Expedition einen neuen Kartographen braucht, um die Nordgrenze des Reichs aufzuzeichnen. Also dort, wo seit Jahrhunderten der Schleier wie eine gigantische schwarze Wand das Weiterkommen verhindert (im Vorwort wird das magische Ritual beschrieben, mit dem der Schleier einst über die Welt gebracht wurde). Dem Expeditionskorps gehören neben Soldaten auch ein paar Outcasts an, mit denen sich Wex nach anfänglichem Misstrauen anfreundet. Ein paar davon haben Artgenossen unter dem Schleier, wie sich noch zeigen wird.
Die Expedition nimmt einen unerwarteten Verlauf, als Wex ein Stück Gegend in die königliche Karte einträgt, das eigentlich unter dem Schleier verborgen ist - am nächsten Tag liegt es plötzlich frei. Es stellt sich die Frage, ob Wex nur erkennt, was da ist, oder ob er im Stil von "Die Unendliche Geschichte" neue Stücke Welt erschafft. In jedem Fall bietet sich jetzt die Gelegenheit, neue Wege zu beschreiten und zu sehen, was einem auf diesen entgegenkommt. - Unter anderem leider Vill Magnan, ein ehemaliger königlicher Offizier, der ins Exil intrigiert wurde, sich in den Schleier flüchtete und nach dessen Lüpfung auf Rache sinnt ...
Der Ton macht die Musik
Wex beugte sich herunter. "Hallo, kleines Mädchen", sagte er in einem kindischen Singsang, um ihr keine Angst zu machen. "Wie heißt du denn?" "Kleines Mädchen?", schnaubte sie und trat ins Licht. "Wenn mich nicht schon jeder Idiot in zwei Königreichen alles Mögliche geheißen hätte, hätte ich gute Lust, dir eins in die Eier zu geben." Trotz Buckinghams Vorgeschichte als Autor von Romanen wie "Dämliche Dämonen" oder "Garstige Gnome" ist "Die Karte der Welt" keine Funny Fantasy. Immerhin wird hier ein ganzes Volk massakriert, werden Soldaten bei lebendigem Leib gekocht und Kinder bleiben auch nicht verschont. Und doch bringt einen Buckinghams lockerer Erzählton immer wieder zum Grinsen.
Dieser Ton ist Teil der Strategie, zwar ein Fantasy-Abenteuer mit allem von den LeserInnen erwarteten Drum und Dran abzuliefern, dabei aber die ärgsten Klischees doch zu umschiffen. Man kann ja auch nicht 24 Stunden am Tag hehr und heldisch sein - selbst die holde Maid Brynn sabbert im Schlaf (und hätte Tolkien jemals erwähnt, dass sich Lady Arwen hinter einem Gebüsch erleichtert?).
Keine reinen Schablonen
Auch die Hauptfigur wird nicht übermäßig ernst genommen - von ihren ReisegefährtInnen schon gleich gar nicht, aber auch der Autor selbst stutzt Wex immer wieder zurecht. Soll heißen: Er lässt nicht die gesamte Welt nur um ihn kreisen. Wie oft kommt es in "Harry Potter" eigentlich vor, dass die Schulklasse zu einer Lehrstunde antritt, etwas Unerwartetes passiert, wenn HP an der Reihe ist ... und daraufhin der Unterricht abgebrochen wird? Pfeif auf die anderen Figuren, wozu sollen die was lernen, sind eh nur Staffage - das ist bei Buckingham nicht so.
Kraven zum Beispiel, der Magier der Gruppe, der allseits belächelt wird, weil seine Gabe nicht mal für die Legion der Ersatzhelden reichen würde. Der sollte eigentlich auf Wex' weltveränderndes Talent neidisch sein und zum klassischen Widersacher werden - bleibt jedoch ein treuer Mitstreiter. Und der eigentliche Bösewicht des Romans, Vill, ist auch nicht der befürchtete Lord des dunklen Klischees. Viel eher schon ein zutiefst traumatisierter Normalo (der seine Psychokiste allerdings auf eine ziemlich beschissene Weise abarbeitet, muss man leider sagen).
Mehr ist möglich
Ganz nüchtern ist zu konstatieren, dass der ganze Rachefeldzug Vills ein wenig bemüht daherkommt. Buckingham brauchte halt etwas, um die Action-Handlung voranzutreiben. Dabei regt sich zwischendurch mehrfach ein Motiv, das viel mehr hergeben könnte: Nämlich die Erkenntnis, dass das ganze Königreich Abrogan letztlich auf Blut und ethnischen Säuberungen aufgebaut ist. Erst jetzt, wo sich der Schleier über den einstmals Vertriebenen hebt, deutet sich an, dass die königliche Geschichtsschreibung einiger Korrekturen bedürfte.
Das klingt im Roman leider nur zaghaft an und würde meiner Meinung nach ein viel spannenderes Plot-Vehikel abgeben als Vill in Rage. Aber vielleicht kommt das ja noch. Denn "Die Karte der Welt" hat zwar eine abgeschlossene Handlung, riecht aber irgendwie doch stark nach einer Fortsetzung. Weitere Romane sind geplant, die Buckingham - ungewöhnlich! - wie diesen auch exklusiv für den deutschsprachigen Markt schreiben wird. Wer weiß, vielleicht klappern wir die Riesenkarte im Bucheinband ja doch noch komplett ab ...
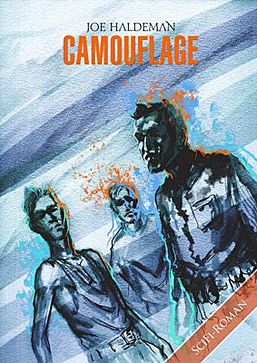
Joe Haldeman: "Camouflage"
Broschiert, 352 Seiten, € 14,40, Mantikore 2013 (Original: "Camouflage", 2004)
Zwei Außerirdische, die seit langer Zeit im Verborgenen auf der Erde wirken, durch die Zeitalter der Geschichte wandern und zu Gegenspielern werden: Im ersten Moment dachte ich bei der Kurzbeschreibung von "Camouflage" an Roger Zelaznys Erzählung "The Game of Blood and Dust", dann kam es aber doch ganz anders. "Camouflage" ist eines der Spätwerke von SF-Altmeister Joe Haldeman ("Der Ewige Krieg"; Rezension folgt demnächst), die nicht mehr ins Deutsche übersetzt wurden. Bis sich kürzlich der Mantikore-Verlag ihrer angenommen hat. Zuvor erschien bereits "Herr der Zeit": Der war ok, wenn auch nicht aufregend - das Nebula-gekrönte "Camouflage" hingegen ist da schon um einiges interessanter.
The good ...
Im Grunde ist "Camouflage" die Geschichte einer Menschwerdung - und da hat der Protagonist, genannt der Wechselbalg, eine ganz schöne Strecke zurückzulegen. Aus dem Kugelsternhaufen M12 stammend und einer Spezies unsterblicher Gestaltwandler angehörend, ist der Wechselbalg vor einer Million Jahre oder so auf der Erde gestrandet. Die längste Zeit hat er in Gestalt verschiedener Meerestiere verbracht - eines Tages aber verschlägt es ihn an Land.
Nach einem - rein zweckorientierten - Mord zum Einstand schlüpft der Wechselbalg in die Rolle des Getöteten und landet bei dessen Familie. Es ist der Beginn eines ebenso langen wie realistisch langsam geschilderten Lernprozesses, der buchstäblich bei null beginnt. Dieser Weg zur Selbstfindung hat durchaus seine komischen Seiten, etwa wenn es um Sexualität geht: Der Wechselbalg bemerkte seinen neuen, erigierten Zustand und experimentierte damit herum und das unerwartete Ergebnis erklärte plötzlich eine ganze Reihe von Säugerverhalten, das er bei Schweinswalen, Delfinen und Schwertwalen beobachtet hatte. Je besser der Wechselbalg sich anpasst, desto mehr übernimmt er aber auch menschliche Konzepte von Gut und Böse: Aus dem anfangs vollkommen amoralischen Wesen wird ein wahrer Mensch. Ein Prozess, der seine Vollendung in - was sonst? - der Liebe findet.
... the bad ...
Ganz anders der Weg eines zweiten Aliens. Während der Wechselbalg erst Anfang der 30er Jahre die Zivilisation aufsucht, bewegt sich das skrupellose und genusssüchtige Chamäleon seit Jahrtausenden als (Un-)Mensch durch die Geschichte. Haldeman vermeidet dankenswerterweise die kitschige Idee, historische Persönlichkeiten zu Masken des Außerirdischen zu retconisieren. Aber das Chamäleon trifft so einige Promis und glaubt - fälschlicherweise - manche sogar als mögliche Verwandte ausgemacht zu haben: Insbesondere Jesus Christus und Josef Mengele, nette Mischung.
Entlang der Lebenswege von Wechselbalg und Chamäleon bewegen wir uns langsam auf die Romangegenwart des Jahres 2019 zu, die in einem parallelen Handlungsstrang geschildert wird. Hier wird der Meeresbiologe Russell Sutton vom ehemaligen Admiral und Selfmade-Unternehmer Jack Halliburton engagiert, ein mysteriöses Objekt aus dem Tonga-Graben zu bergen: Das außerirdische Raumschiff, wie wir bereits wissen. Natürlich beginnt man sich da bald gespannt zu fragen, ob Wechselbalg und/oder Chamäleon nicht schon längst auch in diesem Handlungsstrang inkognito vertreten sind und welches Mitglied des Expeditionsteams wohl ein außerirdisches Kuckucksei sein könnte ...
... and the ugly war
"Camouflage" hat ein paar Anklänge an Haldemans berühmtestes Werk, "Der Ewige Krieg". So wird insbesondere der Zweite Weltkrieg zu einer einschneidenden Erfahrung für den Wechselbalg, der die japanischen Gräuel auf den Philippinen am eigenen Leib erfahren muss (während sich zeitgleich das Chamäleon in Mengeles Gefolge vergnügt). Die brutalen Passagen wirken noch kälter, weil sie - ganz dem Denken der Aliens entsprechend - mit einer Art interessierter Distanz erzählt werden. Es ist dieselbe Haltung, die in lebensfreundlicheren Momenten als lockerer, leicht amüsierter Ton rüberkommt. Dahinter steckt Haldemans als solche gerühmte economy of words ("Er lächelte psychiatrisch.").
Und wie im "Ewigen Krieg" lockert Haldeman auch hier Gender-Grenzen auf. Sex mit Männern oder Frauen ist für ein im Prinzip geschlechtsloses Wesen ein- und dasselbe, und Übung bekommt es in beidem. Was sich im Englischen natürlich anders vermittelt als im Deutschen, wo der Wechselbalg grammatikalisch auf eine gar nicht vorhandene geschlechtliche Identität festgenagelt wird. Kein Wunder, dass "Camouflage" neben dem Nebula auch den James Tiptree, Jr. Award gewonnen hat, einen Preis für Genrewerke, die sich mit Gender-Identitäten auseinandersetzen.
Abstriche vom Optimalen
Wir betreten nun das letzte Drittel der Rezension, an dieser Stelle folgen traditionell die unvermeidlichen Mängelrügen. Die deutsche Fassung von "Camouflage" enthält ein paar Vertippser zuviel, um es gänzlich unerwähnt zu lassen. Zudem hat man das eine oder andere Mal dieses spezielle Gefühl, wenn das Lesen dem Gehen über leicht nachgiebigen Boden ähnelt: Irgendetwas stimmt nicht ganz - könnte im Original schon so sein, vielleicht steckt aber auch eine zwar nicht falsche, aber ungenaue Übersetzung dahinter.
Als Indiz für Letzteres werte ich, wenn sich so ein Fall rekonstruieren lässt. So kann ein Admiral in Uniform im Englischen durchaus seinen hat ablegen - das darf dann aber im Deutschen, wo die Wortabgrenzungen leicht anders verlaufen, nur eine Mütze sein und kein Hut. Außer wir springen in historische Zeiten zurück. Und die Zahl 43 wird eher nicht als vierunddreißig ausgesprochen.
Haldeman selbst lässt aber auch ein paar Wünsche offen. Nachdem den ganzen Roman über ein recht lockerer Umgang mit dem Thema Sex vorherrschte, nimmt die Romanze zwischen dem Wechselbalg und seinem menschlichen Partner ein wenig gar flott derart verbindliche Züge an, wie man es sonst nur aus dem 19. Jahrhundert oder Hollywoodfilmen kennt. Und das ist nur ein Aspekt des Umstands, dass gegen Ende des Romans hin alles etwas überhastet abläuft. - Aber vielleicht habe ja sogar ich, der ich ständig über endlos ausgewalzte Romane jammere, mich inzwischen an das heutige Alles-muss-gesagt-werden-Schneckentempo gewöhnt. Ein erschreckender Gedanke! "Camouflage" jedenfalls erinnert wie schon "Herr der Zeit" an SF-Romane, wie sie früher einmal waren. Alles in allem also doch sehr guter Lesestoff.
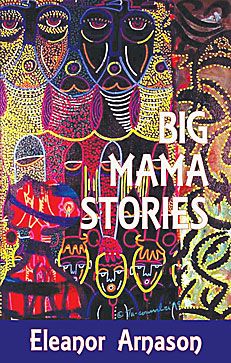
Eleanor Arnason: "Big Mama Stories"
Broschiert, 164 Seiten, Aqueduct Press 2013
Endlich gibt es die beliebten "Big Mama Stories", die Eleanor Arnason in den vergangenen zehn Jahren geschrieben hat, auch in gesammelter Form! Arnason ist eine mittlerweile 70-jährige, mehrfach preisgekrönte US-amerikanische Autorin isländischer Abstammung, an der ich vor allem ihren Sinn für trockenen Humor schätze. (Ein schönes Beispiel war die SF-Novelle "Tomb of the Fathers".) Schade, dass der deutschsprachige Markt sie bislang nicht für sich entdecken wollte.
Wer sind nun diese Big Mamas, die mit der Hand in ein Schwarzes Loch greifen und es umstülpen oder nonchalant über die Milchstraße spazieren und dabei nur achtgeben müssen, dass kein unterlichtschnelles Raumschiff sie in den Knöchel pikst? Oder die gar echte Galaxien als Ohrschmuck tragen? Auf nähere Erläuterungen verzichtet Arnason, doch offenbar handelt es sich bei den Big Mamas - Big Poppas gibt's auch - um keine eigene Spezies von Superwesen, sondern um Menschen auf einer höheren Entwicklungsstufe. Unklar bleibt, ob dies eine Errungenschaft der Zukunft ist, oder ob die BMs und BPs - zusammen mit ihren Äquivalenten bei anderen Spezies - schon immer etwas Besonderes waren. Spielt letztlich auch keine Rolle, denn die Zeit bereisen sie ebenso freizügig wie den Raum.
Alles auf streng wissenschaftlicher Basis
Wenn einem mitteleuropäischen SF-Leser diese Geschichten zunächst allesamt ein wenig seltsam vorkommen mögen, dann liegt das daran, dass es sich explizit um sogenannte Tall Tales handelt: Eine vor allem in den USA beheimatete Erzähltradition, in der vollkommen unglaubwürdige Begebenheiten so geschildert werden, als wären es nüchterne Faktenwiedergaben. Und nicht genug damit, dass Arnason haarsträubende Unmöglichkeiten beschreibt, sie stößt einen auch noch mit der Nase auf die missachteten wissenschaftlichen Grundlagen. Etwa wenn sich eine Big Mama vom Megaformat auf interaktionstaugliche Menschengröße zurechtschrumpelt ... und Arnason extra auf Massen- und Energieerhaltungssatz hinweist. Schön auch, wie ein Chor aus Big Mamas und Big Poppas "One hundred theoretical particles on the wall!" schmettert und eine dazugehörige Fußnote auf die Teilcheneigenschaft der stickiness hinweist.
Ernst gemeint ist also nur die Botschaft (mehr dazu später), nicht aber das Setting. Und Arnason versteht es, mit ihrem oh so schlichten Witz eine prekäre Balance zu halten. Manche Sätze wirken geradezu kindlich - etwa wenn man bekümmert auf die Überreste einer Alien-Zivilisation blickt, die sich in Bio-Kriegen selbst ausgelöscht hat, und resümiert: One cannot train a microbe to be patriotic. Aber wer fälschlicherweise annimmt, Arnasons Schreibe wäre einfach nur naiv, soll sich mal diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen: Like many intelligent species, the skwork had fought wars; and as they became more civilized (...), the wars became more horrific.
R-E-S-P-E-C-T
Das Generalthema der Geschichten lautet: Respekt. Nicht nur, aber vor allem gegenüber Frauen. Sowohl in "Big Black Mama And Tentacle Man" als auch in "Big Red Mama In Time And Morris, Minnesota" kommt es zur Begegnung zwischen einer BM und einem eher unausstehlichen Mannsbild - keine Frage, wer den Kürzeren ziehen wird. In "Big Ugly Mama And The Zk" schockt die imposante Erscheinung der Titelheldin einen armen insektoiden Außerirdischen derart, dass er gleich zwei Metamorphosenstadien zurück in die Pubertät fällt (na, wenn das mal nicht symbolisch ist ...). Der Zk ist allerdings ein Netter und wird daher von BUM wieder aufgepäppelt. Die übrigens von der primeval ugliness eines Schlammplaneten ist - was der allgemeinen Perfektion der Big Mamas zu widersprechen scheint. Aber in diesem Fall nur bedeutet, dass BUM das verkörperte Potenzial ist und ihr Idealzustand immer in der Zukunft liegt. Sehr schöner Gedankengang.
Überhaupt Schönheit: Big Black Mama ist zwar so umwerfend, dass das ganze Universum keucht. Doch lässt es sich Arnason nicht nehmen, mehrfach anzumerken: The best part of her was her brain. Eitelkeit hingegen hat Folgen: Als sich in "Big Green Mama Falls In Love" BGM im Spiegel eines Weltraumteleskops erblickt, wird sie derart von Lust gepackt, dass sie auf einem Planeten niedergeht und sich zweiteilt. Und immer so weiter, bis das Ganze komplett aus den Fugen gerät: "This is becoming positively Malthusian." So ganz nebenbei werden in der Geschichte auch noch biologische Diskussionen mit dem Big Virus und der Big Microbe geführt - während Big Red Mama in ihrer Zeitreise-Geschichte auf zumindest eine originelle Lösung des Großvaterparadoxons stößt. Wie gesagt: Wissenschaft.
Arnasons Geschichten sind in einem Verlag erschienen, der sich auf feministische Genreliteratur spezialisiert hat. Was mich zu der interessanten Frage führte, ob ein Werk zwar feministisch, aber nicht emanzipatorisch sein kann. Immerhin handelt es sich bei den quasi-allmächtigen Big Mamas ja um hochprivilegierte Wesen. Weit und breit keine Rechte mehr, die ihnen jemand vorenthalten könnte.
Das Highlight
Ganz konnte ich diese Frage nicht klären, aber die längste und für mich beste Story der Sammlung unterstreicht Arnasons humanistischen Ansatz. In "Big Brown Mama And Brer Rabbit" bleibt BBM lange Zeit auf die Rolle einer Zuhörerin beschränkt. Im Vordergrund steht eine hierzulande kaum bekannte Figur der US-amerikanischen Folklore: Eben Brer Rabbit, ein gewitzter Hase, der sich durchs Leben trickst und manchmal auch auf die Schnauze fällt. Hier wird er in die Gestalt eines Menschen gezwungen und kann sich nicht mehr daraus befreien.
In dieser Geschichte kommt vieles zusammen: Arnason greift nicht nur afrikanische und indianische Mythologien auf, Brer Rabbits Lebensweg ist auch das Mittel, eine kurze Geschichte des 20. Jahrhunderts zu schildern: Von Depression, Fordismus, Gewerkschaften und Bürgerrechtsbewegung ... und von Jazz. Und später dann vom Niedergang der Solidargesellschaft und ökologischen Problemen, Arnason macht aus ihrer politischen Haltung keinen Hehl. "Big Brown Mama And Brer Rabbit" wirft letztlich die alte Frage auf, was den Menschen ausmacht und welche Rolle er im Gesamtgefüge spielen will. Oder darf, wenn man ihn lässt. Also doch emanzipatorisch.
Lese-Tipp
Und noch eine Frage wird in "Big Brown Mama And Brer Rabbit" gestellt: Nämlich ob es in der heutigen Zeit noch Platz für Archetypen und alte Erzählformen gibt. Diese fünf Geschichten, die Arnason ausdrücklich als Tall Tales fürs Weltraumzeitalter deklariert hat, geben darauf die schönste Antwort.
Für mich waren die "Big Mama Stories" ein großes Vergnügen, vermutlich wird es vielen anderen auch so ergehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn der eine oder andere darauf genauso reagiert wie der gezähmte Allosaurus in "Big Red Mama In Time And Morris, Minnesota". Nämlich mit: "What the heck?"

Oliver Henkel: "Die Zeitmaschine Karls des Großen"
Broschiert, 470 Seiten, € 17,40, Atlantis 2013 (Erstausgabe 2001)
Damen und Herren, willkommen beim großen Charlemagne-Gedenkrennen um die beste Zeitmanipulation im Karolingerreich! Die Teilnehmer könnten unterschiedlicher nicht sein.
Das Startfeld
Seit 1969 am Start: Die Kurzgeschichte "So frustrieren wir Karl den Großen" ("Thus we frustrate Charlemagne") des US-amerikanischen SF-Veteranen R. A. Lafferty, in der ein Grüppchen WissenschafterInnen den Lauf der Geschichte rückwirkend beeinflusst. Einfach nur um zu sehen, wie sich das auf die Gegenwart auswirkt. Vom Ergebnis sind sie allerdings als einzige frustriert: Zwar verändern sich die Dinge um sie herum gewaltig, doch haben sich ihre Erinnerungen an den neuen Zeitverlauf angepasst und sie bemerken nichts davon. Lafferty tobt seinen legendären Sinn für Humor einmal mehr aus - am Ende fuchteln die ehemaligen Wissenschaftsgrößen als Höhlenmenschen mit "magischen" Gegenständen herum und ärgern sich tierisch, dass schon wieder nichts passiert ist ...
1996 ins Rennen eingestiegen: Der deutsche "Chronologiekritiker" Heribert Illig mit einem Sachbuch. In "Das erfundene Mittelalter" will er wieder einmal ein paar Jahrhunderte an Geschichtsschreibung gefunden haben, die es in Wirklichkeit gar nicht gegeben habe. Betroffen diesmal das Frühmittelalter inklusive der Ära Karls des Großen - Letzterer sei reine Fiktion. Die Geschichtsforschung sichtete Illigs Methoden, Belege und Interpretationen und reagierte kurz zusammengefasst mit: LOL.
Als letzter Teilnehmer ist der deutsche Alternativwelt-Autor Oliver Henkel mit "Die Zeitmaschine Karls des Großen" dazugestoßen. Einen ersten Startversuch wagte er 2001 mit einem Book-on-Demand, heuer ist der Roman noch einmal bei einem regulären Verlag herausgekommen. Und im Haus Atlantis hat Henkel die denkbar passendste Heimat gefunden, denn dort wird derzeit schwer auf Alternative-History-Szenarien gesetzt (neben Henkels Romanen etwa die Reihe "Kaiserkrieger" oder ganz neu Heinz Zwacks Roman "Nebenwelt", der in einer der kommenden Rundschauen vorgestellt wird). Diesen Kandidaten sehen wir uns nun genauer an.
Das Szenario
Wir schreiben das Jahr 796, und in Henkels Version davon ist das Römische Reich nie untergegangen. Im Gegenteil: Es hat einen Status erreicht, von dem die Mannen in Dirk van den Booms "Kaiserkrieger"-Romanen nur träumen können. Während dort trotz aller Maßnahmen der preußischen Zeitreisenden der fette Arsch des Geschichtsablaufs nur zu geringen Seitwärtsbewegungen bereit scheint, ist bei Henkel alles anders. Rom hat der Völkerwanderung widerstanden und den Großteil der germanischen Völker integriert. Infrastruktur und Technologie sind auf einem Stand wie bei uns in der frühen Neuzeit (z.B. gibt es Buchdruck und Typeskribetoren, herrliches Wort!). Und es ist weitgehend friedlich
... zumindest solange es den bösen Nachbarn gefällt. Da wären im Osten die Perser und im Nordwesten das Frankenreich, das offiziell mit Rom befreundet ist. Aber neuerdings gehen dort merkwürdige Dinge vor. Frankenkönig Karl nennt sich plötzlich "der Große", der für Rom essentielle Religionsfriede zwischen arianischen und "lateinischen" Christen wackelt und ein neuer Begriff macht die Runde: Der Wahre Wille Gottes. (Als erfahrener Zeitreise-Leser weiß man das nüchtern zu interpretieren: Irgendjemand muss dem Karl gesteckt haben, was er in einer anderen Version der Geschichte erreicht hat, und jetzt hätte er das gerne auch hier.)
Der Plot
Also schickt der römische Leiter des für die germanischen Verbündeten zuständigen Föderatenbüros seinen jungen Mitarbeiter Andreas Sigurdius ins Frankenreich, um dort nach dem Rechten zu sehen. Und obwohl Andreas keinerlei Felderfahrung hat, ist er bei seiner Spionagemission durchaus erfolgreich. Erst recht, nachdem sich ihm ein geheimniskrämerischer Mann aus Britannien als Zeitreisender enthüllt hat - der seinerseits kaum fassen kann, was aus der Historie, wie er sie kennt, geworden ist. In der Folge jagt Andreas mit Aethelred (bzw. Captain Franklin Vincent) gemeinsam einem zweiten Zeitreisenden hinterher, der irgendwie am Hofe Karls gelandet sein muss und diesem Welteroberungsflausen in den Kopf gesetzt hat.
Bemerkung am Rande: So richtig durchdacht hat Andreas offenbar nicht, welche Konsequenzen sich daraus ergeben könnten, wenn er seinen Begleiter aus der Zukunft beim Geschichtsverlaufkorrigieren unterstützt. Wirkt auf mich unlogisch, immerhin ist Andreas selbst mit Alternativweltgeschichten vertraut. Die sind ja offenbar schon im 8. Jahrhundert beliebt, wie wir einer kurzen Begegnung mit einem zeitgenössischen Autor dieses Genres entnehmen dürfen.
Zu dieser individuellen Queste gesellt sich als zweiter Handlungsstrang ein Krieg am Ostrand des Imperiums, wo die Perser einmarschieren. Diese Handlungsebene erinnert in der Tat stark an "Kaiserkrieger": Aufgeteilt auf viele kurze Kapitel mit unterschiedlichen Hauptpersonen erhalten wir eine Art Gesamtüberblick über die dortigen Vorgänge. Hier dreht sich alles um Strategien, Logistik und Kämpfe - kurz: Military SF in einem Alternativweltszenario.
Da ginge noch mehr ... oder besser gesagt: weniger
Wenn ich jetzt auf meinen Stichwortzettel schaue, sehe ich, dass die Liste mit den Kritikpunkten recht lang ist. Das verzerrt etwas den Eindruck, weshalb ich vorausschicken möchte: Ich fand "Die Zeitmaschine Karls des Großen" insgesamt sehr kurzweilig und habe den Riesenwälzer mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen. Soviel zur Gesamteinschätzung, jetzt zum Bekritteln:
Das Grundproblem des Romans dürfte sein, dass er einfach zu lang ist; schätzomativ um ein Drittel. Das ist nämlich nicht nur eine reine Zeitfrage, das Volumen hat Henkel auch dazu verführt, eher mehr als weniger in den Roman hineinzustopfen. Und nicht alles passt zusammen. Henkel hat einige nette Gags platziert - etwa wenn er die niedergeschlagene Revolte eines religiösen Sektierers namens Mahometus erwähnt und damit kurzerhand den Islam aus der Weltgeschichte streicht. Oder wenn er Passagen um einen Mönch zum Sherlock-Holmes-Pastiche macht. Aber mussten auch noch Monty Python vorkommen?
Schwerer wiegt die Sache mit den inkompatiblen Elementen, wenn sich der Roman nicht so recht entscheiden kann, welchem Genre er angehören will. Von der Zeitmaschine bis zum Rasierapparat schreit alles: Science Fiction. Dem steht aber das Auftreten von Magie gegenüber: Seherische Fähigkeiten sind in dieser Welt selten, aber real. Andreas begegnet sogar einer Art Galadriel im Wald (namens Gisela), die ihm Visionen der Zukunft zeigt. Und ihm so nebenbei das alte Fantasy-Motiv vom Auserwählten, der das Schicksal der ganzen Welt entscheiden wird, reindrückt.
Außerdem bemüht Henkel, einmal mehr, zu oft den Zufall (was eine unbedachte Handbewegung vor der Schlacht so auslösen kann ...), das ist schon beinahe eine Trademark des Autors. Dass zudem die Zeitmaschine irgendwie auch als Raummaschine zu funktionieren scheint, sei auch noch anzumerken. Praktisch immerhin für ihre Benutzer.
Resümee
Trotz diverser Logikmängel bleibt "Die Zeitmaschine Karls des Großen" spannende Unterhaltung - im Rückblick ein beachtliches Debütwerk. Und an erzählerischer Eleganz hat Henkel zwischen damals und seinem 2012 erschienenen "Die Fahrt des Leviathan" eindeutig zugelegt. Meine einzige wirkliche Enttäuschung über den Roman ist kein Kritikpunkt, sondern ausschließlich eine Frage persönlichen Geschmacks: Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich Henkel unter mehreren Schlussvarianten entscheiden musste ... und die falsche Wahl getroffen hat.
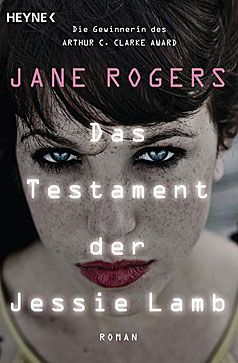
Jane Rogers: "Das Testament der Jessie Lamb"
Broschiert, 382 Seiten, € 15,50, Heyne 2013 (Original: "The Testament of Jessie Lamb", 2011)
"Der Beweis, dass ich, Jessie Lamb, bei gesundem Verstand und in bester Gesundheit, die volle Verantwortung für meine Entscheidung übernehme und beabsichtige, die Konsequenzen zu tragen": So will die Protagonistin in Jane Rogers' jüngstem Roman ihre tagebuchartigen Aufzeichnungen verstanden wissen. Schritt für Schritt legt sie darin dar, wie sie zu einem unumstößlichen Beschluss gekommen ist: Dokument eines Reifungsprozesses, den die Umstände zu einer Beschleunigung gezwungen haben, die weit jenseits herkömmlicher Teenagererfahrungen liegt.
Tödliche Mutterschaft
Ursache ist das Muttertod-Syndrom (MTS), eine Epidemie, die die gesamte Weltbevölkerung erfasst hat; vermutlich auf den Einsatz einer Biowaffe zurückgehend. MTS bewirkt, dass jede Schwangerschaft zum Tod der Mutter führt. Binnen kurzer Zeit werden keine Kinder mehr geboren und die Menschheit sieht sich mit dem Gedanken konfrontiert, dass es keine Zukunft geben wird. Natürlich wird fieberhaft an einer Lösung geforscht und tatsächlich zeichnet sich bald ab, dass es eine Möglichkeit geben könnte, nicht-infizierte Kinder zu gebären.
... was das Problem für die Mütter jedoch nicht löst. Schlafende Schöne nannte man ursprünglich in zynischer Glorifizierung die letzten Frauen, die auf natürliche Weise schwanger geworden waren und solange ins Koma versetzt werden mussten, bis ihre Kinder auf die Welt geholt werden konnten. Später taucht der Begriff unter den neugeschaffenen Umständen wieder auf.
Zwischen Mainstream und Genre
Die britische Autorin Jane Rogers hat bislang Realwelt-Romane geschrieben, in die das Fremdartige nur auf sehr subtile Weise einsickerte ("Promised Lands", "Island"). Mit "Das Testament der Jessie Lamb" ist sie nun vom Mainstream explizit ins Genre gewechselt. Prompt ist der beeindruckend geschriebene Roman zwar für den Man Booker Prize nominiert worden, hat aber den Arthur C. Clarke Award gewonnen ...
"Testament" wurde mehrfach mit Margaret Atwoods "Der Report der Magd" verglichen. Und tatsächlich schildert Rogers' Roman den möglichen Beginn eines dystopischen Szenarios, in dem Frauen in die Rolle von Gebärmaschinen gedrängt werden. Auch wenn Rogers Frauen nicht auf die bloße Opferrolle beschränkt und ihnen ihre letztliche Entscheidungsfreiheit belässt (noch zumindest). Vom Tonfall her liegt auch Kazuo Ishiguros "Alles, was wir geben mussten" nicht weit. Am meisten hat mich "Das Testament der Jessie Lamb" allerdings an ein Werk erinnert, das mit Genre nun wieder gar nichts zu tun hat: Nämlich den auf einem Bühnenstück basierenden 1986er Film "Nacht, Mutter", in dem Sissy Spacek ihrer Filmmutter Anne Bancroft nüchtern ihren bevorstehenden Selbstmord ankündigt.
Weg in die Freiheit
Der Unglauben, die Wut und die Verzweiflung, auf die die Protagonistin von "Nacht, Mutter" stößt - mit all dem wird auch Jessie konfrontiert. In ihrem Fall wird der Vater zum "Widersacher", der sie zu ihrem vermeintlich Besten als Gefangene hält, um sie von ihrem Beschluss abzubringen. Dass sich Jessie buchstäblich angekettet wiederfindet, ist eine bittere Ironie - hatte sie zu ihrem Vater doch stets so ein gutes Verhältnis, dass sich ihre Mutter ausgeschlossen fühlte.
Das Gefangensein ist das Hauptmotiv des Romans und taucht in verschiedenster Form auf: Seien es die schlafenden Schönen und deren Nachfolgerinnen im Leihmutter-Programm, sei es Jessie in Ketten oder die Mutter eines Freundes, die von ihrem Mann in der Wohnung eingesperrt wird, weil er in eine Sinnkrise gerät. Einmal macht sich Jessie sogar selbst zur Gefangenen und exiliert sich für kurze Zeit auf einem Bauernhof - bis sie erkennt, wie sinn- und ausweglos ein die Welt ignorierendes Aussteigerleben letztlich wäre. Jessie ging es stets um die Freiheit zu handeln und etwas zu bewirken - was zugleich der Kernpunkt des ganzen Romans ist.
Als Zukunft verkleidete Vergangenheit
Allerdings greift es meiner Meinung nach zu kurz, wenn man Rogers' Roman auf eine "Frauenthematik" reduziert. Er schildert eine Gesellschaft, die als Ganzes im Umbruch ist. Die zu Beginn 16-jährige Jessie und ihre FreundInnen erleben, wie bisherige Wertvorstellungen der neuen Wirklichkeit nicht mehr entsprechen. "Dumme Erwachsene; ihre Tage waren gezählt", heißt es einmal. Dieses aus teilweise sehr persönlichen Beobachtungen gezogene Resümee mag noch kindlich klingen, doch von der individuellen Ebene ist es nur ein kleiner Schritt bis zur politischen.
Rogers schildert einen Konflikt der Generationen, der an die 60er Jahre erinnert - oder mehr noch an die 70er, als der Optimismus der Flower-Power-Tage bereits dahin war. Rasch zeichnet sich ab, dass Jessie und ihre Altersgenossen nicht die anfangs angestrebte einheitliche Bewegung bilden werden. Sie werden je nach persönlichem Interesse Ökos, Feministinnen, Tierrechtler, globalisierungskritische Aktionisten oder einfach nur Aussteiger - oder driften in Religionen ab. Die vor kurzem 61 gewordene Rogers, die Aufstieg und Zerfall einer Gegenkultur selbst miterlebt hat, liefert damit gleichsam ein Zeitdokument ihrer eigenen Vergangenheit nach.
Gesamtbewertung: "Das Testament der Jessie Lamb" ist ein wunderbar organisch erzählter und in jeder Beziehung packender Science-Fiction-Roman. Ganz ohne Spezialeffekte.
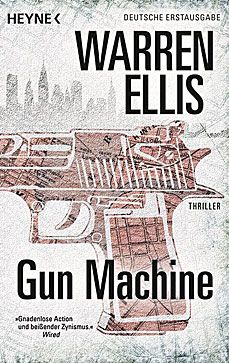
Warren Ellis: "Gun Machine"
Broschiert, 384 Seiten, € 9,30, Heyne 2013 (Original: "Gun Machine ", 2013)
Weil ich mit Warren Ellis schon einmal ziemlich viel Spaß hatte ("Gott schütze Amerika"), habe ich mich auch auf diesen Roman sofort gestürzt. Selbst wenn Ellis Phantastik-Plots bislang eher in seiner Hauptarbeit als Comic-Autor für diverse Serien ("Stormwatch", "The Authority" und viele andere, vorzugsweise mit Superhelden) ausgelebt hat. Bei seinen Romanen setzt er hingegen auf Thriller mit surrealen Randerscheinungen. Zwei Stück gibt es erst, "Gun Machine" schon eingerechnet - ein dritter, den angeblich Ellis' Computer gefressen hat, zählt nicht.
Die Handlung
"Gun Machine" greift einen geradezu klassischen Plot auf, nämlich den vom Cop in mittleren Jahren, der sich nur noch desinteressiert durch die dienstliche Routine driften lässt. Bis er dann doch auf einen Fall stößt, in den er sich verbeißt und letztendlich wirklich alles dranhängt, um ihn zu lösen. Im konkreten Fall heißt er John Tallow, ist Detective beim NYPD, schwer desillusioniert und hart an der Grenze zum Messie. Zum Wachrütteln braucht es daher schon, dass seinem Partner bei einem Einsatz der halbe Kopf weggeschossen wird.
... und damit geht es erst so richtig los: Die Schießerei in einem Mietshaus hat ein Loch in eine Wand gerissen, und die Wohnung dahinter entpuppt sich als schauriges Waffenmuseum. Und schlimmer noch: Es erweist sich, dass mit jeder der unzähligen darin gefundenen Waffen ein Mord begangen wurde - immer nur einer, und das teilweise Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückreichend. Als Tallow auf den unbequemen Fall erst einmal angefixt ist, gerät er rasch - auch das ein vertrautes Muster - ins Visier seiner Vorgesetzten, einiger selbsternannter Spitzen der Gesellschaft und schließlich auch des Killers selbst.
Geheime Karten
"Die echten Karten der Metropolen der Welt sind unsichtbar", wird Tallow von einem selbstverliebten Wallstreet-Guru erklärt, der sich damit auf das unterirdisch verlegte Netzwerk zur Datenübertragung bezieht. Tatsächlich sind Karten aber ein Schlüsselmotiv des Romans. Eine ganz eigene hat der Killer im Kopf, der nur als der Jäger bezeichnet wird. Für die Bürokratie wäre er wohl nur ein obdachloser Stadtstreicher, der im Freien schläft und sich ausschließlich von dem ernährt, was in den Stadtparks wächst oder ihm über den Weg hoppelt.
Doch im Kopf des Jägers sieht dies ganz anders aus: Für ihn überlagern sich zwei Realitäten, die des verhassten modernen Manhattan und die der Insel Mannahatta, einer nur dünn besiedelten Naturlandschaft aus der Zeit, bevor die europäischen SiedlerInnen kamen. Diese doppelte Sicht trübt nicht nur ihm buchstäblich den Blick, sie verleiht dem Roman auch eine surreale Extranote. Der Jäger ist auf einer Mission und sowohl seine Morde als auch die dafür verwendeten Waffen ergeben ein weiteres geheimes Muster an Bezügen. Tallows Aufgabe wird es sein, dieses rechtzeitig zu entschlüsseln.
Bizarre Bilder und braver Bürger
Neben dem Jäger, der als eine Art Mischung aus Stadtindianer und mörderischem MacGyver daherkommt, sorgen weitere Elemente für einen surrealen Touch. Etwa die makabre Subkultur der Forensiker, der niemals endende, geradezu hypnotische Strom an Meldungen über Gewalttaten aus dem Polizeifunk oder eine Passage, die die bizarren Folgeerscheinungen einer Unfall-Kettenreaktion schildert. Letztere belegt zudem gemeinsam mit Erinnerungen an einen Beinahe-Unfall in Tallows Vergangenheit oder der Schilderung des Massakers an einer Ganovenbande, wie sehr Comic-Autor Warren Ellis in Bildsequenzen denkt.
Professionelle Gewalt, schwarzer Humor und ein rauer Umgangston ("Du bist wie das Zeug, das aus meinem Arsch fällt, wenn ich italienisch essen war!") machen "Gun Machine" insgesamt zu einem sehr unterhaltsamen Hardboiled-Thriller. Mit Blick auf die Moral zwischen den Zeilen kann ich mir aber erneut nicht verkneifen anzumerken, was mir schon bei "Gott schütze Amerika" aufgefallen ist: Das ganze bizarre Gedöns an der Oberfläche kann letztlich nicht ganz überdecken, dass Ellis im Kern viel braver ist, als man es erwarten würde.
Arkadi & Boris Strugatzki: "Kapitän Bykow"
Broschiert, 380 Seiten, € 17,40, Golkonda 2013 (Original: "Путь на Амальтею", "Стажеры", 1960-62)
"Der Kosmos ist schließlich für die Arbeit da und nicht zum Vergnügen", heißt es in "Praktikanten", einer der beiden hier versammelten Erzählungen. Und auch wenn dahingestellt sei, wie ernst oder ironisch das an dieser Stelle gemeint ist, macht es sich als Motto gar nicht schlecht. Nur zu gern buttern SF-AutorInnen allen verfügbaren Sense of Wonder hinein, wenn sie die Wunder des Weltraums beschreiben. Nur selten aber endet dies so prosaisch wie die Eröffnungspassagen von "Der Weg zur Amalthea". Nach zweiseitigem kosmischen Schwelgen heißt es plötzlich: Leider kann man sich den Aufgang des Planeten nur selten bis zur letzten Phase anschauen. Der Jupiter lässt sich dabei zu viel Zeit, und man muss arbeiten gehen.
Schon im Hauptwerk der russischen SF-Starautoren Arkadi & Boris Strugatzki, dem Romanzyklus um die "Welt des Mittags" im 22. Jahrhundert, ist mir immer wieder positiv aufgefallen, wie glaubhaft dort Arbeitswelten beschrieben werden. Was bei anderen AutorInnen oft kulissenhaft wirkt und ein reines Plot-Vehikel ist, um dann zum eigentlichen Romanthema zu kommen (selbstverständlich etwas viel Spektakuläreres, das jenseits des Jobs liegt), kommt hier als das rüber, was es ist: Ein System von Abläufen, die einen wesentlichen Teil des Tages mit Beschlag belegen und bitteschön auch möglichst gut erledigt sein wollen. Fantastische Entdeckungen und Heldentaten ergeben sich höchstens nebenbei.
Der Kontext
Die beiden in "Kapitän Bykow" versammelten Erzählungen, eine Novelle und ein Roman, sind Mittel- und Abschlussteil einer Trilogie, die 1959 mit "Atomvulkan Golkonda" begonnen hatte - also dem Namensgeber des Verlags, der diese Frühwerke zusätzlich zur großen Strugatzki-Gesamtausgabe in neubearbeiteter Übersetzung noch einmal aufgelegt hat. Offiziell gehören sie nicht zur "Welt des Mittags", auch wenn sie in manchen Aufzählungen als Prequels geführt werden. Zeitlich sind sie ein gutes Jahrhundert davor angesiedelt, in einer Ära der Weltraum-Pioniere.
Doch diese Ära, verkörpert in Person der Hauptfigur Alexej Bykow, Kapitän des Raumfrachters "Tachmansib", geht langsam zu Ende. In der Novelle "Der Weg zur Amalthea" steht Bykow noch so wie zuvor in "Atomvulkan Golkonda" im Mittelpunkt. Im Episodenroman "Praktikanten" hingegen tritt er in den Hintergrund zurück, andere rücken nach. Der junge Vakuumschweißer Juri Borodin, der auf der "Tachmansib" anheuert, nachdem er seine Passage zum Saturnmond Rhea verpasst hat, steht gleichsam stellvertretend für den Generationswechsel. Bykows alte Crew zerbröselt indessen: Einer durfte auf der vielleicht letzten Mission gar nicht mehr mitfliegen, weil er zu alt ist. Ein anderer nimmt inzwischen eine hohe Funktion in der Weltraum-Verwaltung ein und möchte sich bloß noch in ein letztes Abenteuer stürzen. Und ein dritter wird am Ende zur Einsicht gelangen, dass der Weltraum nichts mehr für ihn ist. Ganz so wie die Strugatzkis selbst, die danach das Kapitel Space Opera zuschlugen.
Zur Handlung
"Amalthea" dreht sich darum, dass die "Tachmansib" zu einer Station geschickt wird, auf der eine Hungersnot droht, dann aber in einen Meteoritenschauer gerät und auf den Jupiter zustürzt. Klingt spektakulärer, als die bewusst antiheroisch gehaltene Geschichte ist. Hätte sie nicht Novellenlänge, hätte sie genausogut als weitere Episode in das in jeder Beziehung viel interessantere "Praktikanten" eingebaut werden können.
In Letzterem klappern Bykow & Co diverse Etappenziele auf ihrem Rundflug durchs Sonnensystem ab. Es wird gegen fliegende Riesen-Egel auf dem Mars gekämpft, eine unerwartete Entdeckung in den Saturnringen gemacht und - in der Erstausgabe des Romans nicht enthalten - noch einmal beim Atomvulkan auf der Venus vorbeigeschaut. Vor allem aber tauchen wir in die diversen Arbeitswelten der Menschen, die da draußen im Sonnensystem am Schaffen sind, ein. Zwischen denen es bezeichnende Unterschiede gibt, dazu gleich mehr.
Produkt seiner Zeit
Dass die Erzählungen inzwischen ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben, merkt man natürlich an allen Ecken und Enden. Nicht nur an den optimistischen Fehlannahmen über Leben auf dem Mars und andere astronomische Fakten, sondern auch an herrlich veraltet wirkenden Ausdrücken wie Radiofon, Stratoplan oder ... Atom-PKW. (Und ich möchte auch mal ein Ionenbrausebad nehmen! Oder vielleicht auch nicht.) Vermutlich bräuchten junge LeserInnen langsam auch ein Glossar für real existiert habende Begriffe wie Sowchose und Dispatcher.
Dass die Bykow-Erzählungen Zeitdokumente sind, merkt man vor allem aber daran, dass der Kampf der Ideologien hier noch ein ganz großes Thema ist. Zwar hat der Kommunismus gegenüber dem Kapitalismus eindeutig die Nase vorn, aber in Teilen der Welt und des Sonnensystems recken Gewinnstreben und Geldwirtschaft immer noch ihr hässliches Haupt.
"Wozu ist einer nutze, wenn er seine Arbeit lustlos verrichtet?"
Zwei direkt aufeinander folgende Episoden illustrieren die ideologisch geprägte Darstellung besonders deutlich: Im Weltraum-Observatorium Eunomia forschen prächtige Vertreter der neuen post-kapitalistischen Gesellschaft mit derartigem Enthusiasmus vor sich hin, dass einem nur so der Kopf schwirrt. Überhaupt sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, was für ein Vergnügen einem der quirlige Stil der Strugatzkis beim Lesen bereitet!
Demgegenüber dreht sich auf dem Minen-Asteroiden Bamberga alles um persönlichen Gewinn - dementsprechend präsentieren sich die hier Lebenden als aggressiv, neurotisch und ausgebrannt. Zumindest bis Generalinspektor Wladimir Jurkowski dreinschlägt. Wenn der das Bamberga-System zum Wohle der Beteiligten umkrempelt, bekommt man eine ungefähre Ahnung davon, wie die Tea Party die Obama-Administration wahrnehmen muss.
Kapitalismus ist von gestern
Während die Strugatzkis später immer wieder Scherereien mit der Sowjet-Zensur bekamen, hatten sie sich in den Bykow-Geschichten noch nicht wirklich von den ideologischen Vorgaben gelöst. Übersetzer Erik Simon findet dazu im Nachwort eine bezaubernd freundliche Formulierung: (...) sie haben manche Klassenkampf-Klischees, die im Bewusstsein aller ihrer sowjetischen Zeitgenossen fest verankert waren, nicht vermeiden können, nicht zuletzt aus Mangel an eigener Anschauung. Was genau genommen aber auch nichts Besonderes ist: Kleine gönnerhafte Sticheleien gegen Anhänger der "anderen Seite" finden ihre exakte Entsprechung in dem, was sich Chekov auf der "Enterprise" immer wieder mal anhören musste ...
Aber Achtung vor Selbstgefälligkeit beim Blick durch die Historiker-Brille - die Strugatzkis geben einem genug zum Drübernachdenken mit auf den Weg. Auf Arbeit wird in "Praktikanten" nicht nur herumgeblödelt oder an Problemlösungen getüftelt, sondern auch sehr, sehr viel philosophiert. Schließen wir mit einem schönen Zitat aus dem Dialog eines unternehmerisch veranlagten westlichen Barkeepers mit einem Mitglied von Bykows Crew: "Und ich will ebenfalls kein Diener sein, sondern Herr." - "Ein bisschen was haben Sie schon begriffen, Joyce", erwiderte Iwan nachdenklich. "Sie wollen kein Diener sein. Nun müssen Sie bloß noch eine Kleinigkeit schaffen - nämlich den Wunsch besiegen, Herr zu werden."

Mike Mignola & Christopher Golden: "Joe Golem und die versunkene Stadt"
Gebundene Ausgabe, 300 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2013 (Original: "Joe Golem and the Drowning City ", 2012)
1975 in New York, da sollten Jungbands wie die Ramones und Blondie im CBGB's auftreten und die Rocky Horror Show würde am Broadway anlaufen - aber nicht in dieser Welt, denn da steht all das seit Jahrzehnten unter Wasser.
... so ungefähr hatte ich mir das als Einleitung gedacht. Ein wenig die Romanwelt von "Joe Golem und die versunkene Stadt" mit der unseren vergleichen, zwecks Atmosphäre. Aber Pustekuchen. Auf der Buchrückseite steht zwar: "Im Jahr 1925 bewirkten Erdbeben und der ansteigende Meeresspiegel, dass die unteren Stadtteile von Manhattan zehn Meter unter Wasser lagen. (...) Seither sind fünfzig Jahre vergangen." Doch wurde eine der Romanfiguren in der Zeit der Flut geboren und ist jetzt 82, wie wir später erfahren. Eigenartig, dass das niemandem aufgefallen ist - und wenn mich die Indizien nicht trügen, war das schon bei der Originalausgabe so. Vielleicht ein erstes Indiz dafür, dass der Roman von Comic-Autor und "Hellboy"-Schöpfer Mike Mignola und seinem Kompagnon Christopher Golden nicht unbedingt zum Mitdenken gedacht ist.
Wir befinden uns aber ohnehin im Irgendwann, einer Art Kunstzeit. Ermöglicht wird dies dadurch, dass die überfluteten Stadtteile - nicht nur Lower Manhattan - keine Verbindung nach draußen haben. Von der Außenwelt, und die beginnt schon in Uptown, erfahren wir nichts. Technologietransfer findet offenbar auch keiner statt. Das schafft ein Ambiente, in dem sich Low-Tech und diverse Magie zu einer Art Steampunk-Setting ergänzen.
Die Hauptpersonen
Hier lebt Molly McHugh und macht mit ihren 14 Jahren "Joe Golem" zu einem Young-Adult-Roman. Einst aus prekären Familienverhältnissen davongelaufen, hat sie jede Menge Erfahrungen auf der Straße intus und lebt mittlerweile als Assistentin des Spiritisten Felix Orlov. Der war mal ein gefeierter Bühnenmagier, hält sich nun aber nur noch mit ein paar letzten PrivatkundInnen über Wasser. Buchstäblich. Bis eine seiner Séancen katastrophal schiefläuft, maskierte Männer Orlovs Wohnung stürmen, ihn entführen und den Rest der Anwesenden ermorden - bis auf Molly.
Und von da an ist man eigentlich durchgehend am Rennen, um Felix zu retten und schließlich auch einen drohenden Kataklysmus zu verhindern. Unterstützung erhält Molly von Joe Golem, einem melancholischen Kraftlackel, schrundig wie Stein (...). Joe leidet unter Gedächtnisverlust, träumt aber davon, einst Hexen gejagt und getötet zu haben. Und zu diesem Zeitpunkt haben uns die Autoren bereits wissen lassen, dass Träume durchaus auch Erinnerungen sein könnten.
Lesen ist gleich Schauen
Mignola steuerte eine große Menge kleinformatiger Schwarz-Weiß-Innenillustrationen im typisch holzschnittartigen Stil bei. Auch ansonsten ist der Roman wie schon zuvor der von Warren Ellis ganz auf Bildhaftigkeit zugeschnitten. Beim überfluteten Setting musste ich die ganze Zeit an Brian Azzarellos "Spaceman" denken - vermutlich kein Zufall, dass ich eine Comic-Assoziation hatte. Und auch bei den übrigen Handlungselementen ahnt man meistens, aus welchem Pool von Bildern, die sich ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben, Golden und Mignola schöpften. Siehe etwa Mollys Gegenspieler, die sich mit Gasmasken und langen Mänteln präsentieren und gelbes Gas als Waffe einsetzen.
Déjà Voodoo
Das Folgende ist nicht als Aussage über den Schreibstil zu werten: "Joe Golem" erinnert mich irgendwie an Fan-Fiction, die in Druck ging und deshalb aus Copyright-Gründen die Namen der ProtagonistInnen ändern musste. Waaahnsinnig weit hat sich Mignola von seiner populärsten Schöpfung nämlich nicht entfernt. Hier gibt eben statt Hellboy Joe den stoischen Helden mit Betonfaust und schwerem Schicksal - was Letzteres betrifft, verbinden sich Joe und Felix Orlov dann gemeinsam zur Hellboy-Entsprechung.
Joes Mentor, der undefinierbar alte Mr. Church, entspricht Trevor Bruttenholm, der Anführer der Gasmaskenträger wiederum sieht aus wie dem Monster-Nazi Karl Ruprecht Kroenen der Filmversion aus der Fratze geschnitten. Churchs Gegenspieler Dr. Cocteau übernimmt die Rolle Rasputins beim Heraufbeschwören alter Gottheiten, und die entsprechen ganz den Ogdru Jahad aus dem Hellboy-Universum. In Ergänzung dazu sind Church und Cocteau zudem noch die Äquivalente von Sherlock Holmes und Professor Moriarty. Immerhin: Diese Parallelität war von den Autoren sogar gewollt.
Kurz: Vieles kommt einem in diesem harmlosen Zeitvertreib namens "Joe Golem und die versunkene Stadt" bekannt vor. Im Herbst habe ich hier schon mal eine Kooperation von Mignola & Golden vorgestellt ("Hellboy: Medusas Rache"). Wenn die damals besser weggekommen ist, dann lag es nicht an der Qualität des Buchs an sich - da hat schon "Joe Golem" die Nase vorn -, sondern daran, dass ich es halt als erstes gelesen habe. Einmal ist ok. Zweimal zeigt schon auf, wo die Grenzen von Mignola & Golden liegen. Ein drittes Mal muss nicht mehr sein - auch wenn am Schluss von "Joe Golem" jeder der Überlebenden nun eine persönliche Mission hat und Fortsetzungen jederzeit möglich erscheinen.
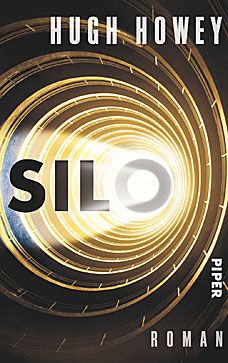
Hugh Howey: "Silo"
Gebundene Ausgabe, 544 Seiten, € 20,50, Piper 2013 (Original: "Wool", 2011)
Asche auf mein Haupt! Dieses Buch habe ich jetzt fast ein halbes Jahr lang Monat für Monat weitergeschoben, weil ich in letzter Zeit so viele Romane mit postapokalyptischem Setting in der Rundschau hatte. - Tja, sieht ganz so aus, als hätte ich das falsche Buch aufgespart. Während einige andere nach der Lektüre im Altpapier gelandet sind (ich nenne jetzt absichtlich keine Titel), hatte ich diesen 500-Seiten-Block fast in einer einzigen Sitzung durch. Ein bisschen hat dazu natürlich auch die Hitzewelle beigetragen, die tagsüber jede körperliche Bewegung jenseits von Seitenumblättern zur Mühsal machte. Vor allem aber war "Silo" einfach enorm spannend.
Ein wesentlicher Grund dafür, dass mir "Silo" gefallen hat, dürfte sein, dass es zwar eine Dystopie ist, aber nicht ins neue Modegenre Young-Adult-Dystopie fällt. Für mich haben sich diese beiden Komponenten nie so recht vertragen, schließlich ist YA auf tendenziell positivere Plots ausgerichtet: Die Helden und Identifikationsfiguren müssen ja fast alle Widerstände überwinden, wie unwahrscheinlich das im Endeffekt auch wirken mag. In der erwachsenen Version kann man das hingegen nur hoffen - und in "Silo" werden so einige Hoffnungen zunichte gemacht.
Die hermetische Gesellschaft
Nicht an der Hitze, sondern am extrem klaustrophobischen Setting des Romans liegt es, wenn man zwischendurch ins Japsen kommt. Während sich die Erdoberfläche als tödlich giftige Wüstenei präsentiert, lebt eine größere Anzahl Menschen in einem hermetisch abgeschotteten unterirdischen Betonsilo - und das schon seit Generationen. Mit Blick auf kläglich gescheiterte Experimente in der realen Welt wie "Biosphäre 2" wage ich zwar zu bezweifeln, dass sich eine solche künstliche Umwelt lange aufrechterhalten ließe, aber das sollte man auch nicht so tragisch nehmen. US-Autor Hugh Howey bemüht sich zumindest ein denkbares System zu entwerfen - inklusive hydroponischer Kulturen, Minenschächten zum Erzabbauen und einer Ölquelle, die die Energie liefert.
In diesem System hat sich eine exakt austarierte Gesellschaft entwickelt: Zum Kinderkriegen wird eine Lotterie abgehalten, zwei pro Paar sind der gewünschte Idealfall. Und die meisten Berufstätigen haben einen sogenannten Schatten, einen Lehrling, der ihre Stelle einmal übernehmen wird - Redundanz bedeutet Sicherheit.
Jenseits der Systemgrenze
Und doch hat das System seine Schattenseiten: So hat es vor ein paar Generationen offenbar einen Aufstand gegeben, der wohl seinen Grund hatte. Es ist verboten, auch nur auszusprechen, dass man den Silo verlassen will - wer es dennoch tut, wird zur Reinigung geschickt: In einem behelfsmäßigen Schutzanzug ins Freie verbannt, muss der oder die Verurteilte als letzte Auflage die Linsen der Außenbeobachtungskameras putzen, ehe ihn/sie die Umweltgifte zerfressen - ein eindringliches Bild. Und das ist nur der Anfang. Immer mehr zeichnet sich im Verlauf des Romans ab, dass Vieles, was im Silo unter "Ist halt so" läuft, ganz gezielt so eingerichtet wurde. Von der mangelnden Kommunikationstechnik bis zur räumlichen Untergliederung des knapp 150 Stockwerke tiefen Silos. Jemand spielt ein doppeltes Spiel mit den BewohnerInnen - möglicherweise sitzen sie gar einem einzigen gigantischen Betrug auf.
Die Idee von einer hermetisch abgeschotteten Mikro-Gesellschaft, der man vielleicht wahre, vielleicht aber auch erlogene Schauergeschichten von einer unbewohnbaren Außenwelt erzählt, ist in der Science Fiction nichts Neues. Während in der Regel aber die Auflösung des Rätsels, was draußen liegt, zur Klimax wird, erfahren wir es hier schon nach 40 Seiten. Nämlich am Ende von Teil 1, als Silo-Sheriff Holston seiner Frau ins Freie folgt. Die hatte ihm einst vor ihrem Abgang gesagt, die vergiftete Außenwelt sei nur eine Simulation. Was Holston dort dann wirklich vorfindet, lasse ich hier mal aus.
Episoden fügen sich zu einem Gesamtbild
Die frühe Aufklärung war aber keine gezielte Strategie des Autors, sondern eine reine Folge des Veröffentlichungsmodus - eine von mehreren, die sich interessanterweise mehrheitlich positiv ausgewirkt haben. Denn "Silo" ist im Grunde kein Roman, sondern eine Reihe aufeinander aufbauender Erzählungen, die Howey ursprünglich via Amazon im Kindle Direct Publishing vertrieben hat. So enthüllt uns Teil 1 (das ursprüngliche "Wool", benannt nach dem Putzlappen, mit dem die Reinigung vollzogen werden muss) die Wahrheit über die Außenwelt. Das wär's dann eigentlich gewesen, aber der Erfolg der Geschichte ließ Howey weiterschreiben.
Teil 2 macht über die vertikale Reise zweier neuer ProtagonistInnen den Aufbau des Bunkers für uns erfahrbar. Der mehrfache Wechsel der Hauptfiguren passt zudem ausgezeichnet zu dem, was nach dem Abhaken des Außenwelt-Rätsels zum eigentlichen Hauptthema der Geschichte(n) wird. Nämlich der Frage: Lässt sich das System überwinden? Und wie viele Opfer wird das erfordern? Das wird dann ab Teil 3 zur Herausforderung vor allem für Juliette, die längstdienende Hauptfigur. Juliette ist ein Tomboy in den 30ern, ein Mechanik-Ass und eine Frau der Tat, die sich wenig um Regeln schert. Für die aktuelle Leiterin bzw. Mayor des Silos stellt Juliette eine ideale Kandidatin für höhere Ämter dar - doch die Gegenkräfte sammeln sich. Die sitzen übrigens in der alles wissenden und nichts verratenden IT-Abteilung, da regen sich wohl unterbewusste Büromenschenängste ...
Auf dem Weg zur Trilogie?
Im Laufe des Veröffentlichens sind die einzelnen Erzählungen immer länger geworden. (Einzig negative Folgeerscheinung: Mit der zunehmenden Länge nähert sich Howey auch immer mehr der heutzutage typischen Totalausführlichkeit im Erzählen an. In der zweiten Hälfte des Buchs hätte man auch einiges raffen können, aber da hatte mich die Geschichte schon gepackt.) Mit dem Auftreten Juliettes wird das Ganze dann endgültig zu einem Quasi-Roman mit einer zentralen Hauptfigur und einem großen Spannungsbogen.
Im Original laufen die hier versammelten Episoden unter dem Titel "Wool Omnibus Edition", auch wenn es nur die Teile 1 - 5 sind, drei weitere bereits vorliegen und ein neunter kurz vor der Veröffentlichung steht. Aber keine Angst: Wenn man die deutschsprachige Ausgabe zuschlägt, hat man wirklich ein vollständiges Buch gelesen. Die nächsten Teile sind Prequels, und wenn dann noch Teil 9 ("Dust") heraußen ist, steht man letzten Endes womöglich doch wieder vor einer alten Genre-Bekannten ... einer Trilogie.
So, Ende einer Rundschau, die beinahe "Osama & Big Ugly Mama" geheißen hätte. Aber man soll's mit dem Reimen auch nicht übertreiben - erst recht, wenn beim nächsten Mal aller Voraussicht nach eine Alliteration bemüht werden wird. Eine auf "Q", das gibt's schließlich nicht so oft. (Josefson, derStandard.at, 10. 8. 2013)