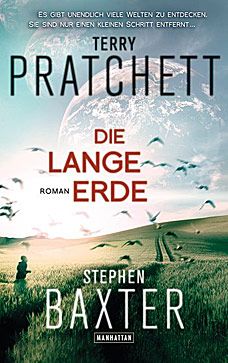
Terry Pratchett & Stephen Baxter: "Die Lange Erde"
Klappenbroschur, 399 Seiten, € 18,50, Manhattan 2013 (Original: "The Long Earth", 2012)
Und plötzlich kommt ein Buch daher, das einen wieder daran erinnert, wie es war, als man begonnen hat, Science Fiction zu lesen und sich mit verhältnismäßig einfachen Mitteln bereitwillig in fremde Welten entführen zu lassen. Man wird mit der Zeit ja unweigerlich etwas saturiert und kenn-ich-schon. So richtig die Schuhe zieht einem dann nur noch hochkomplexer Bombast - Beispiel: Hannu Rajaniemis "Fraktal" - aus.
... hätten solche Hard-SF-Festspiele bloß nicht immer den unangenehmen Beigeschmack, dass sich da wirklich nur noch eingefleischte Genre-Fans reintrauen. Schließlich war Science Fiction mal ein Massenphänomen und kein Nischenmarkt wie heute. Aber was dieser Tage in der SF als State of the Art gilt, ist für GelegenheitsleserInnen eben nicht so anschaulich wie die Hämorrhoiden von Charlotte Roche. Die ungewöhnliche Kooperation von Hard-SF-Autor Stephen Baxter und Fantasy-Satiriker Terry Pratchett aber schafft das beinahe unmöglich Gewordene: Nämlich sowohl den Ansprüchen von Genre-Fans zu genügen als auch Mainstream-LeserInnen bei der Stange zu halten, die es auf gut Glück mal mit einem SF-Buch versuchen wollen.
Auf in die Unendlichkeit
Im Jahr 2015 verändert der Wechseltag die Geschichte der Menschheit für immer. An diesem Tag wird der Bauplan eines Geräts ins Internet gestellt, mit dem man auf parallele Erden überwechseln kann. Ein recht einfaches Kästchen mit ein paar Schaltungen, gar nicht schwer zu basteln - dem Buch liegt eine Skizze bei, gerne mal selber ausprobieren! Dass das Ding mit einer Kartoffelbatterie betrieben wird, klingt nach einem der typisch skurrilen Einfälle Pratchetts. Aber was die Wirkungsweise des Wechslers anbelangt, werden wir später ohnehin noch eines Besseren belehrt.
Pro Schalterbetätigung gelangt man - entweder Richtung "Westen" oder "Osten" - eine Welt weiter. Jede davon ist eine fast exakte Kopie unserer Erde mit nur geringfügigen Variationen in Sachen Klima, Tier- und Pflanzenwelt. Je weiter man reist, desto mehr summieren sich allerdings die Unterschiede und führen schließlich zu Welten, die eine völlig andere Entwicklung durchlaufen haben als die unsere (die im Roman als Datum-Erde bezeichnet wird). In Summe ergeben diese Welten die möglicherweise unendliche Kette der Langen Erde. Und die steht plötzlich in ihrer Gesamtheit Ausreisewilligen offen, denn eines haben all die anderen Welten doch gemeinsam: Auf keiner außer der Datum-Erde selbst gibt es Menschen. Man wird verschiedenen Hominiden begegnen, aber echte Konkurrenten um Siedlungsraum und Ressourcen hat man nicht zu befürchten.
The Newest Frontier
"Die Lange Erde" - obwohl von zwei britischen Autoren geschrieben - greift den Frontier-Gedanken auf, der die USA im 18. und 19. Jahrhundert geprägt hat und heute immer noch als identitätsstiftender Faktor gilt. Man beachte, dass es in diesem Roman nur Richtung "Westen" geht. Anhand vieler kleiner Episoden, die am Rande des Geschehens um die eigentlichen Hauptfiguren eingestreut werden, erleben wir die globale Aufbruchsstimmung mit. Viele erhoffen sich ein besseres Leben, manche scheitern, alle müssen schwerwiegende Entscheidungen treffen.
... wie die Pioniersfamilie, die eines ihrer Kinder zurücklässt, weil es zur Minderheit derjenigen gehört, die aus unbekannten Gründen nicht wechseln können. Das wird übrigens noch Folgen haben. Und selbst wenn wir immer nur kurze Blicke auf solche Nebenfiguren werfen können, vergessen die Autoren nicht auf sie und schildern in gebotener Kürze, wie es mit ihnen weitergegangen ist. Im nächsten Band erfahren wir dann ja vielleicht auch, was aus den Aborigines geworden ist, die als Jäger in ein wahrhaft wildes Australien ausgewandert sind ...
Die Hauptfiguren
Im Mittelpunkt des insgesamt 15 Jahre umspannenden Romans steht der anfangs 13-jährige Joshua Valienté aus Madison, Wisconsin. Er kann auch ohne Gerät wechseln, wie sich herausstellen wird, und nutzt diese Gabe zunächst für eine ausführliche Erkundung der Langen Erde im Alleingang. Mit den diversen Unzulänglichkeiten anderer Menschen kommt Joshua nämlich nicht besonders gut klar. Ich hätte zunächst auf eine leichte Variante von Asperger à la Sheldon Cooper getippt, aber bei Joshua nennt es sich "Daniel-Boone-Syndrom": Er liebt die Stille, und die findet er nur auf Welten ohne Menschen.
Und ausgerechnet ihm - mittlerweile erwachsen geworden - bindet man für eine Forschungsexpedition einen Partner auf die Nase, der unterschiedlicher kaum sein könnte: Lobsang ist großspurig, jovial und nur bedingt vertrauenswürdig. Mal abgesehen davon, dass es sich um eine Künstliche Intelligenz handelt, die behauptet, die digitale Reinkarnation eines tibetischen Motorradmechanikers zu sein. Lobsang bringt Witz in die Handlung ein, wirkt aufgrund seiner Zugriffsmöglichkeiten auf die globale Infosphäre aber auch eine Spur beängstigend (zumindest auf mich): Eine Art Mini-Skynet mit guten Absichten. Auf jeden Fall ergeben die beiden ungleichen Partner ein Duo mit vielversprechender Chemie.
Welten im Daumenkino
Sie brechen zunächst auf, um das Ende der Langen Erde zu finden. So es überhaupt eines gibt. Später drängt sich immer stärker die Frage in den Vordergrund, warum so viele Hominidenspezies - die zur Verblüffung der Menschen allesamt natürliche Wechsler sind - aus den Welten im "Westen" Richtung "Osten" fliehen. Und schließlich würde man auch gerne ergründen, warum es die Lange Erde überhaupt gibt. Beziehungsweise warum sie sich praktischerweise gerade dann geöffnet hat, wenn der Menschheit die Ressourcen ausgehen.
Auf ihrer Expedition - ein High-Tech-Luftschiff fungiert dabei als Lobsangs Quasi-Körper und kann daher beim Wechseln mitgenommen werden - zappen sich Lobsang und Joshua nun im Schnelltakt von Erde zu Erde und staunen über das Gewimmel der wechselnden Tierwelten unter sich: "Wie ein Ray-Harryhausen-Demoband" kommt es dem Betrachter vor. Seiner Schätzung nach passierten sie alle paar Sekunden eine Welt, über 40.000 neue Welten pro Tag, wenn sie dieses Tempo rund um die Uhr beibehielten (...) Unter dem Schiffsbug huschten Landschaften vorbei, von denen er nur die gröbsten Umrisse erkennen konnte, ganze Welten zogen im Takt seines eigenen Herzschlags vorüber.
... damit sind wir mittendrin in Stephen-Baxter-Land, bei Panoramablicken, großen Dimensionen und Gedanken zur Evolution. Also der Art von Sense of Wonder, die als Baxters Stärke bekannt ist, während die Zeichnung von Charakteren als seine Schwäche gilt. Aber hier springt Pratchett ein und sorgt für eine ausgleichende Portion Menschlichkeit. Plus - selbst wenn "Die Lange Erde" natürlich ganz anders als die üblichen Pratchett-Romane angelegt ist - eine Prise Humor. Etwa wenn ein Buchhändler auf einer noch nicht elektronifizierten Erde jubelt, dass er endlich wieder gefragt ist: Auf richtiges Papier gedruckte Bücher, jedes einzelne davon! Tote-Baum-Technologie! Informationen, die, wenn sie vernünftig gelagert wurden, Jahrtausende überdauerten! Und man brauchte keine Batterien dafür!
Für den 12-Jährigen in dir
Wenn eine eher mörderische Variante von Hominiden den Spitznamen "Elfen" bekommt, während die friedlichen "Trolle" genannt werden, dann steckt eindeutig Pratchett dahinter - man kennt ja seine Meinung zu Elfen. Ansonsten ist es zwar oft, aber nicht immer möglich zuzuordnen, welcher der Autoren welche Passage geschrieben hat. Pratchett und Baxter ergänzen einander hervorragend. Und liefern zusammen einen Roman ab, der mir großes Vergnügen bereitet hat, weil er einfach frisch wirkt und voller Ideen steckt. Wenn ich etwa an die Passagen über eine Massenevakuierung gegen Romanende denke - sowas habe ich in der Form noch nie gelesen.
Ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung, die im Original ("The Long War") seit Sommer erhältlich ist. Schöne Geschichte!
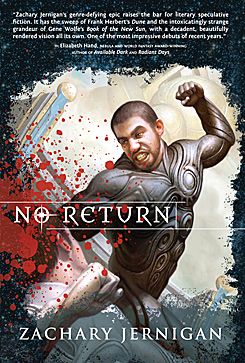
Zachary Jernigan: "No Return"
Gebundene Ausgabe, 292 Seiten, Night Shade Books 2013
Lasset die Körpersäfte fließen! Es niest keiner in "No Return", aber ansonsten tropft, quillt und spritzt hier alles, was der menschliche Organismus abzusondern vermag. Herschauen, Stephenie Meyer: So arbeitet man als Autor seine mormonische Erziehung ab. Und nicht mit aseptischen Milchzahn-Vampiren, die keinen Sex vor der Ehe haben.
Ich kann kaum Negatives an Zachary Jernigans Debüt-Roman finden. Etwas Feinschliff geht natürlich immer. Aber wo es einem Erstlingswerk da noch mangeln mag, wird dies mit einer Qualität wettgemacht, die ebenfalls eher für junge AutorInnen typisch ist: Nämlich dieser gewissen Sturm-und-Drang-Attitüde, mit der den LeserInnen das vor den Latz geballert wird, was dem Autor ein Anliegen ist. Heißt hier: Pro Sex. Pro Selbstbestimmung. Anti Religion. (Das Anti ergibt sich mehr oder weniger zwangsläufig aus den beiden Pros.)
Das Bühnenbild
Jeroun ist ein Planet, der einst von den riesenhaften elders bevölkert war, ehe die Menschen aus ihren Metalleiern schlüpften und ihn neu besiedelten. Die elders haben allenthalben gigantische Bauwerke hinterlassen - und ihre fossilen Überreste, aus denen nun alle möglichen magischen Substanzen gewonnen werden. Unbemerkt von der Menschheit, auf der anderen Seite der Welt, liegt allerdings noch ein Kontinent, auf dem eine elder-Restpopulation im Winterschlaf verharrt. Verborgen unter einem permanenten Wirbelsturm wie dem Roten Fleck des Jupiter.
Und damit noch nicht genug des Worldbuildings: Hoch im Orbit, nahe Jerouns Mond, kreist eine Formation gewaltiger kugelförmiger Gitterkonstrukte. Adrash, der höchst reale Gott Jerouns, bewegt sie ... im Handbetrieb, erster zarter Hinweis auf die Körperlichkeit, die sich als Grundmotiv durch den ganzen Roman zieht. Zwei solcher Himmelskugeln hat der von den Menschen enttäuschte Gott einst abstürzen lassen und damit einen Kataklysmus ausgelöst. Zur endgültigen Ausrottung der Menschheit hat er sich bislang aber nicht durchringen können. Noch hegt er die Hoffnung, dass ihn irgendwann mal jemand positiv überrascht. Oder vielleicht auch, dass ihm jemand Ebenbürtiges entgegentritt.
Und wenn schon der Gott selbst rätselt, ob er nicht möglicherweise längst verrückt geworden ist, was sollen dann erst die Menschen von ihm halten? Does Adrash love the peaceful, or does he love the strong? Eine religiöse Konfliktlinie zieht sich durch den ganzen Heimatkontinent der Menschheit: Adrashi verehren den Gott und glauben, dass er die Welt retten wird. Anadrashi hingegen verfluchen ihn und erklären, dass die Menschheit ohne ihn besser dran wäre. Beide Seiten gehen dabei mit dem gleichen religiösen Eifer vor. Rituelle Kämpfe zwischen den VertreterInnen beider Glaubensrichtungen stehen an der Tagesordnung und bringen nach dem Sex das zweite Element Körperlichkeit in den Roman ein: Gewalt.
Der Held ...
Vedas Tezul ist in einem Orden der Anadrashi aufgewachsen und hat es zu einem begnadeten Kämpfer gebracht. So gut ist er, dass er den Orden bei einem großen internationalen Turnier vertreten soll. Die monatelange Reise quer über den Kontinent wird ihn allerdings mit der Erkenntnis konfrontieren, dass er trotz seiner 34 Jahre in allen Belangen außer dem Kämpfen vollkommen unerfahren ist. "You're a good man, but you're not a whole man", bringt es einer seiner Reisegefährten auf den Punkt. Letztlich führt ihn der Weg zur Selbsterkenntnis unweigerlich auch zur Frage, ob er die Regeln und Ziele seiner Religion weiter vertreten kann.
Jernigan hat in einem Interview bekannt, dass in Vedas viel von seiner eigenen Biografie eingeflossen ist. Zumindest was das Ringen mit der Religion betrifft, weniger die Martial-Arts-Künste und die Gabe, in einem superheldenmäßig hautengen Kampfanzug eine gute Figur abzugeben ... Generell sind die Charaktere des Romans erfreulich vielschichtig gezeichnet: Ein willkommenes Gegengewicht zur knalligen Action-Handlung.
... und seine GefährtInnen auf der Queste
Churli Casta Jons, kurz Churls, ist eine erfahrene Kämpferin; nicht aus ideologischen Motiven heraus, sondern für Geld. Ähnlich wie Vedas hält sie sich dabei an einen nicht für jedermann nachvollziehbaren Ehrenkodex: Mord ist für sie tabu. Dennoch tötet sie professionell und hat - wie fast alle der Romanfiguren - ausgesprochene Lust am Kämpfen. Immer wieder erscheint ihr der Geist ihrer zu Tode gekommenen Tochter Fyra und übernimmt die Rolle ihres Gewissens. Zudem sähe Fyra ihre Mutter am liebsten mit dem unschuldigen Vedas verkuppelt. Aber es knistert zwischen Churls und Vedas ohnehin von Beginn der Reise an gewaltig.
Und dann wäre da noch Berun, ein künstliches Geschöpf, das aus winzigen Metallkugeln ähnlich den orbitalen Konstrukten besteht. Berun hat sich den beiden TurnierteilnehmerInnen nicht ganz freiwillig angeschlossen: Sein Schöpfer hat ihn beauftragt, Vedas im Auge zu behalten und - ohne eine Begründung dafür zu nennen - ihn gegebenenfalls zu töten. Aber Berun beginnt Vedas und Churls zu mögen: Auch ihn wird also mehr und mehr das Gewissen plagen.
In einem parallelen Handlungsstrang treten außerdem noch zwei outbound mages auf: Magier, die sich in den Orbit schleudern, um ihren rätselhaften Gott vielleicht aus der Nähe besser verstehen zu lernen. Beziehungsweise im Fall der Zauberin Ebn Bon Mari, um den Gott zu verführen. Das Konzept der "alchemischen Astronauten" hat ein Leser anschaulich als Marvel-style space opera beschrieben. Jernigan selbst ordnet seinen Roman als Science Fantasy ein.
Die Message
Jernigan müsste es gar nicht erst explizit aussprechen, sein Roman macht auch so klar, dass dem Autor Diversität ein Anliegen ist. Ethnische, geschlechtliche und sexuelle gleichermaßen. Überhaupt Sex: Der kommt in fast allen Variationen und in expliziter Form vor. Wobei genau genommen Solo-Nummern die Mehrheit stellen. She had resisted the temptation to masturbate for almost two months. So fangen Kapitel in Fantasy-Romanen selten an, und erst recht nicht lassen sie dem eine mehrseitige Beschreibung des Akts folgen. Aber wie gesagt: Es knistert zwischen den Hauptfiguren (und nicht nur denen), zugleich stehen ihnen alle möglichen Hemmnisse im Weg. Wie soll man/frau sich da denn sonst Abhilfe verschaffen? Exploitation ist "No Return" nicht, jede sexuelle Handlung hier hat ihre Platzberechtigung.
Jernigans Bibliografie umfasst bisher vor allem Kurzgeschichten. Darunter bemerkenswerterweise auch einen Beitrag für die "Wired Hard"-Reihe, die SF & Fantasy mit schwuler Pornografie - pardon: Erotica - kombiniert. Vielfalt als Konzept, nicht aufgrund eigener Betroffenheit, sondern um der Sache willen. Das macht Jernigan, selbst nämlich heterosexuell, dann wohl zu einer Art James Franco der Phantastik.
Fazit
Bei Fantasy-Mehrteilern beschränke ich mich mittlerweile - wenn überhaupt - darauf, den ersten Band in einer Rundschau vorzustellen und das Dranbleiben dann den LeserInnen zu überlassen. Aber alle heiligen Zeiten kommt ein Autor vorbei, dem doch etwas Originelleres als das ewig gleiche Dauermittelalter eingefallen ist. Steph Swainston mit ihrer "Komet"-Reihe etwa. Jeff VanderMeers "Ambra"-Romane. Ricardo Pintos "Steinkreis des Chamäleons". Oder zuletzt Ken Scholes' Reihe "Die Legende von Isaak". Bücher, die einen wirklich in neue Welten führen. Ohne Orks, ohne Elfen, ohne das ganze ausgelutschte Zeug, das bei weitem nicht so selbstverständlich ist, wie viele AutorInnen zu glauben scheinen.
Zachary Jernigans "No Return" zähle ich da jetzt dazu. Das Buch ist als Standalone-Roman zu lesen, schreit aber geradezu nach einer Fortsetzung. Und Jernigan hat auch schon vage eine in Aussicht gestellt. Da darf ich ausnahmsweise - ohne Kontext ist es eh kein Spoiler - die beiden Schlusssätze des Romans zitieren: Months, maybe years of anticipation. He wondered if he could wait that long.
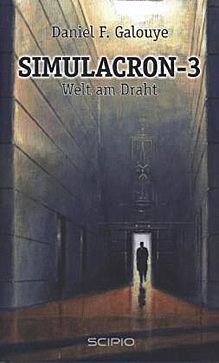
Daniel F. Galouye: "Simulacron-3. Welt am Draht"
Gebundene Ausgabe, 240 Seiten, € 20,50, Scipio 2013 (Original: "Simulacron-3", 1964)
Hier handelt es sich möglicherweise um einen der raren Fälle, in denen man eine Romanvorlage schneller durch hat als die Verfilmung. Zumindest wenn man sich Rainer Werner Fassbinders TV-Mehrteiler "Welt am Draht" aus den 70ern ansieht. Es gibt ja auch noch Josef Rusnaks Spielfilm "The 13th Floor" aus dem Jahr 1999, eine nicht nur kürzere, sondern auch freiere Bearbeitung des visionären Romans von Daniel F. Galouye.
"Matrix" in der Wirtschaftswunderzeit
"Visionär" mag vielleicht hochgegriffen klingen, aber "Simulacron-3" gehört zu den ältesten Romanen, die sich mit dem Thema Virtuelle Welten auseinandergesetzt haben. John Brunner, Stanley G. Weinbaum und Philip K. Dick mögen sich schon früher damit befasst haben, und auch im Nachwort des Romans wird darauf hingewiesen, dass Galouye sicher nicht der erste auf diesem Gebiet war. Aber in der Ahnenreihe von "Matrix", "Otherland" und dem "Star Trek"-Holodeck steht "Simulacron-3" auf jeden Fall ganz nah am Beginn.
Der Grund, warum hier eine simulierte Welt erzeugt wird, ist ein überaus profaner: Sie soll als Marktforschungsinstrument dienen. Denn in Galouyes Zukunftsentwurf ist das Erkunden der Konsumentenwünsche alles. Marktforschung ist ein gesetzlich verankertes Recht, Schwärme von Umfragetypen ziehen durch die Straßen oder rufen Otto Normalverbraucher zuhause an. Wer sich der Dauerbelästigung mal entziehen will oder einfach nicht antwortet, muss dafür eine Strafgebühr abdrücken. Da könnte das Unternehmen TEAG mit seiner Simulektronik-Welt voller simulierter Menschen eine echte Alternative bieten: Man beobachtet einfach von außen das Verhalten der reagierenden Identitätseinheiten und zieht daraus seine Schlüsse.
Hinter den Kulissen der Welt
Ich-Erzähler Douglas Hall ist der neue technische Direktor der TEAG und als solcher direkt für das Projekt Simulacron-3 verantwortlich. Sein Vorgänger ist vor kurzem bei einem Unfall gestorben - der erste zarte Hinweis darauf, dass hier etwas im Busch ist. Weitere folgen. Auf einer Party trifft Hall den Chef des TEAG-Sicherheitsdienstes, der sich merkwürdig verhält und - Hall hat kaum eine Sekunde nicht hingesehen - plötzlich verschwunden ist. Von der Party, aus der Welt und bald auch aus dem Gedächtnis aller Personen außer Hall.
Der rauft seinerseits mit immer wieder auftretenden Blackouts und erlebt schließlich auf einer Autofahrt einen Moment existenziellen Grauens, der bereits im Klappentext des Buchs zitiert wird: Ich saß eine Ewigkeit und starrte ungläubig hinaus. Die Straße hörte nach dreißig Metern auf. Auf beiden Seiten des Streifens fiel die Erde selbst in eine undurchdringliche Barriere höllischer Dunkelheit ab. Da draußen gab es keine Sterne, kein Mondlicht - nur das Nichts im Nichts ...
Unschwer zu erraten, dass Halls Ängste, er könnte sich selbst in einer simulierten Welt befinden, nicht ganz grundlos sein dürften. Dass sich das früh abzeichnet, macht übrigens nichts, denn hier handelt es sich nicht um eine Kurzgeschichte mit Twist am Ende. Vielmehr geht es dann, wenn zur Jagd auf Hall geblasen wird, zunächst um die Frage, wer unter Halls Bekannten die Verbindungsperson zur nächsthöheren Ebene - der mutmaßlichen Realität - sein könnte. Und nach dieser "Tätersuche" darum, was aus Hall und aus seiner Welt werden wird. Obwohl welt-interne Interessenkonflikte Halls Suche zusätzlich erschweren und ihn auf einige falsche Fährten schicken, sind diese Umwege keine Handlungsleerläufe. Ich bewundere die Ökonomie des Romans: "Simulacron-3" hat ein optimales Verhältnis von Länge und Tempo.
Alt, aber nicht veraltet
Natürlich merkt man dem Roman immer wieder sein Alter an. Dass auf der Party Scotch Asteroid gereicht wird, wirkt ebenso retro wie die unkritische Begeisterung für die Segnungen des technischen Fortschritts, mit der sich hier die Massen noch locken lassen: "Siskin sagt für morgen vormittag Vorführung des Simulators an! Die Maschine soll das Problem menschlicher Beziehungen lösen!", verheißt ein Zeitungsverkäufer. Ähm, welches Problem wäre das nochmal genau?
An solchen Elementen sieht man noch am ehesten, dass der Roman ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat. Bei anderen kann man gut abstrahieren, sowohl was die Technologie als auch was das Wording betrifft. Gut, diese Matrix läuft auf Magnetbändern - aber wie man sich hier von einer Realitätsebene via simulektronischem Doppelgänger in die nächsttiefere begibt, umschreibt exakt das, was man heute einen Avatar nennen würde. Damals blieb das Wort allerdings noch Hindus vorbehalten.
Und in einigen Momenten war "Simulacron-3" geradezu hellsichtig. Nicht nur was die gesellschaftliche Bedeutung der Meinungsforschung anbelangt, deren Diktat sich in Galouyes Zukunft sowohl Wirtschaft als auch Politik fügen. Da gäbe es auch noch das am Rande erwähnte Detail der neuen Temperenzbestimmung: Zigarettenrauchen in der Öffentlichkeit ist verboten - dafür muss man in eigens ausgewiesene Raucherkneipen gehen ...
P.S.:
Ein Wort noch zum Verlag, in dem die Neuausgabe von "Simulacron-3" erschienen ist. Scipio ist ein Imprint des HJB-Verlags. Der wiederum hängt unmittelbar mit dem Schweizer Unitall-Verlag zusammen - zu dessen Produkten auch die widerwärtige rechtsextreme SF-Reihe "Stahlfront" zählte. Auch bei Scipio stehen Plots mit Bezügen zur Nazi-Zeit offenbar hoch im Kurs. Und dazwischen schmuggeln sich dann Seltsamkeiten wie Aleister Crowleys "Tagebuch eines Narren" oder echte SF-Klassiker wie Jack Finneys "Körperfresser" oder eben dieses Buch hier. Befremdliche Umgebung, sehr guter Roman.

George R. R. Martin: "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben"
Klappenbroschur, 416 Seiten, € 15,50, Penhaligon 2013 (Original: "Hedge Knight", 1998; "The Sworn Sword", 2003; "The Mystery Knight", 2010)
"Game of Thrones"-Fans dürften sich schon wie die Falken auf dieses Buch gestürzt haben, immerhin wird es als Prequel zur Erfolgsserie "Das Lied von Eis und Feuer" angekündigt. In gewissem Sinne stimmt das auch. Es ist nur zu beachten, dass es sich nicht um einen Roman handelt, sondern um eine chronologisch angeordnete Zusammenstellung dreier Novellen, die George R. R. Martin über einen längeren Zeitraum hinweg veröffentlicht hat. Weitere Beiträge zur "Heckenritter"-Reihe, deren erste Teile es auch als Comics gibt, sind geplant.
Deutschsprachige LeserInnen haben übrigens einen Startvorteil: Auf Englisch ist eine Omnibusausgabe der ersten drei Novellen erst in Planung. Nachdem zwei davon bereits in deutschsprachigen Anthologien erschienen sind, hat der Penhaligon-Verlag die Gunst der Stunde genutzt und diese mit dem bislang unübersetzten "The Mystery Knight" ("Der geheimnisvolle Ritter") schon jetzt auf den Markt gebracht; das ist doch mal ein Service.
Es war einmal in Westeros ...
Nachdem ich keine Endlosserien mehr lese (nicht mal so gute wie "Das Lied von Eis und Feuer"), war für mich in erster Linie interessant, ob die "Heckenritter"-Abenteuer auch für sich allein stehen können. Tun sie. Alt-Fans brauchen keine Angst haben: Es gibt genug Querverweise, um das Ganze in den "Westeros"-Kosmos einzufügen. Trotzdem merkt man den Novellen an, dass Martin hier mit einem gewissen Maß an Befreiung schreiben konnte. Eine derart ausgefeilte und in sich verzahnte Welt wie die seiner Hauptreihe kann auch wie Blei auf einem lasten, wenn man einfach nur Geschichten erzählen möchte.
Zeitlich befinden wir uns knapp 90 Jahre vor dem Beginn der Hauptreihe. Die Sieben Königreiche von Westeros sind noch unter der Herrschaft des Hauses Targaryen vereint, die höchsten Kreise der Politik betreten wir zunächst aber nicht. Im Mittelpunkt der Handlung steht der jugendliche Dunk, der Knappe eines gealterten Heckenritters, wie all die landlosen Ritter genannt werden, die außer ihrem Titel und einer Rüstung keinerlei Besitz haben. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie damit, dass sie durch die Lande ziehen, mit Glück bei einem Turnier ein wenig Geld gewinnen und mit noch mehr Glück einen Job bei einem Burgherrn ergattern. Recht New Economy, eigentlich. Die dritte Novelle bietet einige schöne respektive ernüchternde Einblicke in diese alles andere als heroische Lebenswelt.
Die Hauptfiguren
Gleich zu Beginn muss Dunk seinen Herrn begraben und schlüpft fortan selbst in die Rolle eines Heckenritters ("Duncan der Große") - ein anderes Leben kennt das ehemalige Straßenkind aus den Slums von Königsmund ja auch nicht. Trotz seiner niederen Herkunft und seines vermutlich niemals stattgefundenen Ritterschlags verkörpert Dunk die ritterlichen Ideale aber wie keine andere Figur in Martins Erzählungen. Blöd wie eine Burgmauer findet er sich selbst. Was nichts anderes heißt, als dass ihm gänzlich die Tücke fehlt, die Martin seinen Figuren so gerne verleiht. Ein ungewöhnlich rundum-positiver Protagonist also. Und auch wenn er im Verlauf weiterer Novellen wohl noch einen Reifeprozess durchleben wird, sieht es fürs Erste nicht danach aus, dass Dunk jemals seine Moralvorstellungen über Bord werfen wird.
"Tales of Dunk and Egg" heißt dieser Erzählzyklus im Original, und besagtes "Ei" tritt Dunk in Form eines bloßfüßigen kleinen Jungen entgegen, der unbedingt Dunks Knappe werden will. Dass sich Ei bald als Aegon, ein ausgebüxter Sprössling aus dem Hause Targaryen, entpuppt, wird Dunk mehr überraschen als die LeserInnen. Dass Aegons Vater schließlich tatsächlich zustimmt, seinen hochwohlgeborenen Sohn mit Dunk auf die ungewisse Reise gehen zu lassen, lässt sich in Sachen Glaubwürdigkeit gerade noch so als soziales Experiment schlucken. (Aegons Brüder sind nämlich hoffnungslos verzogen - vielleicht wird aus dem Kleinen ja was, wenn er durch eine rauere Schule geht. Wird es auch, wie Westeros-Chronisten wissen ...) Auf jeden Fall ist damit das dynamische Duo Dunk & Ei geboren und bereit, von Abenteuer zu Abenteuer zu ziehen.
Leichtfüßige Erzählungen
Diese Abenteuer wirken zunächst zumindest wie eine Light-Version der Hauptreihe, ein wenig Martin'scher Geist fließt aber von Anfang an ein. Und wird sich mehren. In der ersten Novelle, "Der Heckenritter", endet ein Turnier nicht nur für die Guten blutig. In der zweiten, "Das verschworene Schwert", zeigt sich, dass öffentliches Image und harte Fakten nicht unbedingt übereinstimmen müssen - und Dunk steht plötzlich vor dem Problem, dass er sich womöglich der falschen Seite verpflichtet hat. Und in der dritten ... aber das wäre gespoilert. Tendenziell zeichnet sich übrigens ab, dass auch die "Heckenritter"-Abenteuer mehr und mehr in eine große politische Rahmenhandlung eingebettet werden.
Der Hauptunterschied zum "Lied von Eis und Feuer" ergibt sich aus einem rein strukturellen Umstand: Da es sich bei den Erzählungen nicht um Romane, sondern um Novellen handelt, entfällt der von der mosaikartig angelegten Hauptreihe gewohnte Wechsel zwischen verschiedenen Perspektiven. Es gibt eine ganz klar definierte erste Hauptfigur - schon die zweite folgt erst in einigem Abstand, alle anderen sind erst recht keine gleichwertigen Akteure.
Liest sich ziemlich gut, das Ganze. Und ist - wie immer man das bewerten mag - etwas leichter verdaulich als die sehr zynischen "Eis und Feuer"-Romane. Mal sehen, wie's weitergeht - fürs Erste jedenfalls setzt Martin noch nicht auf die brutale Keule, wenn er wie gewohnt die High Fantasy auf den Boden der nüchternen Realität herunterholt. Schließen wir mit einem schönen Textbeispiel: Als sie die Pastete aufschnitten, stieg ein halbes Hundert Vögel auf und flog in der Halle herum. Bei anderen Hochzeiten, die Dunk besucht hatte, war die Pastete mit Tauben oder Singvögeln gefüllt gewesen, doch in dieser befanden sich Blauhäher und Feldlerchen, Tauben und Amseln, Spottdrosseln und Nachtigallen, kleine braune Spatzen und ein großer roter Papagei. "Einundzwanzig Sorten Vögel", sagte Ser Kyl. "Einundzwanzig Sorten Vogelscheiße", erwiderte Ser Maynard. "In Eurem Herzen ist kein Platz für Poesie, Ser." "Und Ihr habt Scheiße auf der Schulter."
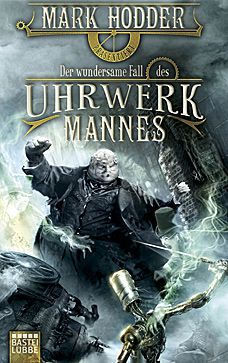
Mark Hodder: "Der wundersame Fall des Uhrwerkmannes"
Broschiert, 526 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2013 (Original: "The Curious Case of the Clock Work Man ", 2011)
Schöne Sache von Lübbe, dass sie die "Burton & Swinburne"-Reihe von Mark Hodder aufgegriffen haben. Deren ersten Band (auf Deutsch: "Der kuriose Fall des Spring Heeled Jack") habe ich seinerzeit in der Originalversion vorgestellt. Und bloß nicht mit der schwachen "Newbury & Hobbes"-Reihe von George Mann verwechseln: Steampunk-Ermittlerduo ist nicht gleich Steampunk-Ermittlerduo.
Verändertes Weltgefüge
Überhaupt konnte das Großbritannien der 1860er Jahre, wie es uns in Hodders Romanen in praller Detailvielfalt entgegenspringt, nur deshalb ein Steampunk-Gesicht annehmen, weil ein Zeitreisender in Band 1 unabsichtlich die Historie verändert und durch weiteres unprofessionelles Eingreifen alles noch schlimmer gemacht hat. Das Ergebnis ist eine Welt, in der sich nicht nur historische Eckdaten verschoben haben (z.B. ist die ewige Queen und Steampunk-Ikone Victoria hier schon lange tot), sondern seltsamerweise auch ein bisschen die Naturgesetze. Wie das möglich war, bleibt vorerst ungeklärt - aber es wird thematisiert.
Derweil zählen wir mit Vergnügen mit, was in dieser Welt funktioniert und was nicht. Elektrizität und Luftschiffe beispielsweise wurden als Flops ad acta gelegt. Dafür laufen dampfbetriebene Roboter und Hubschrauberstühle wie am Schnürchen. Ganz zu schweigen von all den Riesentieren, die man dank Darwin züchten konnte - zum Beispiel gigantische Insekten, die ausgehöhlt und zu Fahrzeugchassis umgemodelt werden. Den Spitznamen "Käfer" für Volkswagen darf man hier durchaus wörtlich nehmen! Spiritismus bleibt nicht den Scharlatanen vorbehalten und selbst der Feen-Mode jener Ära gewinnt Hodder eine realistische Note ab. Realistisch und reptilisch, um genau zu sein ...
Die Protagonisten
Der "Uhrwerkmann" schließt recht unmittelbar an den Vorgängerband an. Ein paar der dort geschilderten politischen Ereignisse beben hier noch nach - um die zu verstehen, sollte man vielleicht "Spring Heeled Jack" gelesen haben. Aber das gilt nur für die Anfangskapitel, dann rückt schon jemand Neues in den Fokus. Kurioserweise übrigens nicht die Titelfigur, die hat den ganzen Roman über nur eine Nebenrolle. Nein, ein verlorener Sohn aus gutem Hause namens Roger Charles Tichborne. Mit dem haben sich nun unsere beiden ungleichen Ermittler, der Abenteurer Richard Francis Burton und der Dichter Algernon Charles Swinburne, zu befassen. (Drei Männer mit dreiteiligen Namen, ist ja fast wie bei einer Nobelpreisverkündung ...)
Hodder greift damit eine reale Skandalgeschichte aus dem viktorianischen England auf, entstellt sie aber mindestens so sehr wie deren Hauptperson. Ein aus den Kolonien "heimgekehrter" Mann, der sich Roger Charles Tichborne nannte und Ansprüche an das Erbe "seiner" Familie stellte, sorgte im England unserer Zeitlinie für einiges Aufsehen. Bei Hodder präsentiert er sich (siehe Titelbild) als eine Art Sumo-Frankenstein mit hypnotischen Fähigkeiten. Und die nutzt er dafür, die Sympathien, die ihm aus der Arbeiterklasse entgegenschlagen, in einen landesweiten Aufstand zu kanalisieren. Erst ging es für Burton & Swinburne nur darum, die wahre Identität des offensichtlichen Betrügers aufzuklären. Aber bald haben sie alle Hände voll damit zu tun, London vor dem Untergang zu bewahren.
Sensationen, Attraktionen
Übernatürliche und politische Umtriebe verweben sich im "Uhrwerkmann" zu einem Netz aus Ektoplasma, das das ganze britische Empire in Gefahr zu bringen droht. Wir staunen über Riesenschwäne im Luftkampf, machtvolle Steine außerirdischen Ursprungs und ferngelenkte Untote. Und dürfen uns über Swinburnes Alkohol- und Masochismus-Eskapaden ebenso amüsieren wie über Tausendsassa Burton, wenn er mal wieder seine Sufi-Kräfte sammelt, um das Abendland zu retten. Mein persönliches Highlight ist allerdings eine Küchenschlacht im wörtlichen Sinne mit sämtlichen greifbaren Utensilien. Gäbe es dabei keine Toten, könnte man das glatt in einen Bud-Spencer-Film einbauen.
Nicht zu vergessen Hodders munterer Erzählstil, der sich auch in die Übersetzung retten konnte. Und der den Hauptfiguren unterschiedliche Stimmen verleiht: Während Swinburne im Dauerüberschwang fast ertrinkt, tropft aus Burton die Galle. Siehe etwa seine Beschreibung eines Afrikaforschers, der mit ihm auf Expedition war: Lieutenant Speke schoss auf alles. Er jagte Kugeln in Flusspferde und Antilopen, in Giraffen und Löwen, in Elefanten und Rhinozerosse. Er tötete mit Freude und wahllos und hatte aus Sansibar eine siebenhundert Meilen lange Spur von Kadavern hinter sich hergezogen.
Welten im Vergleich
Viele Steampunk-Romane lappen auch ins Genre Secret History, das historische Fakten und Personen aufgreift und zwischen diesen neue, oft hochspekulative Querverbindungen herstellt. Manche Persönlichkeiten gehören dabei fast schon zum Inventar. Einmal mehr machen wir ein Häkchen bei Computer-Pionier Charles Babbage und dem visionären Ingenieur Isambard Kingdom Brunel. Nicht zu vergessen bei Oscar Wilde, der hier noch ein Junge ist und trotzdem schon mit Aphorismen um sich wirft.
Das alles wäre noch nicht rasend originell und Wilde-Sprüche kann man heute schon auf dem Einwickelpapier eines Ildefonso lesen. Aber Hodder hat zum Glück auch in weniger überfischten Gegenden seine Netze ausgeworfen und wartet mit einer ganzen Reihe nicht so bekannter historischer Persönlichkeiten auf. Nebst an passender Stelle in den Text eingearbeiteten Originalzitaten. Im Anhang kann man unter dem Titel "Währenddessen im Viktorianischen Zeitalter" nachlesen, was all diese Romanfiguren in unserer Zeitlinie so getrieben haben. Da steckt schon einiges an Recherchearbeit drin, und die hat ihren Teil dazu beigetragen, dass Hodders Welt so überaus lebendig wirkt.
Gerne mehr davon!
Hodders Roman ist ein wildes Garn, das bestens unterhält, sich seiner Ungereimtheiten (Stichwort Naturgesetze) absolut bewusst ist, diese thematisiert und in Band 3 hoffentlich einer befriedigenden Auflösung zuführen wird. Der wird "Auf der Suche nach dem Auge von Naga" (im Original: "Expedition to the Mountains of the Moon") heißen und Burton endlich wieder auf seinen Leib-und-Magen-Kontinent Afrika schicken. Danach ist diese Trilogie inhaltlich abgeschlossen.
Und während wir darauf noch bis 2014 warten müssen, hat Hodder diesen Sommer mit "The Secret of Abdu El Yezdi" bereits eine zweite Burton & Swinburne-Reihe eröffnet. Immer her damit!

Evan Currie: "In die Dunkelheit"
Broschiert, 688 Seiten, € 11,30, Heyne 2013 (Original: "Into the Black - Odyssey One", 2012)
In der SF-Fachzeitschrift "Locus" gibt es die Rubrik "Date File", die ich insbesondere nach den Angaben zu Übersetzungslizenzen durchkämme. Ist vielleicht ein subjektiver Eindruck, aber schon seit längerer Zeit scheinen mir da die Verkäufe nach Deutschland rückläufig zu sein. Insbesondere bei Heyne, dem Haus für Premium- und Blockbuster-SF, wäre das ein Jammer. In den letzten Programmen gab's recht viele Wiederveröffentlichungen älterer Titel (siehe auch die nächste Seite) und gar nicht so wahnsinnig viele neue. Selbst vermeintlich sichere Bänke lassen auf sich warten - Alastair Reynolds' "Blue Remembered Earth" oder Iain Banks' "The Hydrogen Sonata" etwa sind auch im Frühlingsprogramm 2014 noch nicht enthalten. Umso enttäuschender, dass eine 700-seitige Belanglosigkeit wie dies hier innerhalb eines Jahres den Weg ins Deutsche gefunden hat.
Vielleicht war es ja billig zu haben. Der kanadische Autor Evan Currie hat seine "Odyssey"-Reihe zunächst als E-Books veröffentlicht, bis ein Verlag die Druckrechte erwarb. Nach dem Erstling "Into the Black" 2011 folgten im Jahrestakt zwei vergleichbare Ziegel, so ganz nebenbei schreibt Currie zudem mit "Warrior's Wings" an einer zweiten Military-SF-Reihe (vier Bände seit 2011), im November erscheint der Auftaktband einer dritten. Bei einem solchen Output ahnt man, dass die Qualität davon nicht ganz unbeeinflusst bleiben wird.
Zur Handlung
Auf den Kern reduziert, hat "In die Dunkelheit" einen astreinen Pulp-Plot: Unternehmungslustige Westmänner ziehen ins Unbekannte hinaus und retten als Erstes eine junge Frau vor Monstern. Anschließend helfen sie dann einer uralten, aber schlafmützigen Zivilisation (ein paar tausend Jahre Frieden verweichlichen eben) gegen eine Invasion ebendieser Monster und stellen dabei überlegene Tatkraft unter Beweis. Das Ganze halt nicht im Dschungel, sondern mit Raumschiffen.
Besagte Frau heißt Milla und ist überaus menschlich - die Fremdheit ihrer Zivilisation drückt sich hauptsächlich darin aus, dass es dort keine Büstenhalter gibt. Und Milla bekommt von unseren Dritter-Weltkrieg-gestählten Erdmännern auch gleich mal ins Stammbuch geschrieben, dass Frieden um des Friedens willen der falsche Weg ist. Mehrfach fällt sie in der Folge, obwohl eine Große ihres Volks, in die Rolle einer kulleräugigen Tussi zurück, die wie ein Papagei die schwierigen Fachausdrücke ihrer Retter nachplappert. Als Handlungsfigur bleibt Milla genauso eine Pappkameradin wie Kommandant Eric Weston und der restliche Haufen Buddies, die mit dem Raumschiff "Odyssey" durchs All düsen. Sinnlos, weitere Namen aufzuzählen.
Null Ahnung von Physik
Grundsätzlich ist gegen Fantasie-Technik wie Transitionstriebwerke nichts einzuwenden. Die ehrenwerten Einschränkungen der Mundane SF aufs wissenschaftlich Vorstellbare können einem mit der Zeit nämlich auch auf die Nerven gehen. Da macht es durchaus Spaß, wenn uns ein Autor endlich mal wieder in Nullzeit von Sternsystem zu Sternsystem zischen lässt.
... aber derart komplett auf Physik pfeifen wie Currie muss man auch nicht gleich. "Lichtgeschwindigkeit!" Milla war schockiert. Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit oder Annäherungen an Lichtgeschwindigkeit waren innerhalb einer Atmosphäre zwar durchaus möglich, aber sie hatte noch nie von einem Piloten gehört, der bei solchem Tempo noch die Kontrolle über die Maschine behalten konnte. - Tja, jetzt kennt sie welche. Westons Männer düsen mit einem Zehntel Lichtgeschwindigkeit durch die Wolken und steuern dabei gekonnt mit Pedalen, wie jeder gute Autofahrer.
Schwarze Logik-Löcher
Schon bei Filmen gilt: Logik kommt nicht teurer als Unlogik, ein niedriges Budget ist also keine Entschuldigung für Unsinn. Bei Büchern erst recht nicht. "In die Dunkelheit" wirft jede Menge Fragen auf, wenn man sich denn die Mühe machen will. Warum wird der allererste Prototyp eines Überlichtantriebs gleich in ein riesiges und daher vermutlich superteures Raumschiff eingebaut? Warum schickt man überhaupt einen waffenstarrenden "Flugzeugträger" voller Kampfjäger zur wissenschaftlichen Erkundung ins All? (Zum Glück muss rasch gekämpft werden.)
Warum denkt niemand daran, die Erde über die vermutlich wichtigste Entdeckung in der Geschichte der Menschheit zu informieren - nämlich dass da draußen seit Jahrtausenden andere Menschen leben, die eine Art romanische Sprache sprechen? Und warum hüpft die immerhin in Nullzeit reisende "Odyssey" nicht wenigstens dann kurz im Sonnensystem vorbei, als sich abzeichnet, dass die spinnenartigen Drasins nicht nur Millas Zivilisation, sondern auch die Menschheit gefährden?
Für Letzteres reicht Currie eine zynische "Erklärung" nach: Ach, die Erde könnte sich gegen die buchstäblich planetenfressenden Drasins eh nicht verteidigen, da braucht man sie auch gleich gar nicht warnen. Naja, vielleicht könnte man ja zumindest ein paar Leute evakuieren, damit nicht alle Eier in einem Nest liegen, wenn ein Riesenspinnenfuß drauftritt. Nur so'n Gedanke.
Ballern bis der Arzt kommt
Seine Stärken spielt der Roman dann aus, wenn es ans Kämpfen geht. Die ganze zweite Hälfte ist mehr oder weniger eine einzige Schlacht; wir sprechen da von an die 400 Seiten! Ähnlich wie bei Peter Bergs Film "Battleship" schaltet man dann halt das Hirn ab, lässt sich von der Action beballern und vergisst das dümmliche Drumherum.
"In die Dunkelheit" ist ein Plastikbomber von einem Buch. Keine einzige Idee darin ist originell, nicht mal die schlechten. Und wem das alles noch nicht genug war: Im Jänner kommt schon der nächste Band, passend betitelt "Aus der Tiefe".

Greg Bear: "Äon"
Broschiert, 656 Seiten, € 11,30, Heyne 2013 (Original: "Eon", 1985)
Mithilfe erbeten: Ich suche SF-Romane, die das Ende der Sowjetunion antizipiert haben. Nicht im großen Knall eines Dritten Weltkriegs, sondern als so weitgehend unspektakulären Zerfall aufgrund systemimmanenter Mängel, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Immer wieder faszinierend, wie SF-AutorInnen bis praktisch zum Ende hin ganz selbstverständlich Zukunftsvisionen inklusive der Eroberung des Weltraums zeichneten, in denen USA und UdSSR als gleichwertige Akteure auftreten.
Soviel zum angeblichen Vorhersage-Potenzial von Science Fiction ... das ihr ohnehin hauptsächlich Genre-Externe gerne zuschreiben. China hat die SF ja - mit wenigen Ausnahmen wie Maureen F. McHughs "China Mountain Zhang" - auch erst zur Supermacht aufgebaut, nachdem dies bereits in den Schlagzeilen der Wirtschaftsnachrichten zu lesen war.
Die Ausgangslage
Damit wir uns aber nicht missverstehen: Das ist nicht als Kritik an Greg Bears 1985 erschienenem Roman "Äon" gemeint, in dem sich die Sowjetunion zumindest bis ins neue Jahrtausend, also die Handlungszeit, gehalten hat. Im Gegenteil, der ideologische und schließlich bewaffnete Konflikt der beiden Supermächte trägt sogar wesentlich dazu bei, speziell die erste Hälfte des Romans zu einem fantastischen Leseerlebnis zu machen.
Kurz vor der Jahrtausendwende taucht ein etwa 290 Kilometer langer Asteroid über der Erde auf und schwenkt in einen Orbit ein. In kurzen Kapiteln streifen wir die folgenden Jahre, in denen Forschungsexpeditionen zum "Stein" hochgeschickt werden und in den sieben gewaltigen Kammern seines Inneren eine dauerhafte Besatzung etablieren. Federführend agieren die USA; ein paar befreundete Nationen lassen sie teilhaben. Die Sowjetunion hingegen fühlt sich ausgeschlossen und plant eine eigene, bewaffnete, Mission. Die internationalen Spannungen nehmen zu.
Dabei ahnt man unten auf der Erde noch gar nichts von den wirklichen Geheimnissen des Steins. Nämlich dass er aus der (oder zumindest einer) Zukunft kommt. Und dass seine letzte Kammer in einen "Korridor" mündet, der weit über die Grenzen des Asteroiden hinausreicht. Oder die des Sonnensystems ... oder überhaupt die von Raum und Zeit.
Die menschliche Seite
In dieser brisanten Gemengelage bewegen sich die Menschen, die den Asteroiden erkunden sollen. Wie Patricia Vasquez, eine Mathematikerin und theoretische Physikerin. Oder Gary Lannier, der die wachsende Gemeinde von ForscherInnen und Sicherheitsleuten managen soll. Vom politischen Gegner kommt der Offizier Pawel Mirski ... der übrigens nicht nur Tod und Wiedergeburt erleben, sondern im Nachfolgeband auf eine wahrhaft epische Reise geschickt werden wird. Da "Äon" in der Heyne-Reihe "Meisterwerke der Science Fiction" neuaufgelegt worden ist, nehme ich allerdings an, dass es eher bei einem Einzelband bleiben wird. Vom zweiten Band "Eternity" lässt sich in Antiquariaten vielleicht noch die deutsche Ausgabe von 1992 ("Ewigkeit") auftreiben. Den dritten, "Legacy", gibt es nur auf Englisch.
Patricia reist mit einem mulmigen Gefühl an - sie mag sich gar nicht ausmalen, wie ihr abgehobenes Fachgebiet mit dem Untersuchungsobjekt zusammenhängen könnte. Und das ist nur eines der Beispiele für die Atmosphäre wachsenden Unbehagens, die die erste Hälfte des Romans beherrscht. Die schiere Größe des Objekts lastet ebenso auf den ProtagonistInnen wie die vorgefundene Supertechnologie - früher oder später kommt jeder an den Punkt, an dem er aus Überforderung "zumacht", wie es im Roman heißt.
Dazu kommt das Wissen, dass der Stein aus der Zukunft kommt - einer Zukunft, in der genau der Atomkrieg, auf den die Erde mehr und mehr zuzusteuern scheint, tatsächlich stattgefunden hat. Greg Bear verschmilzt damit in meisterlicher Weise so unterschiedliche Elemente wie einen BDO-Plot, Sense of Wonder und die Angst vor einem Weltkrieg zu einem einheitlichen Ganzen. Nicht zu vergessen die symbolhafte Bedeutung des Bildes, in dem sich das alles verdichtet: Ein Stein, der über den Köpfen der Menschheit hängt.
Ideologische Konflikte mit wechselnden Waffen
Wenn es schließlich tatsächlich zu Kampfhandlungen kommt, könnte der Unterschied zum Heldengedudel in Evan Curries "In die Dunkelheit" (siehe vorherige Seite) nicht größer sein. Bear beschreibt ausführlich die Anspannung der Soldaten vor der Schlacht und den Blick über die Leichen danach - der eigentliche Kampf wird nur kurz gestreift. Und auch die Ereignisse auf der Erde erleben wir nur aus dem Off mit. Die Schilderung des Krieges ist hier weit entfernt von jeder heroischen Anwandlung.
Fortschreitende technische und geistige Entwicklung sind übrigens kein Garant für Frieden, wie die zweite Hälfte des Romans zeigen wird. Auch die posthumane Gesellschaft des Hexamon, die den im Superraum eingelagerten Korridor "hinter" dem Asteroiden bewohnt, kennt ideologische Konflikte. Ausgetragen werden sie allerdings mit völlig anderen Mitteln. Kein Wunder in einer Zivilisation, die statt Materie geformte Raumzeit an sich benutzt ... Bear wird die LeserInnen in der Folge mit einer unglaublichen Menge abgehobener Konzepte fordern bis überfordern: Viel Spaß! Da wird "Äon" zu einem Vorgeschmack auf das, was Bear gut 20 Jahre später in "Die Stadt am Ende der Zeit" noch weiter treiben sollte.
Hard SF als Droge
Greg Bear gilt als Vertreter der Hard SF. Allerdings scheinen bei ihm die Grenzen zwischen theoretischer Physik und Metaphysik immer wieder mal durchlässig zu werden - ein Eindruck, den ich bei anderen Vertretern dieser Richtung wie Stephen Baxter, Greg Egan oder Hannu Rajaniemi nie habe. Als Beispiel sei die Rekonstruktion einer in digitalen Fragmenten konservierten Persönlichkeit des Hexamon genannt: Da das Ganze größer sei als die Summe seiner Teile, muss Patricia ihr Mysterium beisteuern, um das Werk zu vollenden und den Gespeicherten wiederauferstehen zu lassen. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Umschreibung der Seele oder des "göttlichen Funkens".
Mir persönlich geht in der zweiten Hälfte des Romans der menschliche Faktor im Mahlstrom der Gestalt annehmenden Abstraktionen und mega-dimensionierten Ereignisse etwas verloren. Das ist aber eine rein subjektive Sichtweise. Wie auch zwei völlig konträre "Äon"-Rezensionen zeigen, die beide eine Drogen-Metapher bemühen. Auf der "SF Site" spricht Alma Hromic in ihrem Verriss von the narcotic effect of overkill. Autor Stephen Baxter hingegen preist "Äon" und spricht von einem sheer ideative sugar rush. Ob man sich von Bears brodelndem Ideen-Labor eher betäubt oder angeregt fühlt, hängt also ganz von einem selbst ab - beeindruckt wird man auf jeden Fall sein.

Michael Haitel (Hrsg.): "Blackburn"
Broschiert, 56 Seiten, p.machinery 2013
Das dürfte das dünnste Buch sein, das ich jemals rezensiert habe. Herrlich. Das ist für sich genommen zwar noch kein Verdienst, den man "Blackburn" seriöserweise anrechnen darf - aber eben doch eine angenehme Abwechslung. Umso mehr, wenn man sich unmittelbar davor durch die Papierziegel von Evan Currie und Greg Bear gefräst hat. Und die sind NICHTS gegen Peter F. Hamiltons bedruckte Kontinentalplatte namens "Der unsichtbare Killer", die ich nach Erhalt gleich mal panisch aufs Jahresende verschoben habe.
... aber zurück zum Thema. "Blackburn" geht auf einen Aufruf des Verlags p.machinery zurück, Stories mit folgender Prämisse einzusenden: Die Schlacht von Mogadischu im Jahr 1993 - verewigt im Film "Black Hawk Down" - ist hier für die USA noch peinlicher verlaufen als in der Realität. Bill Clinton verliert seine beiden (fiktiven) Söhne und greift als Vergeltung zur Atombombe. Das ebenso komprimierte wie knallige Vorwort endet so: Anfang November werden ganz Somalia, Djibuti, der Südosten Äthiopiens und der Nordosten Kenias mit taktischen Neutronenbomben bombardiert, bis kein Leben mehr existiert. Die Amerikaner verlieren das Interesse an der Region. Die Region ist ohne Leben. Schluck.
(Re-)Konstruierte Realität
Von den nur vier Autoren, die es letztlich in die Mini-Anthologie geschafft haben, kannte ich vorab bloß einen (dachte ich zunächst jedenfalls), nämlich Matthias Falke. Der schickt in "Die Mörserstellung" seinen Ich-Erzähler mittels Avatar ins quicklebendige New Mogadischu. Ist's real? Ist's virtuell? Macht das überhaupt einen Unterschied? Die Erzählung ruft ein ähnliches Gefühl von Virtualität hervor, das einem auch die Computerbilder vom Einsatz "intelligenter" Waffen in den Golfkriegen stets bescherten.
Für die, die weit weg und in Sicherheit sind, bleibt eben selbst die real existierende Welt nur eine Ansammlung von Bildern, egal ob zwei- oder dreidimensional. Dazu passt auch eine bezeichnende Ironie am Rande: Nämlich dass im seinerzeitigen Aufruf zum Geschichtenschreiben explizit "Black Hawk Down" und nicht die Schlacht von Mogadischu genannt wurde. Fiktion ist uns vertrauter als Geschichte.
Ausbaufähiges
Zwei andere Erzählungen bewegen sich nicht nur weiter von der Ausgangsprämisse weg, sie leiden auch beide ein wenig darunter, dass sie Elemente kombiniert haben, die nur bedingt zusammenpassen. In "Anomalie" des Österreichers Michael Weinberger bricht eine Frau zu einer Mission auf, um ein großes politisches Unheil mit den Mitteln der Wissenschaft wiedergutzumachen. Immenser Druck lastet auf ihr, die Geschichte scheint für Sense of Wonder und schwermütige Atmosphäre prädestiniert - allerdings huschen auch Monster und Mutanten durchs Bild. Das ließe sich aber noch abgleichen, die Geschichte müsste bloß - das sage ich selten - länger sein.
Der Schweizer Urs Wolf begibt sich in "Homo radians" in eine ferne, niedrigtechnologische Zukunft, die unsere Epoche nur noch als Interregnum der Sesshaften kennt. Ein afrikanischer Nomade gelangt in den fast menschenleeren Alpenraum und findet dort einen Bunker aus alter Zeit, wo er die Geschichte seiner Welt erfährt. Dass der dortige Computer nach all der langen Zeit immer noch funktioniert, ist zwar ebenso wundersam wie die Gekonntheit, mit der der Protagonist ihn bedient ... und dass der einstige Weltkrieg gleich Vulkanismus und Erdbeben ausgelöst haben soll, erscheint auch etwas übertrieben. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Sondern das: Die anfangs stimmungsvolle Erzählung kommt zum Erliegen, wenn die geraffte Welthistorie losrattert. Infodumps sind meist eher notwendige Übel als erzählerische Highlights in SF-Romanen. Wie gesagt: Romanen. Wenn man eh nur wenige Seiten Platz hat, sollte man der eigentlichen Geschichte zuliebe besser ganz drauf verzichten.
Das Highlight
Es sei noch angemerkt, dass in dem Story-Aufruf eigentlich um Utopien gebeten wurde. Also um - trotz Nuklearkrieg - positive Zukunftsentwürfe. Daran scheint sich niemand gehalten zu haben, und am allerwenigsten der zweite hier vertretene deutsche Autor, Merlin Thomas. Der im Anhang nicht nur mit der originellsten Kurz-Bio prunkt, die ich seit langem gelesen habe, sondern mit "Operation Heal" auch die formal wie inhaltlich beeindruckendste Erzählung zu "Blackburn" beigesteuert hat.
Unter dem Beifall der Welt ruft der bald friedensnobelpreisgekrönte US-Präsident zu einer großen Wiederaufbauaktion auf, um die "Wunde in der Welt" zu schließen, die sein Land geschlagen hat. Entwicklungshelfer, US-Army und Embedded Journalists strömen ins verstrahlte Somalia. ProtagonistInnen im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Aus einer raschen Abfolge verschiedenster Dokumente (News-Flashes, Todesbenachrichtigungen, Aufzeichnungen von Sicherheitskameras usw.) setzt sich in ebenso großartiger wie grässlicher Weise nach und nach das Bild zusammen, was wirklich hinter der "Operation Heal" steckt.
Vorfallsrestbelastung ist ein fantastisches Wort für atomare Verseuchung - genauso könnte das klingen, was sich ein PR-Berater für seine Regierung einfallen lässt. Die Geschichte ist ultrazynisch und gerade deshalb so glaubhaft. - Erst nachträglich habe ich festgestellt, dass ich von Merlin Thomas doch schon mal was gelesen habe. Aber jetzt werd ich mir den Namen definitiv merken.
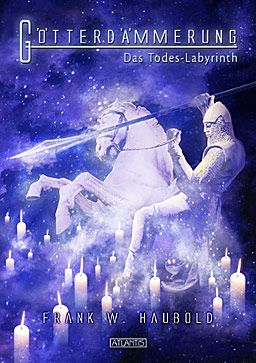
Frank W. Haubold: "Götterdämmerung. Das Todes-Labyrinth"
Broschiert, 275 Seiten, € 14,30, Atlantis 2013
Wie Gandalf so schön sagte: "The board is set, the pieces are moving." Und der hatte es noch vergleichsweise einfach, immerhin war das Spielbrett Mittelerde nur auf zwei Dimensionen angelegt. Hingegen sind es in Frank Haubolds Weltraumoper (durchaus passender Begriff, weil recht viel Kulturverweisgut in "Götterdämmerung" einfließt) nicht nur die drei Dimensionen des Raums. Im zweiten Band der Reihe sieht es auch ganz danach aus, dass sich das große galaktische Spiel auf bislang verborgene höhere Ebenen erstreckt. Die Frage drängt sich auf: Wenn sich vermeintliche Spieler bloß als Figuren entpuppen, wer lenkt dann hier wirklich das Geschehen?
"Das Todes-Labyrinth" schließt unmittelbar an den Vorgänger "Die Gänse des Kapitols" an. Dankens- bzw. notwendigerweise enthält der Roman zu Beginn eine zweiseitige Zusammenfassung des bisher Geschehenen; was unter anderem auch den Umstand umfasst, dass in Band 1 gleich zwei Sterne hochgejagt wurden (dachte man zumindest). Kracher diesen Ausmaßes bleiben der Milchstraße in Band 2 zum Glück erspart. Dafür enthält "Das Todes-Labyrinth" andere bemerkenswerte Action-Elemente: Zum Beispiel ein Duell zwischen einem Raum- und einem Segelschiff(!). Und das Raumschiff ist knapp dran zu verlieren ...
Zur Handlung
Das Geschehen auf der niedrigsten Ebene - also der unseren - ist schnell umrissen. Der mittlerweile aus dem Militärdienst ausgetretene Veteran Raymond Farr bricht zu einer Privatexpedition auf, um Miriam Nagata wiederzufinden: Jene Frau, die ihm dabei half, den Angriff einer Armada biologischer Raumschiffe abzuwehren, diesen dann zu ihrem Heimatsystem folgte und unterwegs verschwand. Aber natürlich will Farr nicht nur Nagata zurückholen, sondern auch klären, warum es zu dem Angriff auf die Menschheit kam und was sich da in der Galaxis gerade für ein Unheil zusammenbraut.
Derweil ist der Detektiv John Varley, der mit Farr in Kontakt steht, mit einer anderen Facette des galaktischen Rätselspiels befasst. Und hat es im Zuge seiner Recherchen ebenfalls mit einer geheimnisvollen Frau zu tun bekommen. Ailin Ramakian nimmt John nicht nur sexuell in Beschlag, sie verfügt offenbar auch über das Wissen - und die Macht - einer höheren Ebene des Seins.
In beiden Handlungssträngen werden die ProtagonistInnen am Ende des Romans nicht mit Siebenmeilenstiefeln vorangekommen sein, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Was natürlich auch heißt, dass die Handlung am Ende bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Im Grunde ist der zweite Band der Reihe immer noch überraschend stark mit Exposition beschäftigt - aber das macht nichts, denn hier ist es, wo sich die interessantesten Dinge tun.
Das Spiel
Neue Player deuten sich an. Da wäre etwa eine Gruppe Künstlicher Intelligenzen von außerhalb der menschlichen Föderation, die ein Konzept für eine strenge christliche Gesellschaftsordnung vorlegt. Als Belohnung für ein wohlgefälliges Leben verheißen sie einen real existierenden Himmel, ansonsten winkt die Hölle (klingt ein wenig nach Iain Banks' "Krieg der Seelen"). Dass an dem Angebot was dran ist, weiß ein Mitglied von Farrs Expedition aus eigener Erfahrung: Pater Markus vom Orden der Heiligen Madonna der Letzten Tage war im Himmel der Maschinen und fühlt sich seitdem wie Tolian Soran nach seinem Nexus-Erlebnis in "Star Trek Generations".
Zweimal lässt uns Haubold an Versammlungen einer (anderen?) Gruppe teilnehmen, die das galaktische Geschehen aus dem Verborgenen mitverfolgt, zugleich aber argwöhnt, selbst unter Beobachtung zu stehen. Wer hinter den Avataren steckt, die sich zu diesen Versammlungen in einem virtuellen Theater einfinden, bleibt zunächst offen. Und dann wäre da noch eine Potentatin, die offenbar sehr intime Kontakte zu einem waschechten Gott pflegt.
Kulturschaffende mitten im Geschehen
Eine besondere Rolle spielt der von Haubold gerne zitierte Dichter Rainer Maria Rilke. Der existiert mittlerweile - Jahrhunderte nach seinen Lebzeiten - an einem zeitlosen Nicht-Ort, von dem aus er Einblicke in das Graue Land nehmen kann: Eine endlose Wüste mit ein paar Oasen, in denen Rilkes Gedichte Gestalt angenommen haben. Doch offenbar führen auch aus unserer Realität Wege ins Graue Land. Auf einem davon ist nämlich niemand anderes als Miriam Nagata eingetroffen und irrt nun durch das Todes-Labyrinth des Romantitels.
Das alles ist zwar etwas seltsam, aber originell. Und Rilke fügt sich ins SF-Szenario auch überraschend gut ein. Dafür hätt's den Auftritt eines Jim-Morrison-Duplikats nicht gebraucht. Fans mögen es mir verzeihen, aber übermäßige Doors-Verweise in SF-Werken münden meiner Erfahrung nach öfter in prätentiösen Schwampf als in eine Bereicherung der Handlung. Und der "Lizard King" tut auch hier nichts, was mich beeindrucken würde. Vielleicht trollt er sich in Band 3 ja wieder so beiläufig, wie er hier eingeschwebt ist.
Entwurzelte Menschheit
Viele verschiedene Kleinigkeiten haben mich auf die Idee verfallen lassen, dass "Götterdämmerung" letztlich tatsächlich ein Spiel im wörtlichen Sinne sein könnte. Mit Menschen und ganzen Planetenbevölkerungen als Spielfiguren. Es würde gut zu dem verlorenen Eindruck passen, den die ProtagonistInnen oft machen: Ein Umstand, der die atmosphärische Wirkung des Romans entscheidend mitprägt.
Entwurzelung ist das Wort, das es vielleicht am besten auf den Punkt bringt. Wie um dies zu illustrieren, scheinen die Menschen dieser Zukunft vorwiegend in nomadisierenden Weltraumstädten zu leben. In Band 2 erfahren wir nun, dass wir uns im 28. Jahrhundert befinden und dass die Erde längst aufgegeben wurde. Doch die Erinnerung an den einstigen Exodus und die Anfänge des Weltraumzeitalters ist im sogenannten Crash verloren gegangen - möglicherweise hat auch jemand dieses Vergessen forciert. Einmal mehr bleibt den Menschen nur eine vage Ahnung, dass sie nicht die bestimmenden Akteure auf der galaktischen Bühne sind.
Die Geheimnisse türmen sich also geradezu, ich bin ehrlich gespannt, wie's weitergeht. Wenn man die vielen metaphysischen Bezüge mal außer Acht lässt und nur das Geschehen auf der menschlichen Ebene betrachtet, dann ist die Reihe "Götterdämmerung" thematisch irgendwo zwischen Alastair Reynolds und Lois McMaster Bujold angesiedelt. Also genau dort, wo ich zuvor Lücken in der gegenwärtigen Übersetzungspolitik von Heyne beklagt habe. Auf jeden Fall ist "Götterdämmerung" dafür ein wesentlich besserer Ersatz als der Schrott von Evan Currie.

A. Lee Martinez: "Der Mond ist nicht genug"
Broschiert, 398 Seiten, € 10,30, Piper 2013 (Original: "Chasing the Moon", 2011)
Sie hatte genug Folgen "Twilight Zone" gesehen, um kosmischen Scheiß zu erkennen, wenn sie mittendrin steckte. So witzig ist A. Lee Martinez' jüngster ins Deutsche übersetzte Roman leider nicht immer. Aber zumindest wird damit recht anschaulich umschrieben, in welcher Situation sich die Hauptfigur von "Der Mond ist nicht genug" unverhofft wiederfindet.
Billig kann teuer kommen
"Sie", das ist Diane Malone, Verkäuferin in der Mantelabteilung eines Kaufhauses - normaler geht's also kaum. Aber dann springt Diane auf ein günstiges Wohnungsangebot an, und das kann ja nur auf ein blaues Wunder hinauslaufen. Mein persönliches Highlight auf dem Gebiet war bislang der Erfahrungsbericht einer Kollegin, die sich eine abgetrennte Wohnungshälfte zur Untermiete angesehen hatte. Boiler und Thermostat waren in der für sie nicht zugänglichen anderen Hälfte geblieben und der Vermieter erkundigte sich auch gleich bei der Vorstellung, wie oft und wann sie denn üblicherweise so duscht ...
Aber natürlich ist das nichts im Vergleich zu den Klauseln in Dianes Mietvertrag. Das Haus entpuppt sich nämlich als eine Art Schnittstelle der Dimensionen, es in Schuss zu halten steht symbolisch für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Multiversum. Vermieter West hetzt Diane daher in eine bizarre Aufgabe nach der anderen, jede davon von apokalyptischer Bedeutsamkeit: Dieses frischgelieferte Paket muss binnen Minuten auf einem Regal abgelegt werden, sonst geht Barcelona unter! Und wenn wir nicht schnellstens den Boiler reparieren, erobern Reptilienwesen unsere Galaxis!
WG der seltsamen Art
Dianes Hauptaufgabe ist es allerdings, einen Mitbewohner zu betreuen, ein allesfressendes Monster im Schrank namens Vorm. Da sie dies nach ein paar Anlaufschwierigkeiten unerwartet souverän meistert, gesellen sich bald weitere Besucher aus fremden Welten dazu: Zap, der aus seinem Riesenauge Todesstrahlen verschießt, und Smorgaz, der neue Rekorde in Sachen Zellteilung aufstellt. Optisch wirken die drei wie etwas, das einem in einem Videospiel entgegenkommen könnte (Generation PacMan bis Donkey Kong) ... und im Grunde beschreibt das auch ihre Plastizität als Charaktere: Der eine frisst, der zweite teilt sich, der dritte glotzt und schießt. Mehr nicht, aber dafür immer wieder. Entsprechend repetitiv sind die Gags, die sie abliefern.
Schon Martinez' vorangegangenen - und deutlich besseren - Roman "Gott im Unglück" habe ich mit einer Sitcom verglichen. Im Falle von "Der Mond ist nicht genug" wäre das wohl "New Girl": Eine junge Frau schlägt sich mit drei egozentrischen Mitbewohnern herum; man sieht gemeinsam fern, streitet über den Kühlschrankinhalt oder geht zum Bowling. Und, ja, dazwischen räumt man halt schnell die Scherben auf, wenn sich mal wieder eine andere Realität mit unserer überlappt hat.
So richtig neu kommt einem der Roman also nicht vor. Aber abgesehen davon, dass "Der Mond ist nicht genug" doch ein wenig wie die Resterampe von "Gott im Unglück" wirkt, ergibt sich ein Problem, das Martinez vielleicht nicht bedacht hat: Es ist zwar beruhigend, dass das Universum eine gewisse Beharrungstendenz hat und nach diversen Kontinuitätsbrüchen - wuppdich! - stets in seinen Ausgangszustand zurückschnellt. Dramaturgisch kann das aber durchaus zum Problem werden: Wenn hinterher eh alles wieder so sein wird wie vorher, ist es letztlich auch wurscht, was dazwischen passiert.
Nicht zu vergessen: Die Apokalypse
Als Handlungsmotor setzt Martinez einmal mehr auf eine drohende Apokalypse. Anderswo in der Stadt lebt nämlich mit Sharon und Calvin eine recht ähnliche Wohngemeinschaft. Nur spielt Calvin in einer ganz anderen Liga, was monströse Machtfülle anbelangt. Er ist Teil des Wolfes, der gemäß der nordischen Mythologie am Ende der Zeiten - heißt im Falle des Romans: sehr bald - den Mond verschlingen wird. Ist ansonsten aber ein durchaus verträglicher Zeitgenosse. Die Huldigungen einer Sekte lässt er mit routinierter Langeweile über sich ergehen, und dass er in sich das Potenzial zur Weltenzerstörung trägt, dafür kann er schließlich nix.
Überhaupt hat Martinez eine Art Anti-Lovecraft geschrieben. Die übernatürlichen Mächte, die hier in unsere Welt vordringen, tun dies ohne böse Absicht. Planlos stranden sie in einer ungewohnten Umgebung - eher Bill Murray in "Lost in Translation" als Cthulhu. Durch einen kurzen, seltsamen Besuch in einer anderen Welt bekommt Diane selbst einen Geschmack davon, wie sich das anfühlt: In dieser Welt ist nämlich sie das Monster und hat, ehe sie sichs versieht, legionenweise Einheimische zerquetscht.
Krude Mischung
Martinez' betont wertfreie Darstellung von Andersartigkeit ist eine interessante Abwechslung zu herkömmlichen Urban-Fantasy-Monsterjagden. Und "Der Mond ist nicht genug" ist auch nicht dumm, wie diverse mythologische und popkulturelle Anspielungen zeigen. Nur hat sich Martinez eben dafür entschieden, weniger auf geistreich als auf ... albern zu machen. Es waren schon Vergleiche mit Christopher Moore zu lesen. Vielleicht müsste man aus England oder den ehemaligen Kolonien stammen, um diese Erzählform angemessen würdigen zu können, für einen Mitteleuropäer ist der Grad an Albernheit jedenfalls gewöhnungsbedürftig.
Der Grundtenor der Reaktionen auf den Roman geht in die Richtung: Okay, aber nicht Martinez' bestes Werk. Dem schließe ich mich an. "Der Mond ist nicht genug" ist der richtige Roman für eine längere Zugfahrt: Hält einen für ein paar Stunden wach; und wenn man das Buch danach im Abteil liegen lässt, ist der Verlust verschmerzbar.

Heinz Zwack: "Nebenweit"
Broschiert, 440 Seiten, € 17,40, Atlantis 2013
Stell dir vor, du landest in einer Parallelwelt und das einzig Grauenhafte, auf das du triffst, ist die Nachricht, dass Bayern München auch hier die Champions League gewonnen hat. Respektive das hiesige Pendant des Bewerbs, mit Anglizismen hat man's in Heinz Zwacks Europawelt nämlich nicht so. Ansonsten ist hier alles einfach ... nett.
Nicht pseudo-nett wie in Stephen Frys "Making History", wo sich dem globalisierungs- und terrorismustraumatisierten Slider eine auf den ersten Blick angenehm friedliche und vernunftgeprägte Welt präsentiert - bis er sich deren politischen Hintergrunds bewusst wird. Oder wie in Lavie Tidhars "Osama": Noch entschleunigter, noch idyllischer ... aber leider halt nur [insert spoiler here]. Nein, in Zwacks "Nebenweit" hat die Sache tatsächlich keinen Haken.
Die Ausgangslage
Die USA gibt es hier nicht, stattdessen ein paar kleinere nordamerikanische Staatengebilde, die Europa in Sachen Lebensstandard hinterherhinken und politisch nichts zu melden haben. Vielleicht auch deshalb herrscht seit langem Friede auf der Welt. Gelegentliche lokale Scharmützel werden von der internationalen Staatengemeinschaft unter der Ägide der Europäischen Föderation rasch beigelegt, und in der gibt Deutschland den Ton an: Kein Nazi-, sondern ein Merkeldeutschland, zumal eines mit höherem sozialem Bewusstsein. Die Nachrichten dieser satten, sympathischen Welt klingen wie die beschönigten Jubelmeldungen aus dem ehemaligen Osten. Mit dem entscheidenden Unterschied allerdings, dass sie hier stimmen.
In diesem Idyll landet eines Tages der Journalist im Vorruhestand und SF-Kenner Bernd Lukas, der aus dem Bayern unserer Welt - der Amerikawelt - stammt. Lukas hat nichts anderes getan, als eine kleine Berghütte am Straßenrand zu betreten und sie nur einen Lidschlag weit entfernt von allem, was er kannte, wieder zu verlassen. Den restlichen Roman wird er damit beschäftigt sein, sich zu sortieren, nach Möglichkeit einen Weg zurück zu finden oder sich gegebenenfalls mit einem Leben hier abzufinden.
Immer die Ruhe bewahren
Das alles geschieht in einem bemerkenswert unaufgeregten Ton, geschuldet vielleicht dem Alter des Autors: Heinz Zwack ist ein langjähriger Übersetzer von Genre-Literatur und hat nun in seinen 70ern sein Debüt als Romanautor gegeben. Auch die Romanfiguren sind überwiegend im gesetzten Alter und reagieren entsprechend gefasst auf die Situation, allen voran Bernd und seine Ehefrau Carol. Genauer gesagt natürlich Carols Pendant in der neuen Welt. Begegnungen mit Leidensgenossen verlaufen ebenfalls ganz im Zeichen der Vernunft - etwa mit einem Japaner, den es ebenfalls in die neue Welt verschlagen hat und der die Geschichte seiner/unserer Welt nun als SF-Romane auf den Markt bringt.
Denn ja: Bernds Rutsch war kein singuläres Ereignis. Es gibt sogar eine Gruppe von Menschen, die bewusst zwischen den Welten wandern können. Diese stammen von Gaelia, einer Erde, die vor einem Jahrtausend von einem Meteoriteneinschlag verwüstet wurde. Die Nachkommen der wenigen Überlebenden haben die Fähigkeit entwickelt zu rutschen, wie Bernd von "Jacques Dupont" alias Obertix erfährt, einem Gaeler, der seit längerem in der Europawelt lebt. Die Gaeler kann man sich als Zwacks Antithese zu den Kromaggs aus der TV-Serie "Sliders" vorstellen: Sie wollen nicht erobern, sondern nur ein bisschen am Wohlstand anderer Welten teilhaben, um ihre Heimat wiederaufzubauen. Und wer könnte ihnen dieses sanfte Schmarotzertum verdenken? Leider macht Obertix Bernd aber auch keine Hoffnung auf eine Rückkehr: Die Gaeler können Gegenstände von Welt zu Welt transportieren, aber keine Passagiere.
Die Ruhe, die "Nebenweit" prägt, ist durchaus eine angenehme Abwechslung zu den vielen Werken mit ähnlicher Ausgangslage, in denen es in einem fort knallt. Trotzdem hätte das eine oder andere Action-Element dem Roman nicht geschadet. Vor allem arbeitet Zwack vor lauter Gutmütigkeit, die das ganze Buch durchzieht, keinen wirklichen Höhepunkt heraus. Was schon wieder ein Kunststück für sich ist, immerhin landen wir zwischendurch auch in einer Germaniawelt, in der die Nazis den Kontinent beherrschen. Einen reißerischeren Hintergrund könnte man sich kaum ausmalen, aber selbst hier bleiben die Geschehnisse eher beschaulich.
Logikmängel
Kommen wir zu den weniger gelungenen Aspekten des Romans. Zum einen wirft die Logik immer wieder Fragen auf. Ist ein netter Gag, wenn man hier statt auf Google auf SUUCH geht. Dahinter regen sich aber sofort Zweifel. Wenn man die ganz spezifische Entstehungsgeschichte des Internets (inklusive seiner militärischen Ursprünge) betrachtet und dann die USA aus der Gleichung nimmt - würde sich dann tatsächlich ein quasi-identisches Weltnetz entwickeln?
Noch deutlicher: Bernd und seine amerikanische Frau haben in beiden Welten gänzlich unterschiedliche berufliche Hintergründe. Wie wahrscheinlich ist es da, dass sie in beiden aufeinander treffen, um sich letztlich dieselben Gartenmöbel zu kaufen? So sehr Europa- und Amerikawelt auf der großen Ebene voneinander abweichen, so sehr zeigen sie auf der kleinen eine verblüffende Neigung zur Konvergenz. Das könnte man noch schlucken (als SF-Leser ist man schließlich Handwaving-"Erklärungen" gewohnt). Aber dafür müsste es zumindest als Phänomen thematisiert werden. Stellt es der Autor hingegen kommentarlos hin, wirkt es einfach nur nicht ausreichend durchdacht.
Ein vermeintlicher Logikfehler ist hingegen keiner: Der Roman ist als Buch-im-Buch angelegt, als Botschaft Bernds an seine daheimgebliebene Originalgattin. Sollte sich also jemand wundern, wie in diesen persönlichen Erfahrungsbericht Kapitel aus den Perspektiven anderer Erzähler einfließen können: Keine Angst, das wird am Ende geklärt (wenn auch nicht so ausgefuchst wie etwa in Jeff VanderMeers genial konstruiertem "Shriek"). Dafür birgt diese Gestaltungsidee eine zynische Note, die Zwack vermutlich nicht beabsichtigt hat: In besagter Buch-Botschaft darf die Carol aus der Amerikawelt nämlich unter anderem nachlesen, wie sich ihr Mann mit ihrer "Zwillingsschwester" vergnügt. Na, die wird begeistert sein. Und kann es ihm noch nicht einmal nachmachen, weil sein Parallelwelt-Pendant [insert another spoiler here].
Wo es knirscht
Das Hauptproblem mit "Nebenweit" liegt für mich allerdings anderswo, nämlich im sprachlichen Bereich. Ich habe erst beim vierten Mal Titel-Lesen bemerkt, dass das Buch gar nicht "Nebenwelt" mit L heißt und dass sich der tatsächliche Titel - siehe Cover - zum gut den Inhalt beschreibenden "Nebenan unendlich weit" entfaltet. Solche sprachliche Kunstfertigkeit sucht man im Roman selbst allerdings vergeblich. Der wird mehr oder weniger einfach runtergeplaudert, ist passagenweise umständlich formuliert und wimmelt nur so vor Wiederholungen und Abschweifungen. Und die Dialoge der Romanfiguren sind auch nicht eben von der organischen Art: So sprechen Menschen höchstens in Scripted-Reality-Formaten miteinander.
Fazit: Einige sehr gute, weil ungebräuchliche Ideen, wozu ich beispielsweise die biografischen Eckdaten der Hauptpersonen (endlich mal ein älteres Ehepaar als Handlungsträger!) und generell den Verzicht auf reißerische Elemente zählen würde. In der Ausarbeitung ist allerdings noch einige Luft nach oben.
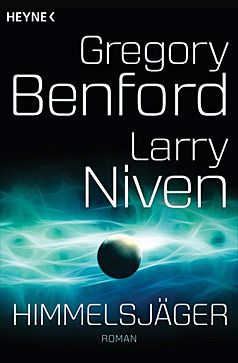
Gregory Benford & Larry Niven: "Himmelsjäger"
Broschiert, 544 Seiten, € 15,50, Heyne 2013 (Original: "Bowl of Heaven", 2012)
Zum Abschluss dieses Monats noch der Hinweis auf einen Roman, den ich hier schon in der Originalversion vorgestellt habe: "Bowl of Heaven". Details zur Handlung also bitte über diesen Link abrufen, hier kann ich mich mit ein paar kurzen Worten begnügen.
Eine Weltraumexpedition startet von der Erde und stößt in den Weiten des Alls auf ein gigantisches künstliches Objekt: Eine "Schüssel", die mit etwa einem Drittel des Abstands zwischen Sonne und Erde einen Stern umgibt und mitsamt diesem durch die Milchstraße zieht. Und auf der Innenseite ist diese Schüssel bewohnt.
Ringwelt reloaded
Klingt bekannt? In der Tat: Star-Autor Larry Niven hat sich einmal mehr seiner populärsten Schöpfung "Ringwelt" besonnen und noch einmal etwas recht Ähnliches produziert. Allerdings schreiben wir nicht mehr 1970 und der Reiz des Neuen ist verflogen. Das zeigt auch der Direktvergleich mit dem zuvor beschriebenen "Äon" von Greg Bear, das immerhin auch schon fast drei Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Bear nahm ebenfalls einen BDO-Plot als Ausgangslage, trieb diesen aber in Dimensionen weiter, where no Niven has gone before. Auch nicht mit Unterstützung des Hard-SF-Kollegen Gregory Benford.
"Himmelsjäger" wird nicht den Olymp der großen SF-Klassiker erklimmen, bietet aber immerhin eine ordentliche Packung Action und Sense of Wonder: Science Fiction der gediegenen Art, wie man sie von zwei langgedienten Veteranen des Genres erwarten kann. Vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen: Die Expedition von der Erde entdeckt die Tassenwelt. Hat das für irgendjemanden denselben mythischen Klang wie Ringwelt? Eben. Sollte die im Original für 2014 angekündigte Fortsetzung (Achtung: "Himmelsjäger" hört mittendrin auf!) ebenfalls auf Deutsch erscheinen, werde ich sie trotzdem gerne lesen.
Es wird tierisch
Und im Dezember kommt dann endlich das Motto, das ich schon im Frühling angekündigt hatte: Tiere. Von weltraumreisenden Walrossen über mörderische Affen und genmanipulierte Delfine (den Brin hab ich natürlich nicht vergessen) bis zu Zombie-Kühen. Also ohne Zombie-Kühe geht einfach gar nichts. (Josefson, derStandard.at, 2. 11. 2013)