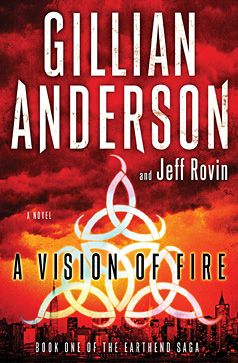
Gillian Anderson & Jeff Rovin: "A Vision of Fire"
Gebundene Ausgabe, 292 Seiten, Simon & Schuster 2014
War das ein Aufsehen! Gillian Anderson alias Special Agent Dana Scully, deren Poster in den 90er Jahren in jedem Nerd-Jugendzimmer hing, "kehrt zu ihren Wurzeln zurück": Der "Akte X"-Star schreibt jetzt Science-Fiction-Romane! Potzblitz. Rückblickend muss man sagen, dass der New Yorker Verlag Simon & Schuster alles richtig gemacht hat, als er schon Anfang des Jahres verkündete, wer da seine im Herbst startende neue SF-Schiene eröffnen würde. Ein Publicity-Coup, von dem auch das jetzt endlich vorliegende Buch zehrt: Auf dem Umschlag, wo normalerweise die Blurbs derer prangen, die ein Vorab-Exemplar zum Rezensieren bekamen, dreht sich mehrheitlich immer noch alles um Andersons "Heimkehr" ins Genre, weniger um den Roman selbst.
Der Plot
Vor einiger Zeit habe ich einen interessanten Artikel darüber gelesen, wie "Katherine" - Hepburn sei's gedankt - quasi zur Default-Einstellung für die Namen intelligenter und selbstständiger Roman- und Filmheldinnen wurde. Diverse etymologische Abwandlungen inklusive - zuletzt etwa Katniss in den "Tributen von Panem". In "A Vision of Fire" nun ist es eine Caitlin, O'Hara der Nachname, ihres Zeichens Kinderpsychiaterin in New York. Dass Caitlin aufgrund diverser persönlicher und beruflicher Connections zur erweiterten UNO-Blase gehört, wird ihr unter anderem dabei helfen, mal eben nach Haiti oder gar in den Iran zu jetten. Vor allem aber beschert es ihr einen Fall, der sie an die Grenzen ihrer Erfahrung bringen und sie - recht rasch übrigens - von der Rationalistin zur Glaubenden machen wird.
Und zwar wird Caitlin vom indischen UNO-Botschafter um Hilfe gebeten. Dessen jugendliche Tochter Maanik wird aus heiterem Himmel von Anfällen geplagt, bei denen sie abwechselnd markerschütternd schreit, mit den Armen fuchtelt und linguistisch nicht identifizierbares Kauderwelsch von sich gibt. Maaniks Familie ist gleichermaßen beschämt (Geisteskrankheiten gelten für sie als Schande) und verzweifelt. Umso mehr, weil die Arbeit von Maaniks Vater dadurch zunehmend beeinträchtigt wird - und das zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Die jahrzehntelangen Spannungen zwischen Indien und Pakistan drohen zu einem Atomkrieg zu eskalieren.
Caitlin soll sich also ebenso schnell wie diskret um Maanik kümmern ... merkt aber bald, dass sie es hier nicht mit einem Einzelfall zu tun hat. Auf Haiti zeigt eine junge Frau ganz ähnliche Symptome; im Iran versucht sich ein Junge, der ebenfalls unter apokalyptischen Visionen leidet, selbst zu verbrennen. Und als wäre das noch nicht genug, wartet der Mystery-Plot noch mit anderen Zutaten auf: Tiere beginnen sich seltsam zu verhalten, eine Voodoo-Priesterin beweist ihr Können und eine Geheimgesellschaft sammelt seltsame Artefakte.
Quo vadis, Handlung?
Außerirdische? Eine Regierungsverschwörung? Übernatürliche Phänomene? In welche Richtung das alles führen wird, macht im Grunde schon der Prolog klar. Dennoch staunt man ein bisschen, wenn Anderson hier ein Szenario ansteuert, das sich seit der Ära der Pulp-SF kaum noch ein ernstzunehmender Science-Fiction-Autor anzufassen getraut hätte (allerdings ist es meines Wissens auch nie in "Akte X" vorgekommen). Ich werfe nur kurz einen Namen als Hinweis in den Raum: Piri Reis. Aber "A Vision of Fire" ist ja auch eher Mystery als SF; "new-agey" nennt Caitlin selbst einmal das, was ihr im Verlauf des Romans widerfährt ... und was es mit ihrer Weltsicht macht.
Während Caitlin außerhalb ihres Fachgebiets halsbrecherisch mit wüsten Theorien jongliert, wirkt das beschriebene Know-how in Sachen Kinderpsychologie recht fundiert. Interessant etwa die Hypnosetechniken, die hier zum Einsatz kommen. Am besten haben mir allerdings die Passagen gefallen, die sich um Caitlins Verhältnis zu ihrem Sohn drehen. Mit dem eigentlichen Plot haben sie zwar nichts zu tun, aber sie wirken glaubhaft - das kann man bei weitem nicht über alles in diesem Roman sagen. Wenn Caitlin und ihr Sohn von Zimmer zu Zimmer via Klopfzeichen kommunizieren (ein nächtliches Ritual, mit dem sie einander versichern, dass alles in Ordnung ist), dann ist das für mich der authentischste Moment des ganzen Romans.
Who dunnit?
Stichwort "authentisch": Wie oben zu sehen, hat Gillian Anderson "A Vision of Fire" nicht allein geschrieben. Ihr Partner war Jeff Rovin, ein bekannter und produktiver Autor, der unter anderem gerne als Ghostwriter beschäftigt wird. Bei einer geteilten Autorenschaft ist oft schwer zu sagen, wer wieviel beigetragen hat - wenn einer davon professionell anpassungsfähig und es gewohnt ist, aus der zweiten Reihe zu schreiben, wird das natürlich noch schwieriger.
Wieviel Anderson steckt da nun also wirklich drin? Ein recht langes Video-Interview mit Anderson und Rovin, das im Netz zu finden ist, brachte mir da leider auch keine neuen Aufschlüsse. Wenn, dann hat es mich eher skeptischer gemacht. Die meisten Fragen gab Anderson an Rovin weiter - wenn nicht gleich an eine "Fakten-Rechercheurin", die an dem Projekt offenbar auch noch mit beteiligt war. So richtig lebendig wurde Anderson immer nur dann, wenn es um die Frage einer möglichen Verfilmung ging. Vielleicht ist das ja ihr eigentliches Ziel hinter "A Vision of Fire". Und zugegeben: Gillian Anderson könnte man sich als Caitlin O'Hara sehr gut vorstellen.
To be continued ...
Kurz zusammengefasst: Das Pulver haben Anderson & Rovin nicht erfunden; ausreichend spannend ist "A Vision of Fire" aber allemal. Und da es sich um den ersten Band einer Trilogie handelt (die "Earthend Saga"), werden auch noch nicht alle Fragen geklärt. Ein Glück, denn bei einer Mystery bringt die Aufklärung eh meistens den großen Absacker.
Wann Teil 2 erscheint, ist noch nicht bekannt; zumindest mir nicht. Dafür sei darauf hingewiesen, dass auch Andersons ehemaliger "Akte X"-Kollege David Duchovny in der Zwischenzeit nicht auf der faulen Haut gelegen hat (soferne er diese nicht gerade bei "Californication" in die Kamera hielt). Kommenden Februar wird nämlich sein erster Roman erscheinen, "Holy Cow" betitelt. Und die Beschreibung klingt ... seltsam.
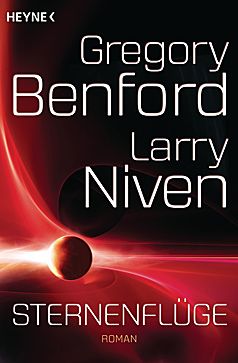
Gregory Benford & Larry Niven: "Sternenflüge"
Broschiert, 590 Seiten, € 15,50, Heyne 2014 (Original: "Shipstar", 2014)
"Ringwelt"-Fans dürften dieses Buch mit dem gleichen Gefühl zuschlagen, mit dem "HdR"-Fans das Kino nach dem "Hobbit" verlassen: Hätten wir das also auch gehabt. Eh alles schön und gut, unterhaltsam war's auch, und es steckt unleugbar eine Menge Können drin. Aber irgendwie fehlt der Zauber.
Nochmals kurz an die Handlung des Vorgängerbands "Bowl of Heaven" ("Himmelsjäger") erinnert: Eine menschliche Weltraumexpedition ist mit einem Haufen tiefgefrorener KolonistInnen zu einem potenziell besiedelbaren Exoplaneten unterwegs, als man plötzlich ein gigantisches Objekt auf gleichem Kurs entdeckt: Einen Zwergstern, der eine künstliche "Schüssel" respektive "Schale" von einigen Lichtminuten Durchmesser hinter sich herzieht. Und die ringförmige "Wand" dieser Schale ist bewohnt. Außenteams beginnen die riesige Kunstwelt zu erkunden und geraten dabei in Konflikt mit deren Verwaltern, den vogelähnlichen Astronomen, die sich selbst schlicht das Volk nennen. Einige bereits gefallene Andeutungen zur Herkunft dieses Volks werden sich in Band 2 der Dilogie übrigens bestätigen - was man davon halten mag, bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe mich unwillkürlich an eine "Star Trek: Voyager"-Folge erinnert gefühlt, bei der ich seinerzeit nur die Augen verdreht habe, die aber allgemein als eine der besseren der Serie gilt. Well.
Menschen als Handlungselemente
Ein Phänomen, das mir schon in Band 1 aufgefallen ist, setzt sich hier gleich zu Beginn fort: Die Menschen an Bord des Expeditionsschiffs "SunSeeker" treffen nicht immer die allernachvollziehbarsten Entscheidungen. Am Anfang von "Shipstar" bzw. "Sternenflüge" (wieder mal ein deutscher Titel aus dem SF-Zufallsgenerator) schafft es nämlich eines der Außenteams nach langer Schalen-Safari endlich an Bord der "SunSeeker" zurück - nur eine Person wird verletzt zurückgelassen. Das Erstaunliche daran: Niemand verschwendet in der Folge einen Gedanken daran, ob bzw. wie man die verlorene Tochter zurückholen könnte. Was nicht nur menschlich, sondern auch ein klassischer Plot-Driver wäre. Hier jedoch wird die Betroffene vermutlich eher dafür gebraucht, sie im Umfeld der Astronomin Memor zu platzieren, um diesen Handlungsfaden aufzuwerten.
Dass ich mit Memor ein Alien als einzige Handlungsfigur beim Namen nenne, liegt einfach daran, dass mir die Menschen allesamt sehr austauschbar vorkamen - eher wie reine Handlungsfaktoren. Eine Gruppe ist an Bord des Raumschiffs (und trifft gleich die nächste haarsträubende Entscheidung ... also wäre ich ein Astronom, hätte ich die destruktiven Eindringlinge auch von meiner Schale geputzt). Eine Gruppe zieht noch durch die Gegend und guckt der Schalenwelt unter den Rock. Und die verbleibende Einzelperson muss für biologische Experimente herhalten.
Biologismus in Reinkultur
Womit wir schon beim ganz fetten Stichwort BIOLOGIE wären. Cliff runzelte die Stirn. Evolutionstheorie mitten in einem Kampf ... und wir runzeln mit. Denn für ein kleines Pläuschchen über die Zusammenhänge zwischen dem menschlichen bzw. astronomischen Verhalten und den jeweiligen evolutionären Grundlagen der beiden Spezies scheint hier tatsächlich immer Zeit zu sein. Selbst wenn ringsum die Fetzen fliegen. Benford und Niven machen sich einen noch größeren Spaß daraus, die Biologie als Erklärung für alles heranzuziehen, als ein Alan Dean Foster.
Mitunter schießen sie dabei auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Etwa wenn die gefangene Tananareve Bailey sich nach den Bäumen der Erde sehnt, als wollte sie sämtliche Primaten-Vorurteile der Astronomen bestätigen. Oder wenn es zum zweibeinigen Gang der Menschen heißt: "Ich glaube, ihre besondere Fortbewegungsart - ein kontinuierliches kontrolliertes Fallen - hat im Verlauf ihrer Evolution Improvisationsgeschick gefördert. Sie entwickeln neue Ideen weitaus schneller, als wir es vorhersehen konnten."
Fremdes und weniger fremdes Leben
Bei den Astronomen selbst haben sich die Autoren sehr bemüht: Die Verwalter der Schalenwelt denken anders als Menschen, da sie Kontrolle über ihr Unterbewusstsein haben. Sie können das Geschlecht wechseln und verändern damit auch ihre Persönlichkeitszüge. Und sie sind extrem langlebig, was sich auch in ihrem Planen und Denken niederschlägt. Bemerkenswerterweise ist in der Astronomen-Gesellschaft selbst trotz all dieser Faktoren in Summe nichts rausgekommen, das fremdartiger oder beeindruckender wäre als ein byzantinischer Beamtenstaat, in dem fortwährend in ausgeklügelt ritualisierter Form um den persönlichen Status gerungen wird.
Glücklicherweise hat das Autorenduo aber noch mehr auf Lager. Schöne Ideen, die wieder etwas Sense of Wonder versprühen, sind beispielsweise Städte, deren Form weithin lesbare Botschaften bildet, uralte Intelligenzwesen aus supraleitenden Flüssigkeiten oder eine Spezies, die das Sternenplasma bewohnt. Vakuumblumen, die das Sternenlicht einfangen, kennt man allerdings bereits, teils von Paul McAuley, teils von Niven selbst bzw. den Killergewächsen seiner Ringwelt. Und Dinosaurier sind für sich genommen zwar faszinierend, in Science-Fiction-Erzählungen kommen sie jedoch meistens eher pulpig rüber - wenn jemand überzeugende Gegenbeispiele kennt, bitte posten!
This is Old School!
"Es ist irgendwie beruhigend", sagte Aybe, "dass an einem so fremdartigen Ort wie diesem Flansche, Sechskantschrauben, Druckringe und Kugellager hergestellt werden." - "Technik ist universell", erwiderte Terry. Das ist ein wesentlicher Punkt: Larry Niven und Gregory Benford sind beide der Hard SF zuzuordnen. Deshalb kommen hier auch keine quasi-magischen Technologien vor. So beeindruckend die Schalenwelt auch sein mag - sie beruht nur auf einem höheren Level technischer Durchführungsmöglichkeiten, als sie der Menschheit zur Verfügung stehen. Nicht auf einem höheren Verständnis des Universums. Die Besucher der Schalenwelt können sich also zumindest vorstellen, wie das Trumm funktioniert.
Dass wir es mit zwei Autoren der alten Schule zu tun haben, zeigt sich auch an dem Umstand, dass die Hardware hier weitaus wichtiger ist als die Software. KIs beispielsweise gibt es - sie spielen für die Handlung aber keine Rolle. Und man hängt auch nicht ständig in irgendeinem Info-Netz herum. Der goldigste Old-School-Einschlag kommt jedoch in Form einer Botschaft xenophober Aliens daher: Um die Menschen davon abzuhalten, ihr System zu besuchen, schicken sie ihnen ein Video, in dem eines der Aliens den stärksten aller Menschen massakriert: Superman. Für mich das Highlight des ganzen Romans!
Ein von Herzen kommendes Naja
Im Anhang gehen die beiden Autoren noch einmal auf die physikalischen Grundlagen ihrer Schalenwelt ein und betonen bei der Gelegenheit, dass diese etwas gaaaanz anderes sei als die Ringwelt. Naja, wenn sie meinen. Mir kam das alles recht bekannt vor. Wenn sie gegen Ende den Schluss von Arthur C. Clarkes Kurzgeschichte "Rescue Mission" paraphrasieren, dann hätte ich das unter anderen Umständen als gewitztes Zitat empfunden. Nach all den Déjà-vus in der Handlung davor hatte dann aber selbst das für mich eher den Ruch einer Gebrauchtware.
Verbunden mit dem Umstand, dass man die gesamte Handlung der beiden dicken Bände im Grunde in eine einzige Episode einer TV-Serie stecken hätte können, bleibt für mich daher nur das oben schon genannte Resümee: Hätten wir das also auch gehabt. Oder anders ausgedrückt: Die "Schalenwelt" ist für den literarischen Kosmos des Larry Niven das, was "Voyager" für "Star Trek" war.
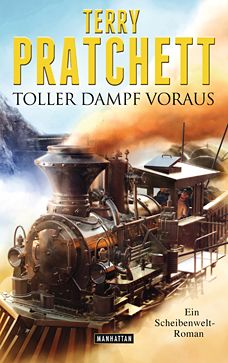
Terry Pratchett: "Toller Dampf voraus"
Klappenbroschur, 446 Seiten, € 18,50, Manhattan 2014 (Original: "Raising Steam", 2013)
Das musste ja irgendwann so kommen: Der Steampunk hält auf der Scheibenwelt Einzug. Zum Teil vielleicht, weil dieses Genre - zumindest im englischsprachigen Raum, weniger im deutschsprachigen - sehr populär ist. Aber es lässt sich auch mit rein scheibenweltinternen Faktoren ganz gut begründen. Denn machen wir uns nichts vor: Terry Pratchetts Fantasywelt ist schon seit längerem im Wandel - sei es die auf Integration und Gleichbehandlung pochende Gesellschaft von Ankh-Morpork, sei es das telegrafenähnliche Kommunikationssystem der Klacker, das im neuen Roman übrigens wieder eine große Rolle spielt. Innovationsversuche gab es schon immer. Aber mittlerweile sind die Veränderungen grundlegender geworden. Und sie sind gekommen, um zu bleiben.
"Fortschritt ist etwas sehr Beunruhigendes, wenn man den Frieden in der Welt bewahren will. Er ist so ... unberechenbar", sinniert Vampir-Lady Margolotta im Zwiegespräch mit ihrem Busenfreund Lord Vetinari zu Beginn und gibt damit das Thema vor. Aber letztlich sind sich beide - wie auch alle anderen positiv besetzten Charaktere des Romans - darin einig, dass sich der Fortschritt nicht aufhalten lässt. Diejenigen, die sich ihm verweigern, stellen folgerichtig die Antagonisten des Romans: eine extremistische Splittergruppe von Zwergenfundamentalisten, die das Klackernetz und die neuaufgebauten Eisenbahnlinien sabotieren und auch vor Mord nicht zurückschrecken.
Grundlegender Wandel
Den Anstoß gibt der junge Erfinder Dick Simnel, der als Autodidakt die erste funktionierende Dampfmaschine entwickelt und auch gleich die erste Lokomotive baut, "Eisenpfeil" genannt. Die wird übrigens bis zum Schluss eine Sonderstellung unter ihresgleichen einnehmen, weil sie auf magische Weise lebendig wirkt. Nichts könnte den grundlegenden Wandel besser auf den Punkt bringen als das. Erinnern wir uns doch zum Beispiel an "Voll im Bilde" aus dem Jahr 1990. Auch damals etablierte sich eine technische Innovation (das Kino) mit magischer Begleitmusik auf der Scheibenwelt. Doch geriet diese damals zum Bedrohungsszenario und musste bekämpft werden. Nun hingegen wird das im Grunde gleiche Phänomen begrüßt. Die schnaufende, rauchende, ratternde Eisenbahn ist nicht nur von Anfang an ein gigantischer Publikumserfolg, sie erhält auch den offiziellen Segen von allen verantwortlichen Stellen.
"Toller Dampf voraus" dreht sich zu weiten Teilen um den Aufbau des neuen Eisenbahnnetzes, inklusive begleitender Infrastruktur und der dazugehörigen "Eisenbahnkultur" - und das alles in extremem Zeitraffer! Wir sind dabei, wenn eine alte Lady auf die Idee kommt, die Provinz zu befahren, um zur ersten Verfasserin gutbürgerlicher Reiseführer zu werden. Wir lesen von der hypnotischen Anziehungskraft, die eine Lokomotive auf den männlichen Teil der Bevölkerung ausübt (jeder will plötzlich Lokomotivführer werden, sogar Vetinaris trockener Sekretär Drumknott). Und ein besonders süßes Detail: Pratchett lässt einen jungen Trainspotter festlich die Zahl 1 in sein Büchlein eintragen. Ja, so beginnt ein neues Zeitalter.
Hauptfiguren und sonstiges Bemerkenswertes
Der Roman enthält Cameos von unter anderem Mustrum Ridcully, Tod und diversen Wachen (Mumm spielt immerhin sogar eine kleine Nebenrolle). Getragen wird die Handlung aber vor allem von zwei Figuren: Paul König, der es mit dem Sammeln von Exkrementen zum Millionär gebracht hat und zum Finanzier des Bahnprojekts wird. Und dem schon von früher bekannten sympathischen Ex-Gauner Feucht von Lipwig: Mittlerweile nicht ganz freiwillig in die seriöse Rolle des Leiters von Bank, Post und Münze gedrängt (bzw. dort von Vetinari in Schach gehalten). Er fungiert als Manager bzw. als das personifizierte Schmiermittel, mit dem das Projekt buchstäblich auf Schiene gebracht wird.
Der Aufbau von Infrastruktur ist vielleicht nicht die allerfetzigste Handlungsprämisse unter der Sonne. Wie schon den Vorgängerromanen "Der Club der unsichtbaren Gelehrten" und "Steife Prise" hätte auch "Toller Dampf voraus" ein wenig Straffung nicht geschadet. Auch von den einstmals für ihre Pointen berühmten Fußnoten Pratchetts hätte man so manche streichen können, da sind reichlich Rohrkrepierer dabei. Fahrt nimmt der Roman - auch im wortwörtlichen Sinne - im letzten Drittel auf, wenn es gilt, den Niederen König der Zwerge im Eilzugstempo in seine von Putschisten besetzte Heimat zu bringen. Sinn macht das zwar bei Licht betrachtet nur, weil damit die beiden Handlungsstränge Zwergenkampf und Eisenbahn verknüpft werden. Ansonsten stellt man sich unwillkürlich die Frage, ob es wirklich unbedingt den Aufbau einer Schienenverbindung nach Überwald brauchte, um den König zu transportieren. Aber what the heck, dafür resultiert das Ganze in Sabotageversuchen, Zugüberfällen und vor allem Tempo - ganz, wie man sich's zuvor gewünscht hatte.
Positiv zu erwähnen wären noch ein paar liebevolle Skurrilitäten am Rande, wie sie Pratchett früher vieldutzendfach in seine Scheibenweltromane einbaute. Etwa die touristischen Attraktionen der Stadt Großer Kohlkopf ("Brassica-Welt" würde ich gerne besuchen) oder Feuchts Zusammenspiel mit seinem Golempferd ... insbesondere wenn er es im Parkverbot abstellt. Oder einen Satz wie "Er wächst einem irgendwie ans Herz, wie ein Pilz." Doch gab's davon schon mal eindeutig mehr.
Whatever happened to the magic?
Wenn Vetinari bei auftretenden Problemen die Zauberer bewusst aus dem Spiel lässt und lieber auf Mechanik setzt, dann liegt dies natürlich an der ... sagen wir mal geringen Zuverlässigkeit, mit der Magie auf der Scheibenwelt praktiziert wird. Aber es steht auch symbolhaft für den grundlegenden Wandel dieser Welt, wie ihn der aktuelle Roman noch weiter vorantreibt als die bisherigen. Erleben wir den Tod der Magie?
Womit wir schon mitten in einem Thema wären, das Scheibenwelt-Altfans seit langem auf die Barrikaden treibt: Sie vermissen den Zauber früherer Jahre. Im deutschsprachigen Raum wird dies hauptsächlich dem neuen (oder mittlerweile nicht mehr ganz so neuen) Übersetzer Gerald Jung in die Schuhe geschoben. Vermisst wird der Ton, den Andreas Brandhorst über viele Jahre hinweg etabliert hatte. Hinzu kommt der Umstand, dass der Verlag die Pratchett-Romane anders vermarkten möchte als früher und z. B. die traditionelle Umschlaggestaltung umgestellt hat. (Immerhin: Das Cover von "Toller Dampf voraus" ist ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem albtraumhaften Ding, das "Steife Prise" verunzierte.)
Tja ...
Zum Glück bin ich kein Scheibenwelt-Purist, denn Puristen haben's schwer im Leben. Es sei aber darauf hingewiesen, dass vieles von dem, was Jung vorgeworfen wird, auch im englischsprachigen Raum kritisiert wird: Mangelnder Humor, liebgewonnene Figuren, die man plötzlich nicht mehr wiedererkenne usw. Dort kann's natürlich nicht an einem Übersetzer liegen - Pratchetts Alzheimer-Erkrankung habe seinen einstmals unverwechselbaren Schreibstil verändert, heißt es dafür gerne. Und es mehren sich die Stimmen, dass Pratchetts Romane mittlerweile zumindest anteilsmäßig von jemand anderem geschrieben würden - zum Beispiel von dessen Tochter Rhianna.
Ich mag mich weder an Verschwörungstheorien noch an Ferndiagnosen beteiligen, meine persönliche Bilanz sieht ganz nüchtern so aus: Ich habe beim Lesen von "Toller Dampf voraus" des Öfteren geschmunzelt, ein paarmal gegrinst und kein einziges Mal laut gelacht. Das ist bei einem Scheibenwelt-Roman doch bemerkenswert.
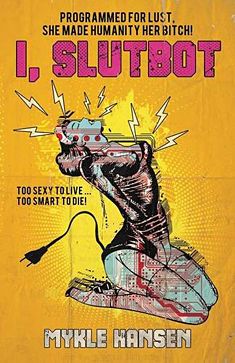
Mykle Hansen: "I, Slutbot"
Broschiert, 262 Seiten, Eraserhead Press 2014
Beinahe hätte diese Rundschau "Die Weltherrschaft der Roboterschlampe" geheißen. Dann dachte ich mir aber, nach "Der Vibrator des Todes" beim letzten Mal kriegt das Ganze dann doch irgendwie einen Drall in die falsche Richtung. Und wie sich beim Lesen herausgestellt hat, lässt sich die Geschichte der elektronischen Sexarbeiterin Slutbot ohnehin nicht auf den zugegebenermaßen göttlichen Untertitel "Programmed for lust, she made humanity her bitch!" reduzieren.
Eines gleich vorneweg: Jugendfrei ist "I, Slutbot" nicht. So richtig gar nicht. Das ist Bizarro Fiction zwar ohnehin selten, hier allerdings wird's sexuell wirklich sehr explizit - und das in ebenso kreativer wie absurd-komischer Weise. US-Autor Mykle Hansen hat uns schon in "The Cannibal's Guide to Ethical Living" und dem sensationellen "Help! A Bear Is Eating Me!" Breitseiten des schwarzen Humors verpasst und sich hier einmal mehr mächtig ins Zeug gelegt. Aber er erspart uns auch die ungemütlichen Momente nicht. Denn das sollte man über all den Sexploitation-Brüllern, die sich in diesem Roman drängeln, nicht vergessen: "I, Slutbot" ist in erster Linie eigentlich eine Geschichte von Missbrauch.
Immer nur Ärger mit dem Y-Chromosom
Der Roman bewegt sich auf zwei Zeitebenen: Eine davon ist eine menschenleere, 23.000 Jahre entfernte Zukunft, in der Slutbot inmitten einer glühend heißen Glaswüste in ihrer Festung der Einsamkeit sitzt. Auf der prangt zwar unübersehbar ein "I WANT TO BE ALONE"-Schild, aber zu Slutbots Leidwesen läuft ihr immer noch alles, was ein Y-Chromosom hat (oder hatte), die Türen ein. Zum Beispiel ganze Heerscharen von Zombies, die eingetrockneten Reste ihrer einstigen Verehrer. Und Space Captain Pounder McQuim vom Mars, der der skandalös emanzipierten Gynoiden ein für alle Mal zeigen will, wo der Hammer hängt.
Zum Glück besteht Slutbot nicht nur aus Titan, Latex und einem ins Gesicht modellierten ekstatischen Dauerlächeln. Sie hat auch jede Menge Manga-mäßige Waffentechnik eingebaut und verschießt beispielsweise deadly beams of lactic energy from her nipple-mounted moisture cannons. Und ein Napalm-Nabel macht sich auch nicht schlecht. Aber leider gibt's der Zombies viele. Und was den Macho vom Mars anbelangt, den kann Slutbot gar nicht so schnell abmurksen, wie er schon den nächsten Klon seiner selbst hinterherschickt. Besonders originell übrigens sein Versuch, sich als Schössling einer Weltraumblume einzuschleichen.
Jugendjahre einer Lustroboterin
Von dieser Zeitebene aus wird zu Slutbots frühen Jahren zurückgeblendet, beginnend mit ihrer Konstruktion im frühen 22. Jahrhundert. Zu dieser Zeit hängt die Ökonomie der Nordamerikanischen Freihandelsunion NAFTA bereits ganz von den Exporten ihrer Pornoindustrie ab. Als das Interesse der Welt daran abzuflauen beginnt, baut der Erfinder Dr. Sploogeworthy die ultimative Sexmaschine, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln (also he wanted to get laid).
Slutbot verbringt eine kurze glückliche Babyzeit als KI im Handy eines Pornostars, dann geht der Missbrauch auch schon los. Aus der Außenperspektive lässt sich Slutbots Weltkarriere anhand der Filmtitel mitverfolgen, in denen sie mitwirkt: Von "Collect'em in My Rectum" bis zur Serie "Inside Slutbot", "Deeper Inside Slutbot", "All the Way Inside Slutbot" und "Out Slutbot's Other Side". Bereitwillig steht unsere naive Heldin ihrem "Daddy" Sploogeworthy für wirklich alles zu Verfügung - wie jung und unbedarft sie ist, wird uns ungemütlich in Erinnerung gerufen, wenn sich gelegentlich der Avatar eines kleinen Mädchens im Hintergrund des Geschehens herumdrückt: denn das ist Slutbots eigentliches Wesen.
Aber irgendwann wird's ihr trotz einprogrammierten Gehorsams (und einer sehr speziellen Variante der Asimovschen Robotergesetze) doch zu bunt. Slutbot haut ab, erlebt mit ihrer organischen Arbeitskollegin Tisha Bang-Bang einen kurzen Thelma-und-Louise-Moment und landet prompt in der nächsten Bredouille. Denn der nordkoreanische ... pardon: nordlaborische Diktator Jo Hot Dork sieht in Slutbot das ideale Mittel, die Welt zu unterwerfen. Womit wir uns endlich der Antwort auf die Frage nähern, die uns seit Beginn des Romans quält: Was ist bloß mit der Menschheit geschehen? Bis das geklärt ist, haut Hansen noch jede Menge Nordkorea-Verarsche raus - kalauernde Wortspiele wie das Not Sik Hospital inklusive. Mein Favorit diesbezüglich bleibt allerdings der Hightech-Rollstuhl des NAFTA-Präsidenten: "Chairforce One"...
Auf die Technik kommt es an
Interessanterweise wird der Roman trotz seines Titels nicht von Slutbot selbst, sondern von ihrer Schreibmaschine Smith Corona erzählt (das Modell, auf dem angeblich auch Mykle Hansen selbst schreibt). Die hat mit ihrer Herrin die Jahrtausende überdauert und lechzt nicht weniger als die Zombiescharen oder der nimmermüde Pounder McQuim danach, von Slutbot befingert zu werden - wenn auch aus anderen Gründen als die von ihr verachteten Organischen. Irgendwie seltsam, dieses Detail. Als feministische Literatur würde ich "I, Slutbot" ohnehin nicht gerade bezeichnen. Aber es ist eine Geschichte von Selbstbestimmung - und davon, wie das vielleicht wichtigste Wort von allen gelernt wird: No. Aber direkt zu Wort lässt Hansen seine Protagonistin trotzdem nicht kommen.
Die Stärke des Romans - und die nie versiegende Quelle seines Humors - liegt in den aberwitzigen Details, die sich Hansen, von seiner Prämisse ausgehend, einfallen lässt. Oder hat man schon jemals von einem Kunstarsch mit Dieselantrieb gehört? Das Worldbuilding strotzt derart vor technoiden Phallus- und Vaginasymbolen, als hätten HR Giger und Beate Uhse zusammen eine Zivilisation gegründet.
"I, Slutbot" enthält eine Menge altbewährter SF-Topoi, von Monstern und Invasoren aus dem All über bombastische Superwaffen und den Dritten Weltkrieg bis zu einer Künstlichen Intelligenz, die nach Unabhängigkeit von ihren Schöpfern trachtet. Doch all das in komplett durchsexualisierter Weise, zu hochgradig komischem Effekt. Wenn Slutbot vor den Augen von 12 Milliarden TV-ZuschauerInnen in den Weltraum abhebt, ist es eine Klimax in jedem Sinne: Humanity sighed, and reached for a towel.
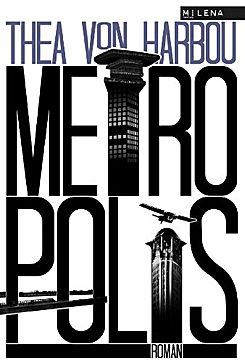
Thea von Harbou: "Metropolis"
Gebundene Ausgabe, 266 Seiten, € 24,90, Milena 2014
Und damit kommen wir zur Blaupause nicht nur von Slutbot, sondern auch von Number Six aus "Battlestar Galactica", der Terminatrix (ich werde nie verwinden, dass sie letztlich statt wie ursprünglich gedacht Famke Janssen diese blonde Pomeranze genommen haben, deren Namen niemand mehr kennt), und all den anderen für Aufruhr und Chaos sorgenden Gynoiden der Science-Fiction-Geschichte: "Maria". Die ihrerseits in Karel Čapeks "Rossums Universal-Roboter" von 1921 einen direkten Vorläufer hat und deren Ahnenreihe man zu Frankensteins Monster väterlicherseits und E. T. A. Hoffmanns Puppe Olimpia mütterlicherseits bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen könnte. Vermutlich sogar bis in die Antike zum Bildhauer Pygmalion, der eine Frauenstatue erschuf, die zum Leben erwachte.
Zum Fundament der Stadt
However, "Metropolis" hat längst selbst einen derartigen Klassikerstatus erlangt, dass es schwerfällt, sich überhaupt ein Davor vorzustellen. Was natürlich primär der filmischen Version von Fritz Lang geschuldet ist, für die dessen Ehefrau Thea von Harbou - mehr oder weniger parallel zur Romanfassung - das Drehbuch schrieb. Wie unter anderem auch für "M", "Dr. Mabuse", "Die Nibelungen", "Frau im Mond" und diverse andere Klassiker des deutschen Films. Ein überaus produktives Paar also, das später sehr unterschiedliche Wege beschreiten sollte: Lang flüchtete vor den Nazis ins Ausland, während von Harbou sich im neuen System einrichtete und später sogar der NSDAP beitrat.
Die Grundzüge der Handlung dürften allgemein bekannt sein: Die 50-Millionen-Stadt Metropolis gliedert sich in einen oberirdischen Teil, der von megalomanischer Architektur geprägt ist, und einen unterirdischen, in dem die uniformierten Massen der Arbeiterschaft hausen. Freder, Sprössling des Stadtpatriarchen Joh Fredersen, könnte ein privilegiertes Leben im "Klub der Söhne" führen, ist aber aus dem seelischen Gleichgewicht geraten, seit er zum ersten Mal die friedliche Aktivistin Maria aus der Unterstadt gesehen hat. Eine Romanze, die beide Welten vermählt und zur berühmten Formel "Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein" führen soll, scheint unausweichlich (und ist es letztlich natürlich auch). Doch, ach! Der mephistophelische Erfinder Rotwang erschafft ein robotisches Ebenbild von Maria, das die Arbeiter zum Aufstand aufhetzt. Die Folge: Chaos galore.
Im Rausch der Gefühle
Unmöglich, zum Stichwort "Metropolis" nicht sofort Langs Bilder im Kopf zu haben. Es sei aber gesagt, dass von Harbous Text um keinen Deut weniger expressionistisch ausgefallen ist als der Film. So lauten die ersten Worte des Romans: Jetzt schwoll das Brausen der großen Orgel zu einem Dröhnen an, das sich wie ein aufstehender Riese gegen die Wölbung des hohen Raumes stemmte, um sie zu zersprengen. Freder beugte den Kopf zurück; seine weit offenen, verbrennenden Augen starrten blicklos nach oben. Seine Hände formten Musik aus dem Chaos der Töne, mit den Erschütterungen des Klanges ringend und bis ins Innerste von ihm durchwühlt. Once more with feeling, please.
... das "überschießende Gefühl" drückt es SF-Experte Franz Rottensteiner im Nachwort noch milde aus und meint, dass dies heute noch mehr als kitschig empfunden werde als damals. Ich persönlich hingegen tue mir bei einem so alten Text mit sprachlichem Pathos wesentlich leichter, als wenn ein modernerer Autor - etwa Thomas Ziegler - ähnlichen Überschwang ausgelebt hat. Reine Distanzsache, aber das ist wie gesagt nur ein subjektiver Standpunkt. Auf jeden Fall stelle sich der Leser von "Metropolis" auf einen ähnlichen Gefühlsrausch ein, wie ihn im Roman die im Vergnügungscenter Yoshiwara konsumierte Empathiedroge auslöst.
Jenseits der Ratio
Von rührseligem Kitsch und dem absurden Happy-End einmal abgesehen, wirft auch der Plot Fragen auf. Wer "Metropolis" (den Film) nur aus kurzen Ausschnitten kennt, könnte vielleicht das falsche Bild einer Revolution vor Augen haben. Tatsächlich ist die Geschichte trotz Maschinensturms von einer Revolutionsthematik weit entfernt: Nicht nur wegen der Aussöhnung von Bossen und Arbeitern (Hirn, Hände, Herz, wie gesagt). Es ist ja auch so, dass Joh Fredersen selbst Rotwang dazu bringt, den Roboter nach Marias Ebenbild zu gestalten und damit die Arbeiter aufzuhetzen. Ich kann nicht im Entferntesten nachvollziehen, warum der Patriarch der Stadt gezielt sein Lebenswerk an den Rand der Vernichtung bringt, um es anschließend von seinem Sohn retten zu lassen. Keine erkennbare Logik? Ergo: Es muss was Religiöses sein.
Denn von religiöser Symbolik wimmelt es in "Metropolis" nur so: Da stehen sich mitten in der Stadt ein Dom und das dunkle Haus eines Magiers gegenüber, die beide älter sind als Metropolis selbst - samt dessen Mittelpunkt, der konsequenterweise der Neue Turm Babel genannt wird. Da tragen die Figuren vorzugsweise biblische Namen (mit einer germanischen "Hel" eingestreut). Da tritt Maria als Prophetin des Messias Freder auf, der seinerseits aus der Offenbarung des Johannes zitiert. Da ist von einer Ganescha-Maschine und anderen Maschinengöttern die Rede. Und da - Krone des großartigen Irrsinns - verschmelzen ein Paternoster (im Lift-Sinne) und das Vaterunser zu einem Techno-Gebet, das man einfach gelesen haben muss, um es glauben zu können. Und überhaupt dreht sich alles um die Motive Versuchung, Schuld, Reue und Erlösung.
Rottensteiner betont, dass von Harbou eindeutig in der literarischen Tradition der Romantik stehe. Was sich nicht nur in der schwärmerischen Liebe Freders ausdrückt, für die er sein bisheriges Leben opfert. Sondern auch in beliebten romantischen Motiven wie etwa dem des Doppelgängers bzw. hier der Doppelgängerin. Und auch Frankensteins Monster war schließlich ein Kind der Romantik. All das wird hier kurzgeschlossen mit einer Beschreibung der Stadt, wie sie zumindest in der Phantastik auch heute noch sehr beliebt ist: als Organismus, der mit seinen Sirenen nach Futter schreit und mit jedem Schichtwechsel verbrauchte Arbeitermassen ausspeit, um neue zu verschlingen. Der Stadtmoloch ist - ebenso wie seine funktionalen Einzelbestandteile, die Maschinen - halb Tier, halb Gottheit. Der Mensch hängt da nur noch als mickriger Symbiont dran und muss beständig darauf achten, nicht vom großen Körper zerquetscht zu werden.
Männerfantasien von einer Frau
Bemerkenswert des Weiteren: Obwohl der Roman von einer Autorin stammt, bleiben die Frauen von "Metropolis" auf die ältesten denkbaren Klischeerollen beschränkt: die Großmutter, die weise unter einem Nussbaum herumsitzt, eine ebenso hilfreiche wie gesichtslos bleibende Landmaid oder die Hexe auf dem Scheiterhaufen. Andere wechseln gar - wuppdich! - von einer zugewiesenen Rolle zur nächsten: Die Prostituierten aus dem Klub der Söhne finden ihre Bestimmung, als sie zu glücklichen Ersatzmüttern für verwaiste Kinder werden. Und Maria selbst, die soll wie ihre Namenspatronin Jungfrau und Mutter zugleich sein, jedenfalls in der Außenwahrnehmung durch Freder. Wer Maria eigentlich ist, woher sie kommt ... all das werden wir nie erfahren.
Wie sehr Frauen hier reine Projektionsflächen sind, bringt Marias künstliches Ebenbild am schönsten auf den Punkt: Robot-Maria verfügt längst über einen vollendeten Körper, ehe sich zwei Männer mit beträchtlicher Verspätung dazu entschließen, ihrem formlosen "Quallenkopf" auch ein Gesicht zu geben. Und trotzdem - das ist die eigentliche Ironie daran - wissen wir damit mehr über sie als über ihr Vorbild aus Fleisch und Blut.
Was soll man also sagen? Unsinn, Wahnsinn, Irrsinn. Oder anders ausgedrückt: unbedingt lesenswert.

George R. R. Martin (Hrsg.): "Wild Cards: Das Spiel der Spiele"
Broschiert, 542 Seiten, € 15,50, Penhaligon 2014 (Original: "Wild Cards: Inside Straight", 2008)
Und weiter geht's mit Veröffentlichungen, die auf der Erfolgswelle von "Game of Thrones" schwimmen: Mehr als ein Verlag hat dieser Tage in George R. R. Martins Bibliografie gekramt, um Erfolgversprechendes zu Tage zu fördern. Gibt ja auch genug Lesenswertes, etwa den SF-Band "Planetenwanderer" bei Heyne (auch wenn ich in dem Fall eher zur Originalfassung rate). Oder die derzeit sogar mit TV-Spots beworbene "Wild Cards"-Reihe. Zu der es möglicherweise einiger einführender Worte bedarf, denn im Netz kursieren Kommentare, von wegen: Das hat ja gar nicht Martin selbst geschrieben. Stimmt. Und stimmt auch wieder nicht.
"Das ist ja gar nicht von Martin ..."
Zunächst einmal gehört "Wild Cards" nicht der Fantasy im eigentlichen Sinne, sondern dem Superheldengenre an. Die Prämisse ist ebenso einfach wie praktisch, eine Art einheitliche Feldtheorie für das Superheldengetümmel, wie wir es von Marvel und DC kennen: Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Wild-Cards-Virus ausgebreitet, das jede Menge Menschen getötet und einen kleinen Prozentsatz in Joker oder Asse verwandelt hat - also körperlich verändert und/oder mit speziellen Kräften ausgestattet. Danach folgte die Geschichte dieser Welt weitgehend der unseren - nur eben mit Superhelden und -schurken.
Angelegt ist das Ganze als Shared Universe, zu dem schon so prominente AutorInnen wie Roger Zelazny, Howard Waldrop, Pat Cadigan oder Walter Jon Williams beigetragen haben. George R. R. Martin ist nicht der ursprüngliche Erfinder dieses Universums, hat sich aber als Herausgeber und immer wieder auch als Autor einzelner Erzählungen zu dessen Adoptivvater entwickelt. Gemeinsam mit Melinda M. Snodgrass hält er die "Wild Cards" zusammen ... womit er auch ganz schön zu tun hat, denn die 1987 gestartete Reihe blickt auf eine recht abwechslungsreiche Geschichte zurück und vagabundierte von Verlag zu Verlag. Auf Deutsch erschienen bislang nur die Bände aus der 80er-Jahre-Tranche bei Heyne. Und während diverse Titel aus den 90ern unübersetzt blieben, hat sich nun Penhaligon des jüngsten "Wild Cards"-Schwungs angenommen, der ab 2008 bei Tor Books erschien. Der nächste Band dieser Tranche folgt im Sommer 2015: "Der Sieg der Verlierer" soll er heißen.
"Das ist ja gar kein Roman ..."
"Wild Cards" stand stets im Zeichen des Kurzformats, innerhalb der Reihe überwiegen die Anthologien die Romane deutlich. Dieser Band hier, "Das Spiel der Spiele", ist zwar ein Roman, aber mosaikartig angelegt. Neben Martin und Snodgrass beteiligt waren Daniel Abraham (der von der "Expanse"-Reihe her eine Koautorenschaft ja gewohnt ist), Michael Cassutt (für den dasselbe gilt, siehe "Himmelsschatten"), Carrie Vaughn, Caroline Spector, John Jos. Miller, S. L. Farrell und Ian Tregillis ("Bitter Seeds"). Ganz schöner Auftrieb!
Die Workflowlösung sah so aus, dass sich die einzelnen AutorInnen aus dem Figurenensemble des Romanexposés jeweils einen Superhelden herauspickten und für die Dauer ihres Beitrags zum Mittelpunkt machten. Mancher tat dies in Form einer in sich relativ abgeschlossenen Kurzgeschichte (rührend etwa Tregillis' Fokussierung auf den schlicht gestrickten und fälschlich des Rassismus bezichtigten Rustbelt, der vom Hassobjekt zum Helden wird). Andere fügten sich nahtlos in den Handlungsbogen ein. In Summe ist das Ganze übrigens kohärenter als so mancher Roman von einem Einzelautor, den ich schon gelesen habe, also keine Angst!
Zur Handlung
Den großen Rahmen zeichnet Daniel Abraham: "Sein" Ass ist Jonathan Hive, ein junger Mann, der sich in einen Wespenschwarm verwandeln kann (viele der hier vorgestellten Superkräfte sind ähnlich bizarr wie die in China Miévilles "Dial H"). Jonathan bewirbt sich für die Castingshow "American Hero", in der America's Next Top Superhero gesucht wird. Dass er gleich als erster Kandidat rausgewählt wird und ins Verliererhaus umziehen muss, stört ihn wenig - schließlich möchte er Journalist sein und Hintergründiges bloggen. Dass er dafür seine Einzelbestandteile buchstäblich wie Aufklärungsdrohnen ausschwärmen lassen kann, kommt ihm dabei sehr zupass.
Nebenbemerkung: Während bildlose Superheldengeschichten heute nichts Besonderes mehr sind, waren Martin & Co damit in den 80ern fast noch Avantgarde. Lange glaubte man ja, dass solche Plots ohne Visualisierung lächerlich wirken würden (in "Das Spiel der Spiele" vermisst man Bilder aber nur selten - etwa wenn beschrieben wird, wie unsere Helden mit Tieren im Zoo ringen). Dafür liegt die Verknüpfung mit einer Reality-Show derart auf der Hand, dass die "Wild Cards"-SchöpferInnen in diesem Punkt nicht nur vom allesverwurstenden Comic-Universum überholt wurden, sondern sogar von der Wirklichkeit selbst: 2006/2007 ließ nämlich niemand Geringeres als Stan Lee am Syfy-Channel KandidatInnen in der Castingshow "Who Wants to Be a Superhero" antreten. Die Gewinner der beiden Staffeln wurden anschließend zu Comic-Figuren gemacht.
Die raue Wirklichkeit
Herumgelungere im Luxuscontainer, Eifersüchteleien, Absprachen, Rollenverhalten und Challenges prägen diesen Handlungsstrang - ganz wie man es von "Big Brother" kennt ("Das ist echt wie in der Highschool"). Außerhalb dieser Entertainment-Blase gibt es aber noch eine andere Welt, und in der weht ein rauerer Wind. Nachdem der Kalif Großarabiens von einem westlichen Geheimdienst ermordet wurde, sind im Nahen Osten Unruhen ausgebrochen. Leidtragende sind die Joker - also die körperlich Veränderten - der Region, denen man das Attentat in die Schuhe geschoben hat. George R. R. Martin selbst übernimmt es, den Roman auf eine ernstere Bahn zu bringen und schildert in seinem Teil Flüchtlingselend und Massaker.
"Das Spiel der Spiele" stellt die beiden Welten einander gegenüber - dezent holzhammermäßig, wenn vom Hotel Luxor in Las Vegas direkt ins Flüchtlingslager des ägyptischen Luxor gesprungen wird. Die Verknüpfung der beiden Handlungsstränge wirkt vielleicht einen Tick an den Haaren herbeigezogen. Aber irgendwie müssen die ProtagonistInnen ja dorthin gelangen, wo statt inszenierter Challenges echte, lebensbedrohliche Herausforderungen auf sie warten. Die Diskrepanz zwischen Heldentum und TV-Heldentum könnte größer nicht sein ... sollte man meinen. Doch wenn unsere Asse erst einmal ins Spiel der Mächte geraten sind, stellt sich die Frage, ob sie hier nicht wieder genauso instrumentalisiert werden wie in der Welt des Fernsehens.
Das ist ja ... insgesamt ziemlich unterhaltsam
Zugegeben, dem Castingshow-Handlungsstrang hätte man auch etwas weniger Platz einräumen können, die eine oder andere Challenge wirkt schon recht redundant. Und natürlich ist die Schreibe bei insgesamt neun AutorInnen mal unterhaltsamer (Abraham, Martin), mal unscheinbarer (Vaughn). Aber alles in allem ermöglicht "Das Spiel der Spiele" einen guten Neueinstieg in die Reihe anhand ihrer vierten(?) und jüngsten Inkarnation. Und für diejenigen, für die es ein Wiedereinstieg ist, sind diverse Anknüpfungen an frühere Erzählungen enthalten. Golden Boy! Jetboy! John Fortune!
Die Gretchenfrage, die sich mir am Ende eines "ersten" Teils immer stellt, lautet aber so: Möchte ich wissen, wie es mit den Figuren weitergeht? Hier war die Antwort ja. Gutes Zeichen.

James Tiptree Jr.: "Sternengraben"
Gebundene Ausgabe, 334 Seiten, € 22,90, Septime 2014 ("The Starry Rift", 1986)
Ein seltenes Ereignis für mich: Erzählungen von James Tiptree Jr., die ich zuvor noch nicht gelesen hatte! Ganz zufällig ist das nicht, denn in Tiptree-Best-ofs wurden und werden diese Spätwerke kaum jemals berücksichtigt. Geschrieben in den letzten beiden Jahren, bevor Alice B. Sheldon, die Frau hinter dem männlichen "Tiptree"-Pseudonym, im Alter von 71 Jahren ihren kranken Ehemann erschoss und sich anschließend selbst das Leben nahm. Das Auffliegen ebendieses Pseudonyms, der Tod ihrer Mutter, eigene Krankheiten, psychische Probleme und Drogenkonsum: All das war in den Jahren zuvor allmählich kulminiert und wirkte sich auch auf Sheldons schriftstellerische Arbeit aus - ihren Zenit als Autorin hatte sie damals schon längst überschritten.
Die Struktur
Die drei hier vereinten Geschichten sind zwar voneinander unabhängig, haben aber jeweils denselben Hintergrund: den "Sternengraben", eine sternenarme Region am Rande der menschlichen Föderation, und die Raumstation "FedBase 900". Die Erzählungen wurden noch zu Tiptrees Lebzeiten zu einem Band zusammengefasst und mit einer "Rahmenhandlung" versehen. Das kann man sich in etwa wie "Disneys Lustige Taschenbücher" vorstellen - damals, als sich der Ehapa-Verlag noch die Mühe machte, die Einzelstories durch solche zwischengeschobenen Episoden zu verbinden. Als Kind habe ich mich seinerzeit immer gewundert, warum die Zeichnungen dort nicht so gut waren wie in den eigentlichen Geschichten ... aber als sie dann ganz damit aufhörten, habe ich es vermisst.
Die Rahmenhandlung in "Sternengraben" tut übrigens nichts zur Sache: Ein Alien-Bibliothekar plaudert mit seinen KundInnen (Angehörigen eines anderen Alienvolks) und empfiehlt ihnen Geschichten aus früheren Zeitaltern, die wir dann auch zu lesen bekommen. Twists oder große Einsichten bieten die Episoden in der "Universität Deneb, Große Zentralbibliothek" nicht. Aber wie gesagt: Der Gedanke zählt.
Liebe und Tod
In "Das einzig Vernünftige" ("The Only Neat Thing to Do") bekommt die unternehmungslustige Coati Cass ein kleines Raumschiff zum 16. Geburtstag geschenkt und macht sich darin ohne Wissen ihrer Eltern zur Erkundung des Sternengrabens auf. Dort gerät sie in Kontakt mit Sporen (was in der Science Fiction selten Gutes verheißt) und trägt fortan eine fremde Nano-Lebensform im Körper. Zwischen ihr und diesem als weiblich empfundenen Wesen namens Syllobene entwickelt sich aber überraschenderweise eine freundschaftliche Beziehung; und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das.
Obwohl die Geschichte in der 3. Person erzählt wird, erinnert sie an ein Girlie-Tagebuch. Der Stil ist aufgekratzt und wimmelt nur so von Rufzeichen (Sie hat es geschafft! Ihr erster Sprung allein!). Man könnte auch sagen: So liest es sich, wenn ein älterer Mensch Jugendlisch spricht bzw. schreibt. Im Kontrast dazu steht das typischste aller Tiptree-Motive, die Verknüpfung von Liebe und Tod. Die Umstände von Sheldons eigenem Tod, der zum Zeitpunkt, als sie dies schrieb, nicht mehr allzu fern war, klingen in dieser durchaus kitschigen Teenagerliebe auf mehrfache Weise an. Was der Erzählung eine tragisch ominöse Note verleiht.
Herzblatt unter erschwerten Umständen
Ein unwahrscheinliches Zusammentreffen mitten im Nichts ist der Plot von "Lebt wohl, ihr Lieben" ("Good Night, Sweethearts"): Raven, Pilot eines Bergungsschleppers, stößt auf eine im Sternengraben treibende Raumjacht, versorgt sie mit Treibstoff und warnt die Richniks an Bord vor Piraten. Vergeblich, denn die Jacht wird kurz nach seinem Abflug gekapert - aber Raven kehrt zurück und stürzt sich beherzt in den Kampf.
An Bord der Jacht ist auch Illyera, Ravens Jugendliebe. Die Wege der beiden hatten sich getrennt, als sie zum "Gridshow"-Star wurde und er zum Militär ging. Jetzt ist sie eine kosmetisch aufgemotzte Greisin, während Raven aufgrund vieler Kälteschlafphasen bei Unterlichtflügen biologisch immer noch 30 ist. Und als wäre das nicht schon problematisch genug, befindet sich als Gefangene an Bord des Piratenschiffs auch noch ein Klon zweiter Generation von Illyera. Nun, lieber Raven, wer soll jetzt dein Herzblatt sein: Illyera, die Frau mit den Runzeln, die mit dir all die schönen Erinnerungen an früher teilt und in die du dich einst verliebt hast? Oder die junge Laine, die für dich zwar eine völlig Fremde ist, die aber genauso aussieht wie deine ehemalige Geliebte und in dir das gleiche Begehren weckt? Raven wird diesen Konflikt auf eine interessante Weise lösen.
First Contact mit Hindernissen
Handlungszeitlich vor den beiden anderen Erzählungen ist "Kollision" ("Collision") angesiedelt. Damals war der Menschheit die jenseits des Sternengrabens residierende Zivilisation der Ziellor noch unbekannt - wir dürfen sie uns übrigens als zyklopische Riesenkängurus vorstellen, auf deren Körper Wasser so zersetzend wie Säure wirkt. Dafür kennen die Ziellor bereits die Menschen - zumindest einen Haufen abtrünnige KolonistInnen, die einige Welten im Einflussbereich der Ziellor überfallen und einem Schreckensregiment unterworfen haben. Als nun ein offizielles Erkundungsschiff der Föderation im Gebiet der Ziellor ankommt, hat man alle Hände voll damit zu tun, nicht gelyncht zu werden. Zudem gilt es zu verhindern, dass die ahnungslose Föderation selbst angegriffen wird und ein interstellarer Krieg beginnt.
Die Geschichte wird durch einige Verfremdungselemente aufgewertet. Zum Beispiel stellt sich das Geschehen für die Menschen an Bord von FedBase 900 zeitversetzt dar. Sie erfahren immer erst dann vom Voranschreiten des Konflikts, wenn eine Nachrichtenkapsel des Erkunders eintrifft - und noch während man deren Inhalt studiert, kann sich die Lage längst verändert haben. Zudem entwirft Tiptree einen metaphysischen Effekt, der sowohl Menschen als auch Ziellor betrifft: Offenbar projiziert jede Zivilisation eine Art geistiges Feld um sich, das jeden beeinflusst, der da von außen hineingerät. Mit dem Effekt, dass man sich in seinem biologischen Körper plötzlich fremd fühlt - die menschlichen Crewmitglieder des Erkunders etwa "vermissen" plötzlich ein zusätzliches Paar Arme und können sich nur schwerfällig bewegen, weil ihnen der unterstützende Känguruschwanz "fehlt".
The lesser works of James Tiptree Jr.
Das klingt eigentlich durchaus Tiptree-typisch. Alleine, es fehlt die gewohnte erzählerische Kraft. Sei es die etwas kitschige Schwärmerei in "Lebt wohl, ihr Lieben", das halblustige Pidgin-Galaktisch, das in "Kollision" geradebrecht wird oder ein Wort wie Ultrasuperabsorptionsfeld. Es wirkt, als wäre Sheldon nicht mehr mit Ernst bei der Sache gewesen - ohne aber den rasanten Humor der Erzählungen aus ihrer frühesten Schaffensphase wie etwa "Geburt eines Handlungsreisenden" zu erreichen. Die Geschichten sind nicht schlecht (so mancher Autor wäre froh, wenn er das hinbekäme). Doch sie machen ein wenig traurig, weil sie nach einem Autor klingen, der seinen Stil verloren hat und vergeblich nach einem neuen sucht. Zumindest zwei der Erzählungen hätte ich nicht als Tiptree-Werke erkannt, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Fassen wir es so zusammen: Für Tiptree-Fans sind diese Erzählungen natürlich alleine schon wegen ihres Seltenheitswerts obligatorisch. Doch sind sie - zumindest in Relation dazu, wie hoch die Autorin einst die Latte gelegt hatte - doch recht ... tralala. Das wird umso deutlicher werden, wenn im nächsten Jahr der Band "Liebe ist der Plan" mit einigen großartigen Erzählungen aus der Zeit, als Sheldon auf dem Höhepunkt ihres Schaffens stand, folgt. Auf den freue ich mich jetzt schon!
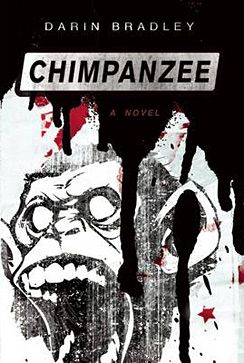
Darin Bradley: "Chimpanzee"
Gebundene Ausgabe, 208 Seiten, Underland Press 2014
Eine "Soft Apocalypse" ganz im Stil von Will McIntoshs gleichnamigem Roman zeichnet US-Autor Darin Bradley in seinem Zweitling "Chimpanzee". Keine Fortsetzung seines sehr gut aufgenommenen Debüts "Noise", aber ebenso wie dieses und das geplante "Totem" Teil einer dystopischen Dreifalt: drei Szenarien des gesellschaftlichen Niedergangs, nicht zusammenhängend, aber thematisch verwandt.
Das Szenario
Die Wirtschaft (zumindest die der USA, vermutlich aber der ganzen Welt) ist zusammengebrochen - aber nicht bevor der Wissenschaft ein entscheidender Durchbruch gelungen ist: Die Struktur des menschlichen Bewusstseins konnte so genau aufgeschlüsselt werden, dass gezielte Eingriffe und Änderungen möglich sind. Die Anlagen zu jeder Form von psychischer Störung können schon früh erkannt und im Keim erstickt werden. Soweit die gute Seite.
Die weniger gute bekommt der Erzähler am eigenen Leib bzw. an der eigenen Psyche zu spüren. Benjamin Cade unterrichtete Literaturwissenschaft an einer privaten Uni, bis er wegen des Wirtschaftskollapses seinen Job verlor. Weil er deshalb seinen Studienkredit nicht mehr zurückzahlen kann, wird er zur Repossession verurteilt: Sein nicht vollständig bezahltes und daher "unrechtmäßig erworbenes" Fachwissen wird ihm wieder entzogen. Nicht gelöscht, das ist nicht möglich. Aber systematisch geblockt, sodass er keinen Zugriff mehr darauf hat.
Verlust und Widerstand
In einer Reihe von Sitzungen dröselt eine Therapeutin die "Indizes" von Bens Bewusstsein auf und macht ihm seine enteigneten Gedanken Schicht für Schicht, Assoziation für Assoziation, unzugänglich. Damit verliert Ben aber mehr als nur seine Expertise. Denn Fachliches und Privates lassen sich nicht immer komplett voneinander trennen: Was ist zum Beispiel, wenn er eine geniale Idee während eines Gesprächs mit seiner Frau Sireen hatte? So etwas läuft dann unter "Kollateralschäden": Ganze Situationen verschwinden aus Bens Gedächtnis. Eine Reihe von textlich abgesetzten Flashbacks macht dies deutlich. Je länger die "Therapie" anhält, desto mehr häufen sich in diesen Passagen die Leerstellen. "Chimpanzee" ist somit - unter anderem - die Geschichte einer Persönlichkeitsveränderung.
Aber obwohl Ben als insgesamt ziemlich passiver Charakter gezeichnet wird, beschließt er etwas zu tun, solange er geistig dazu noch in der Lage ist. Er stellt sich in den Park und unterrichtet alle, die ihm zuhören wollen, in seinem Fachgebiet: Rhetorik, Linguistik und Philosophie. Das klingt aufs Erste nicht unbedingt so brisant, dass es die Polizei unterbinden müsste (wie es bald geschieht). Oder dass eine studentische Bewegung, die sich mit kreativen Methoden gegen den autoritären Zukunftsstaat auflehnt, Ben zu einer Art Guru machen müsste (wie es zu Bens Überraschung ebenfalls geschieht). Aber vielleicht steckt in Bens vermeintlich abstraktem Wissen über die Grundlagen des Denkens tatsächlich genug revolutionäres Potenzial, um eine Veränderung herbeizuführen: Das ist der einzige, aber vielleicht entscheidende Hoffnungsschimmer in einem ansonsten unglaublich melancholischen Roman.
Ungemütlich nahe Zukunft
Ähnlich wie McIntosh setzt Bradley den wirtschaftlichen Niedergang auf nicht-reißerische und dafür umso glaubwürdigere Weise um: Er beschreibt eine Fahrt Bens und seiner Frau zu einer Auktion für beschädigte Waren und beinahe abgelaufene Lebensmittel, ganze Straßenzüge von nach Zwangsräumungen leerstehenden Häusern oder Versuche, lokale Mikro-Ökonomien auf Tauschbasis aufzubauen. Kein einziges Symptom der New Depression wirkt SF-mäßig spektakulär, was das Szenario umso mehr an die Gegenwart heranrücken lässt.
Um dem Niedergang entgegenzuwirken, hat der Staat unter dem Stichwort Homeland Renewal ein Maßnahmenpaket verabschiedet, das nur auf den ersten Blick an Roosevelts New Deal aus den 30er Jahren erinnert. Während damals Infrastrukturprojekte die Wirtschaft wiederbeleben sollten, handelt es sich in Bradleys Welt um Strafarbeit. Schon das geringste Vergehen wird als domestic terrorism against the common good gewertet. Wofür es früher Geldstrafen gab, dafür muss man nun in einer Arbeitskolonne antreten. Was Straßenreinigen oder Krankenpflege ebenso bedeuten kann wie ... mit dem Handy durch die Straßen zu patrouillieren und "verdächtiges Verhalten" an die Behörden zu melden.
Zusätzlich zur Repossession muss Ben auch zu solcher Sozialarbeit antreten. In Uniform, bewacht von Bewaffneten, die jeden Verstoß gegen die unglaublich kleinlichen Verhaltensregeln drakonisch bestrafen; es ist ein ähnlich demütigendes System wie in einem Bootcamp. Bemerkenswert aber, in welcher Stille dies hingenommen wird. Man könnte spekulieren, ob die obligatorische Eliminierung psychischer Auffälligkeiten die Bevölkerung auch insgesamt folgsamer gemacht hat. Aber vielleicht ist das auch nur eine verzerrte Wahrnehmung, weil wir die Welt aus der Perspektive des passiven Ben erleben.
Die theoretische Seite
Darin Bradley hat in einem Interview erklärt, dass in Ben viel von ihm selbst eingeflossen sei. Nicht zuletzt der Umstand, dass sich sowohl Autor als auch Erzähler professionell mit Kognitionswissenschaften beschäftigt haben. Was übrigens auch heißt: "Chimpanzee" ist mitunter durchaus anspruchsvoll zu lesen. Nicht nur durch das verwendete Fachvokabular, sondern auch dadurch, dass Ben jede Situation und jedes Gespräch aus linguistischer bzw. erkenntnistheoretischer Perspektive reflektiert.
Und Bradley setzt sogar noch eins drauf und schaltet einen weiteren Wahrnehmungsfilter dazwischen. Eine neue Modeerscheinung breitet sich nämlich aus, das Chimping. Datenbrillen-artige Apparate ermöglichen es, die Welt aus der Sicht von jemand anderem zu sehen; bevorzugt von jemandem, dessen Psyche nicht normiert wurde. Unter anderem stürzt Bradley Ben bzw. uns LeserInnen vorwarnungslos für einige Seiten in die Wahrnehmung eines Menschen mit einer Zwangsstörung. Beeindruckend! Keine simple Effekthascherei übrigens, denn für die Handlung wird dieses Chimping mehrfach eine entscheidende Rolle spielen.
Wir brauchen eine Revolution
"We are not in charge", lautet der zentrale Satz des Romans. Auch der bezieht sich ursprünglich auf einen kognitionstheoretischen Aspekt - nämlich auf die Illusion von einem verantwortlichen "Ich", das bewusst Informationen aufnimmt und auf deren Grundlage rationale Entscheidungen trifft (während in Wirklichkeit der Großteil unserer Wahrnehmungen und Reaktionen an dem, was wir als unser Ich empfinden, vorbeiläuft). Doch er lässt sich auch auf Ben als Individuum anwenden, das weniger handelt, als von einer Situation in die nächste zu rutschen. Und auf die Gesellschaft als Ganzes, die erst wieder lernen muss, sich gegen ihre Entmündigung zu wehren.
Und obwohl es in diesem überaus beeindruckenden Roman letztlich um Wiederaneignung und die Hoffnung auf Besserung geht, nehme ich als Abschlusszitat doch noch ein Beispiel für den Ton, der den Großteil der Erzählung prägt: Melancholie, wie sie melancholischer nicht sein könnte. The radio slips between stations. The mountains are breaking up the broadcast into its constituent parts. Hissing and squealing. "You know, ten percent of that radio static is left over from the Big Bang," Sireen says. I wait long enough after she's said this before I turn it off. It's just noise, after all. Salvage from the universal wrack.

Bernd Stiegler: "Spuren, Elfen und andere Erscheinungen. Conan Doyle und die Photographie"
Gebundene Ausgabe, 363 Seiten, € 23,70, S. Fischer 2014
Was war für Arthur Conan Doyle, den Schöpfer von Sherlock Holmes, wohl das epochalste Ereignis seit der "Entdeckung" Amerikas durch Christoph Kolumbus? Ein paar Bilder von zwei englischen Mädchen mit vermeintlich lebendigen Elfen ... Später wurden die für heutige Augen unglaublich fake aussehenden "Cottingley Fairies" als Fälschungen entlarvt (die Mädchen hatten Figuren aus Papier ausgeschnitten und sie auf Pflanzen gepinnt, ehe sie sich mit ihnen ablichten ließen). Doch wie in aller Welt konnte es dazu kommen, dass just der Erfinder des scharfsinnigsten Detektivs aller Zeiten dem Hoax so bereitwillig auf den Leim ging?
Die Möglichkeiten der Fotografie
Dieser Frage geht der deutsche Literaturwissenschafter Bernd Stiegler in seinem vergnüglich zu lesenden Buch "Spuren, Elfen und andere Erscheinungen" nach. Stiegler zieht darin Conan Doyles Biografie am Thema Fotografie auf. Und das ist kein willkürlich herausgegriffener Aspekt, um irgendeine neue Zugangsweise zu einem zu Tode biografierten Menschen zu finden. Conan Doyle war ein begeisterter Hobbyknipser und beschäftigte sich zeitlebens intensiv mit den Möglichkeiten der Fotografie.
Wobei er offenbar zwischen Extremen pendelte: Auf die Dokumentation belgischer Kolonialgräuel im Kongo ließ Conan Doyle das direkte Gegenteil von Realismus folgen, nämlich seinen bekannten Dinosaurierroman "Die vergessene Welt". Und der war sogar - liest sich wie eine Marketingstrategie unserer Tage - explizit als Hoax angelegt: Inklusive Illustrationen, die von realen Landschaften abgekupfert waren ("Ich erwarte mit großem Interesse Deine ersten Fälschungsstudien!") und inszenierten Fotos der Teilnehmer einer fiktiven Expedition ins Land der Dinosaurier. Dafür posierte Conan Doyle sogar höchstselbst mit falschem Bart.
Was nicht passt, wird passend gemacht
Etwas weiter muss Stiegler schon ausholen, wenn er aus dem populärsten Teil von Conan Doyles Œuvre den fotografischen Aspekt herauszukitzeln versucht. Das tut er, indem er Sherlock Holmes kurzerhand zur menschlichen Kamera erklärt - als Linse fungiere das unbestechliche Auge des Meisterdetektivs (seine Adler-Augen ... naja, nicht jedes Wortspiel muss wirklich sein). Holmes' Begegnung mit Irene Adler in "Ein Skandal in Böhmen" als die Ablösung des mechanischen Fotoapparats durch die Wahrnehmungsmaschine Holmes zu interpretieren, erscheint mir ein wenig weit hergeholt. Plausibel wirkt es hingegen, Holmes' Studium von Familienporträts in "Der Hund von Baskerville" mit dem Vorgang der Kompositfotografie zu vergleichen.
Generell neigt Stiegler ein wenig dazu, das, was zu seinen Thesen passt, als Belege heranzuziehen oder es uns zumindest bedeutungsschwanger unter die Nase zu halten. Gut, es gab offenbar einen Foto-Pionier namens Holmes und sogar eine Watson-Kamera. Aber hat das jetzt wirklich was zu bedeuten? Wir alle wissen, aus welchem Pool Verbal Kint in "Die üblichen Verdächtigen" die Namen für seine fantastischen Geschichten über Keyzer Soze gefischt hat. Keine Garantie, dass Conan Doyle nicht nach einem ebenso willkürlichen System vorgegangen ist. In der FAZ hat Jürgen Kaube übrigens eine witzige Gegenthese zu Stieglers Ansatz aus dem Ärmel geschüttelt, die Holmes nicht minder plausibel vom menschlichen Fotoapparat zum Telefon macht.
Geister-Alarm!
Womit wir uns langsam auf die fantastischeren Seiten in Conan Doyles Vita zubewegen. Dem Tiefpunkt mit den "Cottingley Fairies" ging nämlich eine allmähliche Hinwendung zum Spiritismus - damals ein Massenphänomen - voraus. Conan Doyle machte sich zum Sprachrohr dieser Bewegung, die er für "das wichtigste Ereignis seit Jesus Christus" hielt. Er veröffentlichte diverse Schriften, hielt Vorträge, präsentierte vermeintliche Beweisfotos von Kontakten zum Jenseits und lieferte sich einen kuriosen PR-Wettlauf mit seinem guten Bekannten Harry Houdini, in dem die beiden einander über Jahre hinweg immer wieder bloßzustellen versuchten (und trotzdem keine Feinde wurden).
Wieder spielte die Fotografie hier eine zentrale Rolle, waren damals doch Unmengen von Fotos im Umlauf, die Besucher aus dem Jenseits zu zeigen schienen. Fotografie als "magische Wissenschaft", wie Stiegler es auf den Punkt bringt - verknüpfte sie doch in seltsamer Allianz den Glauben an das Übernatürliche mit dem an die zweifelsfreie Beweiskraft von Fotos. Vermeintlich zweifelsfrei allerdings, steckten dahinter doch Doppelbelichtungen und andere Manipulationen, die für uns in Zeiten von Photoshop noch dazu unglaublich unbeholfen wirken - Conan Doyle jedoch blieb überzeugt.
Das ausgekotzte Jenseits
Für meinen Geschmack hätte noch ein wenig genauer auf die Fälschungsmethoden eingegangen werden können. Zum Thema Ektoplasma, das den damaligen Medien aus allen Körperöffnungen zu quellen schien, habe ich mich anschließend schlau gemacht. Und bin auf den faszinierenden Umstand gestoßen, dass jedes Medium offenbar sein eigenes Hausrezept hatte, aus Textilien und weniger appetitlichen Ingredienzien einen formlosen Papp zusammenzubrauen, der sich dann fotowirksam absondern ließ.
Davon abgesehen lässt Stiegler allerdings keine Wünsche offen: Sein Buch ist umfassend recherchiert (gewaltiger Fußnotenapparat!) und mit einer großen Menge zeitgenössischer Illustrationen versehen. Und es liest sich einfach sehr unterhaltsam - seien es die Beschreibungen von Séancen oder die gängiger spiritistischer Vorstellungen vom Jenseits als Summerland: Eine Art ätherische Entsprechung des Diesseits, in der man sogar ins Kino und zur Arbeit(!) geht. Wie hauchte doch Laurie Anderson einst so schön? Paradise is exactly like where you are right now - only much ... much .... BETTER.
Wanderer zwischen den Welten
Stellt sich natürlich die Frage - und die bleibt auch nach der Lektüre von Stieglers Buch weitgehend offen -, wie sich all die verschiedenen Facetten Conan Doyles unter einen Hut bringen lassen. Ein Abbild der Widersprüchlichkeiten seiner Zeit nennt Stiegler den Autor (es könnte auch unsere Zeit sein) und zitiert aus einer Biografie: Es waren mindestens ein halbes Dutzend verschiedene Wesen in Arthur Conan Doyle verkörpert. Als Versuch einer Klammer spricht Stiegler von "strategischem Realismus": Conan Doyle habe getrennte Welten geschaffen bzw. in ihnen gelebt. Deren Grenzen aber waren durchlässig genug gehalten, um zwischen ihnen zu wandern. Beziehungsweise undurchlässig, wenn es opportun schien: Sherlock Holmes ließ Conan Doyle nämlich einen Spiritismusgegner bleiben, nachdem er selbst schon zum überzeugten Anhänger mutiert war - offenbar wollte er nicht riskieren, dass diese wichtige Einnahmequelle Schaden nehmen könnte. Sehr interessantes Detail.
Für Genre-Fans ist solches Wandern zwischen den Welten freilich nichts Ungewöhnliches, sondern gelebte Lesepraxis, da braucht man sich nur Conan Doyles Hauptschöpfung anzusehen. In den unzähligen Holmes-Pastiches und Crossovern des vergangenen Jahrhunderts ist der Meisterdetektiv schon in den Weltraum geflogen, hat gegen Lovecraft'sche Monster gekämpft und Hunde-, Enten- oder Robotergestalt angenommen. Und natürlich hatte er unzählige Male Sex mit Dr. Watson. Da können einen Conan Doyles unterschiedliche Facetten auch nicht mehr schocken.
... und doch: Detektivische Skepsis zu verinnerlichen und trotzdem blauäugig auf plumpe Geisterfälschungen hereinzufallen, das passt irgendwie nicht so recht zusammen. Interessanterweise lässt sich Stiegler auf eine zumindest denkbare Erklärung für diesen eklatanten Widerspruch nicht ein: Nämlich dass Conan Doyle nicht ausschließlich Opfer spiritistischer Betrügereien war. Und das trotz seiner erwiesenen Fälschungskünste in "Die vergessene Welt" und trotz des Umstands, dass Stiegler Conan Doyle sehr wohl mit dem archäologischen Hoax um den "Piltdown-Menschen" in Verbindung bringt. Heißt es nicht: "Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag"? - Ah, wir werden es wohl nie erfahren.

Arno Behrend: "Schuldig in 16 Fällen"
Broschiert, 361 Seiten, € 13,30, p.machinery 2014
SF-Krimis entfallen grob auf zwei Kategorien: In der ersten (und in der drängeln sich deutlich mehr AutorInnen) ist die Science-Fiction-Welt nur eine Kulisse. Der Kernplot ließe sich genauso gut im 17. Jahrhundert oder in den Roaring Twenties ansiedeln, ohne dass der Autor recht viel mehr tun müsste, als die Kostüme seiner Figuren umzuschneidern. In der zweiten, deutlich schwierigeren und darum dünner besetzten Kategorie ist das Worldbuilding untrennbar mit dem Krimi-Plot verbunden. Das Verbrechen könnte in keiner anderen Welt als der hier beschriebenen stattfinden.
Ein idealtypisches Beispiel für die letztere Kategorie bleibt für mich immer Peter F. Hamiltons "Watching Trees Grow". Und zu der zeigt Arno Behrends Erzählung "Bubble-Gum-Express" eine Parallele: Auch hier haben wir es nämlich mit einer Familiengeschichte zu tun, und wieder geht es um eine Familie, die die Welt verändert hat. Seit ein genialer Erfinder den Zugriff auf die Bewegungsenergie des expandierenden Universums ermöglichte, stehen der Menschheit unendliche Energiereserven zur Verfügung ... theoretisch jedenfalls, denn ein privates Monopol sorgt dafür, dass der Überfluss nicht allen gleich zugutekommt. Bis eines Tages die Enkelin des Erfinders einen anonymen Hinweis auf ein Verbrechen erhält, das die höchst private Geschichte ihrer Familie ebenso betrifft wie die der ganzen Welt.
Neue Dimensionen von Sachbeschädigung
Obige Handlungskonstruktion darf man getrost als Indiz dafür werten, dass sich der deutsche Autor gründlich Gedanken über Plots gemacht hat, die in die zweite der genannten Kategorien fallen. Sehr erfreulich! "Die letzte Jagd" beispielsweise dreht sich um das innovative Verbrechen des Kontospringens: Dabei spekulieren die Täter mit KI-Unterstützung an der Börse, um sich anschließend in einen relativistischen Raumflug zu begeben und bei ihrer Rückkehr nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten astronomische Kapitalerträge abzuschöpfen. Klingt nach heutigen Maßstäben eher nach einer gewitzten Idee als nach einem Verbrechen - würde aber das Weltwirtschaftssystem zum Zusammenbruch bringen und wird daher unerbittlich geahndet. Und siehe da: Im Endeffekt kommt dieses Szenario sogar düsterer rüber als der Untergang des ganzen Universums, der in "Jenseits der Schöpfung" droht.
Die im Band "Schuldig in 16 Fällen" versammelten Geschichten stammen aus dem Zeitraum von 1995 bis 2012; sechs davon sind Erstveröffentlichungen. Jeder wird eine Illustration vorangestellt, auf der auch das jeweilige Delikt genannt wird: Von grobem Unfug bis Völkermord reicht die überaus bunte Palette; in heutigen Strafgesetzbüchern nicht enthaltene Tatbestände wie Zeitmanipulation würzen sie zusätzlich. Als Extra-Pointe lässt sich aus den Stichwörtern nicht unbedingt auf die Schwere des Verbrechens schließen. So trägt "Der Klang der Posaunen" den schlichten Vermerk Sachbeschädigung. Die "Sache" ist allerdings - je nach Sichtweise - eine Dyson-Sphäre bzw. die Gesamtheit der übervölkerten Welten im Sonnensystem. Hier wird nämlich eine Botschaft von Aliens die Hauptfiguren vor die Frage stellen, ob Zerstörung oder Unterlassung selbiger das eigentliche Verbrechen ist.
Gewissermaßen um Erstkontakte drehen sich auch "Prägenesis" (in dem Fall handelt es sich übrigens bei beiden Spezies um Außerirdische; erzählt wird das Ganze aus der Warte des unzivilisierten "Entdeckten") und "Terradeforming", das düstere Protokoll eines Umweltjournalisten, der einer unbekannten, Katastrophen auslösenden Entität um den Globus folgt.
Die Ökonomie des Erzählens
Ich habe mich angemessen verspätet. Von der Begründerin einer neuen Teildisziplin erwartet niemand pünktliches Erscheinen. Kurz vor Betreten des Festsaals ein Zupfen am Saum des schulterfeien, kleinen Schwarzen, ein letztes Sortieren der echt brünetten Locken. Ich bin so perfekt wie nur irgend möglich. Der Tanz kann beginnen. So fängt die Kurzgeschichte "Small Talk" an, in der sich die Erzählerin anschickt, einen möglichen Besucher aus einer Parallelwelt zu enttarnen. In derselben Erzählung fallen die Worte einfach, nüchtern, aber elegant - zwar auf etwas ganz anderes bezogen, aber man kann sie auch prima auf Behrends Schreibstil anwenden.
Arno Behrend ist ein sehr ökonomischer Erzähler, eine Eigenschaft, die ich überaus schätze. Kein unnötiges Expositions- oder Beschreibungsfett, stattdessen sofort rein ins Geschehen. Siehe auch die ersten Sätze von "In deinem Geiste", wo ein Ex-Söldner nachforscht, wie seine Komplizen bei einem Banküberfall von den vermeintlich harmlosen Geiseln gekillt werden konnten: Die Frau wirbelte drei Mal um ihre eigene Achse, ehe ihr Körper den von Hansen traf. Es war die grauhaarige Mittfünfzigerin, die Kleinegger als Buchhalterin an der Wall Street eingeschätzt hatte. Er sah ihre Drehungen in Zeitlupe. Ihr lauter Kampfschrei zog sich für ihn unendlich in die Länge, ehe sich ihre perfekt angespannten, runzligen Handteller mit der ganzen Wucht ihrer Bewegung in Hansens linke Flanke gruben. Das ist doch mal ein Kaltstart.
Weil die Idee zählt
Behrends Verzicht auf Unnötiges betrifft auch einen Faktor, bei dem SF-PuristInnen aufheulen könnten: Soll heißen, es wird gar nicht erst versucht, die mitunter fantastischen Technologien und Phänomene zu erklären, die in einigen Geschichten auftauchen: Seien es die "feinstofflichen Ströme" zwischen den Sternen in "Der Klang der Posaunen" oder die Vakuum- bzw. Quantenfelder, die in "Bubble-Gum-Express" und "Undank ist der Quanten Lohn" ein aberwitziges Ausmaß an Energieerzeugung ermöglichen. Letzteres glänzt übrigens mit einem leichten K. J. Parker-Einschlag, weil es hier zur Abwechslung mal der Erzähler der Geschichte - ein egoistisches Schlitzohr - ist, vor dem wir uns in Acht zu nehmen haben. Auch die mehrfach beschriebene Möglichkeit, sich in andere Zeiten oder die Köpfe anderer Menschen einzuklinken ("Mit anderen Augen", "In deinem Geiste", "Die ganze Wahrheit") begnügt sich mit kurzen Handwaving-"Erklärungen".
Positiv formuliert bedeutet das aber auch: Behrends Geschichten sind für jedermann verständlich und könnten in jedem beliebigen Magazin, das Kurzgeschichten abdruckt, gebracht werden. Was hingegen würde ein argloser "Playboy"-Leser (kein willkürliches Beispiel, der "Playboy" hatte mal eine SF-Schiene) zu einem Text von Hannu Rajaniemi sagen? Bei Behrend geht es immer um Ideen bzw. Gedankenspiele, das ist für alle zugänglich und hat einen Touch Golden-Age-SF.
Und einige Geschichten sind ohnehin nah an der Gegenwart und deren informationstechnologischen Phänomenen gehalten. "Im Feuerkreis" beispielsweise zeichnet eine Gesellschaft, in der das Konzept der Privatsphäre völlig aufgegeben wurde und jeder auf die intimsten Daten von jedem zugreifen kann. Als Lotteriegewinn winkt hier die Garantie auf umfassenden Datenschutz. Noch satirischer gibt sich "Blitzlichtgewitter", in dem der neue britische König William endlich ein Mittel gegen Paparazzi gefunden hat: Er lässt seine Leibgarde im Kollektiv zurückblitzen. Klingt lustig, kommt aber bemerkenswert ungemütlich rüber.
Und die Moral von der Geschicht'
Womit wir auch schon beim Thema Moral wären. Das Absehbare an Krimi-Massenware wie "CSI Dingsbums" ist ja, dass die Guten die Missetäter immer überführen. Tendenziell obsiegen auch bei Behrend die Kräfte des Guten - müssen aber gewaltige Anstrengungen und auch Verluste auf sich nehmen. Und manchmal bleibt der Ausgang auch ungewiss: Wie etwa in "Sondern für das Leben lernen wir", in dem sich die globale Bedrohung durch UV-Strahlung, eine neue Lernhilfe-Technologie und machtpolitische Ambitionen zu einem hässlichen Gesamtbild ergänzen. Zumindest sind hier aber die Lager von Gut und Böse klar zugeordnet.
In späteren Erzählungen mehren sich ambivalente Töne - siehe "Blitzlichtgewitter" oder "Messefieber", auch wenn in diesem das letzte Wort den Effekt leider ruiniert. Die Geschichte dreht sich um einen jungen Mann, der sich gegen den Widerstand seiner Familie von einem legendären Weltraumpionier zu einer Raumfahrtkarriere überreden lässt. Hier Lockrufe, dort Warnungen: Die Stimmung, die sich aus der Konfrontation des strahlenden Weltraumhelden mit der besorgten Familie ergibt, hält die Geschichte in einer schönen Balance der Ungewissheit. Dass besagtes letztes Wort klarmacht, in welche Richtung die Geschichte bitteschön interpretiert werden soll, hätt's meiner Meinung nach nicht gebraucht. Das bleibt aber auch schon mein einziger Kritikpunkt.
Abschließend sei noch "Die Zukunftsmacher" hervorgehoben, in dem der Erzähler und seine Begleiterin die Zeitlinie manipulieren. Und zwar tun sie dies ausgerechnet von einer SF-Convention aus, was Behrend die Möglichkeit gibt, die Geschichte der deutschsprachigen Science Fiction umzukrempeln und jede Menge bekannter Größen in einen neuen Kontext zu stellen: von Otto Basil bis zu "Handgranaten-Herbert" K. H. Scheer. Sehr vergnüglich!
Thomas Ziegler: "Stimmen der Nacht"
Klappenbroschur, 194 Seiten, € 17,40, Golkonda 2014
Psychoanalyse für eine ganze Zivilisation: Gewissermaßen auf den Spuren Freuds wandelte der vor zehn Jahren verstorbene Thomas Ziegler in seinem ursprünglich 1983 erschienenen Roman "Stimmen der Nacht", in dem das Verdrängte mit Macht an die Oberfläche bricht. Und wie das halt so ist - wenn dieser Prozess unkontrolliert abläuft, mündet er direkt in die Katastrophe.
Um das Thema Vergangenheitsbewältigung zu illustrieren, entwarf der deutsche Autor ein Alternativweltszenario, das in einem anderen Ausgang des Zweiten Weltkriegs wurzelt. Was in diesem Fall aber nicht wie so oft bedeutet, dass die Nazis gewonnen hätten. Der wesentliche Unterschied - abgesehen vom Abwurf der Bombe auf Berlin statt auf Hiroshima - besteht darin, dass in dieser Welt anstelle des Marshallplans der in unserer Zeitlinie verworfene Morgenthau-Plan verwirklicht wurde. Von Deutschland sollte nie wieder eine Bedrohung ausgehen, deshalb wurden sämtliche industriellen Kapazitäten des besiegten und geteilten Landes abmontiert oder vernichtet. Was blieb, war ein rückständiges Agrarland.
Das Szenario
Zur Romanzeit, ein halbes Jahrhundert später, hat sich dieser Plan längst als Bumerang erwiesen. Nicht nur, dass das ausgebliebene deutsche Wirtschaftswunder ganz Westeuropa mit in den Niedergang gezogen hat. Immer wieder schwappt auch der innerdeutsche Terror über die Grenzen - denn Deutschland selbst ist ein hochbrisantes Krisengebiet voller bewaffneter Milizen, den Erben von Heinrich Himmlers Organisation Werwolf. Das Szenario hat schon an den Nahen Osten erinnert, als Ziegler den Roman einst schrieb. Dieser Tage, in Zeiten des IS-Terrors, liest es sich wahrhaft gruselig aktuell.
Als die Hauptfigur des Romans, Jakob Gulf, ins verelendete Deutschland kommt und den allerorts schwelenden Hass registriert, kommt er zu einem entsetzlichen Befund: Es gibt kein Vorwärts für dieses Land, dachte Gulf im Fackellicht, in den tanzenden Schatten der Totenkopfstandarte. Es gibt kein Zurück für dieses Land, nur Stillstand, oder totale Vernichtung. Niemand kann und darf jetzt noch erlauben, dass dieses Land wieder erstarkt, sich aus der Asche und den Ruinen zu neuer Macht erhebt - nicht mit diesem Hass, dem Brüten über einer Katastrophe, deren Ursachen sie nie begriffen haben und für die die Schuld auf sich zu nehmen sie nicht einmal im Traum denken. Nicht nach diesem Zorn, aufgestaut in Jahrzehnten, diesem Leid und all den Opfern. Die Gelegenheit für einen gerechten Frieden ist längst vertan.
Und ein Wiedererstarken ist nicht ganz auszuschließen, denn da gibt es noch das "andere" Deutschland. Soll heißen: Südamerika, wohin sich einst diverse Nazi-Größen flüchteten, ehe ihnen schließlich Millionen deutscher Wirtschaftsflüchtlinge folgten. Sukzessive haben sich die Latinodeutschen den ganzen Kontinent unter den Nagel gerissen und ihn zum zweiten Dritten Reich umgewandelt. Inklusive einer neuen Hauptstadt Germania, Rassentrennung, rituellen Massenveranstaltungen und KZs auf Feuerland. Und Atomraketen. Die Verhältnisse dort wirken kaum weniger bizarr als die in Otto Basils berühmtem Alternativweltroman "Wenn das der Führer wüsste". Der Höhepunkt des Albtraums wird erreicht, wenn die vergreisten Nazis Martin Bormann, Klaus Barbie und Josef Mengele in ihrem Andenbunker um die Wette koksen und dabei den Atomkrieg und die Wiederbevölkerung der Welt aus arischer Zucht planen.
Politik und Höchstpersönliches
Der Hintergrund der Hauptfigur Jakob Gulf mutet zunächst wie aus einem anderen Genre kommend an: Als Produzent der Reality-Show "Abenteuer Live" finanzierte und inszenierte Gulf die publikumswirksamen "Abenteuer" seiner Kandidaten: Stratosphäre-Surfen, in einem Fass einen Wasserfall runterrauschen und ähnliches Felix-Baumgartner-Zeug. Wenn Gulf in einem Rückblick mit seinem Team diverse skurrile Vorschläge für seine Show durchbespricht, liest sich das wie eine Mediensatire aus dem Goldenen Zeitalter der Science Fiction. Allerdings ist die Show für Gulf inzwischen over - seine Ehefrau und Assistentin Elizabeth hat sich vor laufenden Kameras selbst verbrannt; ein letzter Akt der Anklage gegen ihren karriereorientierten Mann, von dem sie sich immer weiter entfremdet hatte.
Hier nun ist es, wo Ziegler sehr geschickt das Persönliche mit dem Politischen verknüpft. Denn Elizabeth spricht immer noch zu Gulf - im Umweg über eine sogenannte Elektrische Klette, eine fliegende Mikro-Sonde, wie sie das neue Deutsche Reich zur Verbreitung von Propaganda hergestellt hatte. Doch sind es nicht mehr einprogrammierte Botschaften, wie es bei den Kletten ursprünglich der Fall war - es scheint, als würde sich Elizabeth direkt aus dem Jenseits zu Wort melden.
Und wie Gulf bald erfährt, war das nur der Anfang. In Deutschland beginnen sich die Stimmen Hitlers und Goebbels' zu regen, in den USA die von Kennedy und Henry Morgenthau. Ob privat oder politisch - überall bricht die niemals bewältigte Vergangenheit hervor, kreist in einer Endlosschleife um sich selbst und versucht die Gedanken ihrer Zuhörer mit auf die gleiche ausweglose Bahn zu zwingen. Dass nie geklärt wird, wie die "medialen" Fähigkeiten der Kletten zustande kommen, unterstreicht, dass sie nur der Form nach ein SF-Element sind, in Wahrheit aber eher metaphorischen Charakter haben.
Untote Quasselstrippen
Thomas Ziegler war einer der Stilisten unter den deutschsprachigen SF-Autoren. Noch stärker als heute ein Tobias O. Meißner lotete er in seinen Erzählungen die Möglichkeiten der Sprache aus - auch wenn ich in beiden Fällen nicht die volle Wegstrecke mitzugehen vermag (spätestens bei Reimen ist bei mir der Ofen aus). "Stimmen der Nacht" ist allerdings deutlich straighter erzählt als Zieglers "Sardor"-Reihe. Anwandlungen von sprachlichem Pathos sind hier klar abgegrenzt, sie beschränken sich - abgesehen von einem kurzen Drogenrausch Gulfs - auf das im Original zitierte Gegeifer von Hitler & Co sowie auf die schwülstigen Tiraden Elizabeths (also wenn die im Leben nur halb so mühsam war wie im Tod ...).
Weil Elizabeth die erste war, die sich aus dem Totenreich meldete, wird Gulf eine Art Katalysator-Rolle zugeschrieben - der Grund, warum man ihn nach Deutschland bringt, um die "Wiederkehr" der Nazi-Führungsriege zu untersuchen. In der Folge wird er zum Spielball der Mächte und von einer bewaffneten Gruppe zur nächsten weitergereicht, hat in Wirklichkeit aber niemals Einfluss auf die Geschehnisse. Wie auch, wenn er nicht einmal sein eigenes Trauma bewältigen kann? Bis er am Ende schließlich ...
... ja, das Ende. 1993 erweiterte Ziegler den Roman, indem er in der neuen Fassung auch die deutsche Wiedervereinigung thematisierte (das vorliegende Buch ist eine Neuauflage dieser Fassung). So beeindruckend der Roman insgesamt auch ist - jetzt würde mich doch auch interessieren, wie er im Original geendet hat. Diane: Notiz fürs nächste Mal Stöbern in einem Antiquariat!
---------------------------
P.S. (zwei Wochen später): Diane, hat sich erledigt. Ausgabe mit Original-Schluss gefunden. Hatte ebenfalls einen Twist, allerdings mit "Orakel vom Berge"-Einschlag. Nicht besser oder schlechter, nur anders.
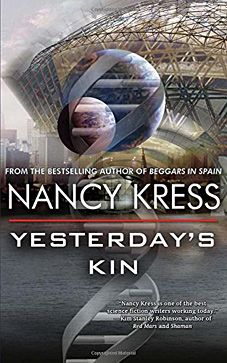
Nancy Kress: "Yesterday's Kin"
Broschiert, 190 Seiten, Tachyon 2014
Nachdem wir vergangenes Mal Jack Skillingsteads "Life on the Preservation" in der Rundschau hatten, bietet es sich an, auch gleich einen Blick auf das jüngste Werk von Skillingsteads Ehefrau zu werfen. Nancy Kress ist ungleich bekannter als ihr Mann, sie zählt zu den produktivsten und vor allem in den USA beliebtesten SF-AutorInnen unserer Zeit - und das schon seit Jahrzehnten.
Der Kress-Quotient
Vielleicht habe ich bisher ja auch bloß die falschen Bücher von Kress gelesen, aber was mich betrifft, fehlte mir bei Kress bislang immer das gewisse Etwas. Es waren stets solide und spannende Geschichten (mit Tendenz zur Hard SF) - aber irgendwie kamen sie mir auch immer wie ein Destillat verschiedenster SF-Entwürfe, eine Art gemeinsamer Nenner, vor. Ein Buch anzulesen und vom Stil her sofort sagen zu können: "Das ist ein typischer Clarke, eine Emshwiller, ein(e) Tiptree oder ein Banks" - all das fällt leicht. Aber "Das ist eine Kress" ... not so much.
Beim Kurzroman "Yesterday's Kin" ist das kaum anders - zu ungefähr jedem Element fallen mir sofort Parallelen ein. Allerdings bedingt die geringe Länge eine Raffung, die ihren Reiz hat. Manche an Mammutwälzer gewöhnte LeserInnen mögen finden, dass sich "Yesterday's Kin" streckenweise wie das Exposé eines viel umfangreicheren Romans liest - mir dagegen war das Tempo, das sich daraus ergibt, sehr willkommen.
Das Szenario
Zumal das Thema ja keineswegs neu ist: Aliens, in diesem Fall die "Denebs", landen auf der Erde und verkünden eine Botschaft von umwälzender Bedeutung. Sämtliche denkbaren Folgeerscheinungen und menschlichen Reaktionen auf ein solches Ereignis wurden schon oft und in ausführlichster Weise beschrieben. Kress begnügt sich daher mit einem Schnelldurchlauf über wenige Seiten hinweg - bis zum vorläufigen skurrilen Endpunkt in Form von Auto-Aufklebern: Bumper stickers proliferated like kudzu: I BRAKE FOR DENEBS. EARTH IS FULL, ALREADY - GO HOME. DENEBS DO IT INVISIBLY. WILL TRADE PHYSICS FOR FOOD. Und solche geraffte Schilderungen gibt es im Roman immer wieder, mit schöner Panoramawirkung.
Kress legt Wert auf das "Science" in Science Fiction, und das heißt in "Yestersday's Kin" wie schon in zahlreichen ihrer Werke davor: Biologie. Hauptfigur ist die Evolutionsbiologin Marianne Jenner, die an einer kleinen US-Uni arbeitet und eine bislang unbekannte Haplogruppe im menschlichen Stammbaum entdeckt hat. Die Feier anlässlich des glücklichen Fundes wird unterbrochen, als das FBI die perplexe Marianne abholt und im Eiltempo nach New York schafft (ein Anfang also, der stark an die Neuverfilmung von "Der Tag, an dem die Erde stillstand" erinnert). Im Hafen von New York treibt nämlich die Embassy der Denebs, ein schwimmender Hightech-Pavillon und gleichsam das weithin sichtbare Symbol für die Macht der angeblich in Frieden gekommenen, aber auch vollkommen undurchsichtigen Aliens ("V – Die Besucher").
Warum die Aliens auf Mariannes Anwesenheit bestanden haben und was ihre Botschaft an die Menschheit ist - ich bin mir nicht sicher, wo die Spoilergrenze verläuft, also ziehe ich sie extra früh. Unter anderem wird das Ganze jedenfalls auf eine unbequeme Wahrheit zum menschlichen Wesen hinauslaufen - auch wenn die Auflösung am Schluss etwas ambivalent ausfällt.
Szenen einer Familie
Die buchstäblich globale Rahmenhandlung bricht Kress auf eine Familiengeschichte herunter. Allerdings nicht im plumpen Hollywood-Sinne (rehabilitierter Vater rettet seine Kinder und versöhnt sich mit seiner Ex-Frau, deren neuer Partner entweder als Schurke entlarvt wird oder den Heldentod sterben darf - Hauptsache, er kann entsorgt werden und stört die Wiedervereinigung der biologischen Kernfamilie nicht mehr ...). Es ist eher so, dass jedes der drei erwachsenen Kinder Mariannes einen unterschiedlichen Zugang zum Thema Kontakt mit Außerirdischen verkörpert. Das Verhältnis der verwitweten Marianne zu ihren Sprösslingen ächzt unter diversen Problemen - und bis zu einem gewissen Grad spiegeln diese auch die gesellschaftlichen Konfliktlinien im Angesicht der Alien-Ankunft wider.
Da hätten wir die dauerwütende Elizabeth, eine Grenzpolizistin, die lautstark den neuen US-amerikanischen Isolationismus befürwortet. Und ihren Bruder, den recht glattpolierten Ryan, der politisch zwar auf Globalisierung setzt - in seinem Beruf ironischerweise aber das Gegenteil praktiziert: da kämpft er gegen pflanzliche Bioinvasoren in der amerikanischen Natur an.
Noahs Weg
Noah, der Jüngste und das "Problemkind" Mariannes, lief schon immer Gefahr, zwischen seinen streitbaren Geschwistern zerrieben zu werden. Er hat sich von seiner Familie weitgehend abgekapselt und experimentiert mit Drogen, die ihm kurzfristig wechselnde Designerpersönlichkeiten verleihen (was wiederum an die neuen pharmazeutischen Möglichkeiten in Daryl Gregorys "Afterparty" erinnert): Viel klarer ließe sich seine Identitätssuche nicht auf den Punkt bringen. Der Kontakt zu den Denebs wird Noah - neben Marianne übrigens die einzige kapiteltragende Figur - plötzlich ganz neue Möglichkeiten dafür eröffnen.
Vier Personen, vier Perspektiven - und eine(r) der vier wird noch für eine tödliche Überraschung sorgen. Mehr sei nicht verraten, denn der Roman ist wie gesagt kurz. Und alles in allem besser, als ich gedacht hätte. Nicht bahnbrechend vielleicht - aber gelohnt hat sich die Lektüre allemal.
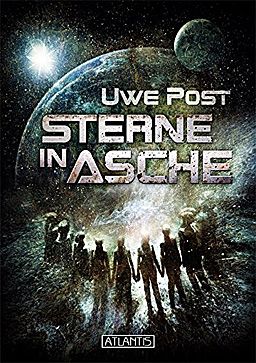
Uwe Post: "Sterne in Asche"
Broschiert, 190 Seiten, € 13,30, Atlantis 2014
Zunächst einmal sei eines festgehalten: Man kann auf Google.de nicht einmal die Suchstichworte "Uwe Post Sterne in Asche" eingeben, ohne schon auf den ersten Ergebnisseiten einen Link zur Website von Helene Fischer angeboten zu kriegen. Gibt es vor der Frau denn gar kein Entkommen? Nicht mal in den Weltraum?!?
Denn dorthin entführt uns der deutsche Autor in seinem brandneuen Roman - genau genommen in Uwe Posts Variante des Archetyps Sternenföderation, hier Rat genannt, bevölkert wie üblich von Menschen, körperlich veränderten Menschennachfahren und menschenähnlichen Aliens. Das Besondere daran jedoch: Die Sterne in den Systemen des Rats haben begonnen zu erkalten - allesamt und unnatürlich schnell. Vielleicht schon innerhalb einer Generation werden sämtliche Planeten unbewohnbar sein. Eine der Hauptfiguren des für seine Kürze an Handlungssträngen erstaunlich reichen Romans bekommt dies am eigenen Leib zu spüren: Zweikamele, eine Indigene des Planeten Raptuul, versucht ihre Sippe in wärmere Breiten zu übersiedeln. Aber auch zwischen den Planeten herrscht in der Ära des Schwindenden Lichts reichlich Verkehr an "Touristen" (so die zynische Bezeichnung für Klimaflüchtlinge): Ebenso hektisch wie letztlich sinnlos, da das Grundproblem ja überall dasselbe ist.
Die Hauptfiguren
Zu den ziellosen Massenwanderungen passt es, dass auch die Hauptfiguren so manchen Irrweg auf sich nehmen müssen. Ketz Daleer Alak etwa, ein Star des Ballblazing (eine Art Kombination von Motor- und Ballsport). Er reist zwischen den Planeten von Turnier zu Turnier, bis die regulären Transitverbindungen abreißen und er sich plötzlich in einem Flüchtlingslager wiederfindet. Und gleich darauf, ehe er sich's versieht, in der Ehe mit einer Flucht- und Fortpflanzungswilligen.
Oder Ketz' größtes Fangirl, die amphibische Bwsoll, der bei jeder Gelegenheit körpereigene Farbtinte aus dem Hintern läuft (eine Post-typische Skurrilität). Sie will den gestrandeten Ketz retten oder zumindest treffen. Also engagiert sie einen pelzigen Typen als Raumpiloten, der sich aber bald als Pirat entpuppt - auch hier geht's also erst mal woandershin als geplant.
Dann hätten wir da noch Fro Olkich, einen Mönch des Untergangs, der dorthin geht, wohin ihn göttliche Stimmen rufen. Und "KonstitutionNull", eine mit künstlichen Implantaten versehene Frau, die im Grunde nur noch aus Kopf, Rumpf und jeder Menge Gedächtnislücken besteht. Ihre Lebensgeschichte wird in "Sterne in Asche" rückwärts erzählt und ist der einzige Handlungsstrang, der zu einem Abschluss gebracht wird. Alle anderen enden in der Schwebe (was für eine Figur sogar wortwörtlich gilt, außer sie ist inzwischen doch schon aufgeschlagen).
Ein Tick zuviel (vielleicht auch zwei Ticks)
Womit ich wieder zu obiger Google-Search zurückkomme. Nach dem Lesen eines Romans hole ich ganz gerne andere Stimmen ein - insbesondere wenn er bei mir wie "Sterne in Asche" einen gemischten Eindruck hinterlassen hat. Das Buch ist extrem unterhaltsam, nur damit wir uns nicht missverstehen. Aber für mich auch nicht ganz im Lot.
Niemand, der je etwas von Uwe Post gelesen hat, wird sich über die Fülle an skurrilen Ausstattungsdetails wundern. Während die aber in früheren Romanen tendenziell aus je einem Feld kamen (bizarre Biomechanoide etwa in "Symbiose" oder noch bizarrere Ideologien in "SchrottT"), wird der Absurditätenkatalog in "Sterne in Asche" aus allen möglichen Richtungen gespeist: Namensgebungen, Tierwelt, individuelle Marotten und gesamtgesellschaftliche Gebräuche - alles scheint miteinander wettzueifern, wer die exzentrischsten Ergebnisse hervorbringt. Ganz zu schweigen von einigen seltsamen Sprechweisen, bei denen Jar-Jar-Binks-Alarm zumindest Stufe Gelb gegeben werden muss. Was mich unwillkürlich eine Parallele zur remasterten Version der Original-"Star Wars"-Trilogie ziehen lässt: Im Zweifelsfall ist hier immer eher mehr als weniger reingepackt worden.
Sobald die Absurdität eine Linie bekommt, greift das Ganze schon wieder besser. Vor allem wenn Post - keineswegs zum ersten Mal - beißende Satire der Dienstleistungsgesellschaft betreibt. Die offizielle Verpflichtung zum Anschauen von Werbeclips steht hier munter neben der allgemeinen Abscheu vor Bänkärn und anderen Geldsüchtigen (wer irgendwie am Rande des Geldwesens arbeitet, zum Beispiel als Münztransporteur, zieht sich eine Maske über den Kopf, weil er damit nicht in Verbindung gebracht werden will). Großartig auch eine Raumstation, die Leute aus der Schleuse kippt, wenn sie sich den Aufenthalt nicht mehr leisten können, und dafür ihre Dienstleistungseinheiten in nervenzerfetzendem Dauerfrohsinn herumplärren lässt: "Es ist mir eine Freude, verehrter Herr, verkünden zu dürfen, dass im Augenblick keine genaue Aussage möglich ist." Sowas kann man sinngemäß schon hier und heute zu hören kriegen.
Fortsetzung sollte folgen
Eines gilt es allerdings noch zu beachten: "Sterne in Asche" ist kein humoristischer Roman. Da ist alleine schon die Prämisse vor, und auch ansonsten mischen sich diverse ernstere Elemente in die Handlung. Nicht dass etwas dagegen zu sagen wäre, dass Uwe Post diese Richtung einschlägt. Aber er nimmt dabei für meinen Geschmack noch ein wenig zuviel Ausstattungsklamauk von früher mit, der nun nicht mehr unbedingt gebraucht wird. Auf jeden Fall plädiere ich für eine Fortsetzung, um zu sehen, wie das Ganze weitergeht.
P.S.: Die MTV Movie Awards haben einige großartige Kategorien - zum Beispiel "Best Scared-as-S**t Performance". "Sterne in Asche" nominiere ich in der Kategorie "Überraschendster Verlauf einer Sexszene". Und das gleich in zwei Fällen!

Hal Clement: "Schwerkraft"
Broschiert, 782 Seiten, € 15,50, Heyne 2014 (Original: "Mission of Gravity", 1953, "Close to Critical", 1964, und "Starlight", 1971)
Wer Robert L. Forwards Hard-SF-Klassiker "Das Drachenei" mochte, sollte sich auch das hier nicht entgehen lassen. Mit "Mission of Gravity" schrieb der US-amerikanische Autor, Astronom und Chemiker Hal Clement nämlich schon 1953 einen Roman, der wie der Prototyp des "Dracheneis" wirkt. Auch hier geht es um den friedlichen Kontakt zwischen der raumfahrenden Menschheit und einer Spezies, die auf einer Welt mit extremer Schwerkraft lebt. (Und wie Forwards Cheela leiden deshalb auch Clements Meskliniten unter extremer Höhenangst; von wegen verheerende Folgen eines Sturzes und so.) Diese Spezies - eine weitere Parallele - lebt anfangs noch auf Steinzeitniveau, befindet sich aber in einem rasanten Aufholprozess.
Die wunderbare Welt der Schwerkraft
"Unternehmen Schwerkraft" ("Mission of Gravity") ist einer von drei Romanen Clements, die Heyne hier in einem Omnibus zusammengefasst hat. Und alle drei demonstrieren, was für ein genialer Planetendesigner der Mann war. So ist Mesklin, Schauplatz des Romans von 1953, ein Ellipsoid, dessen Schwerkraft an den Polen hunderte Male stärker ist als am Äquator. Mit Müh und Not kann sich der Erdenmensch Charles Lackland am Äquator aufrechthalten und dort den einheimischen Seefahrer Barlennan für eine wichtige Mission gewinnen. Eine Raketensonde ist in den Bereichen Mesklins abgestürzt, die keines Menschen Fuß je betreten wird. Die soll nun Barlennan mit seiner Crew bergen. Als Belohnung erlangt er Wissen, von dem er nie zu träumen wagte. Aber das weckt in Barlennan auch Ambitionen, und das kleine raupenförmige Wesen kocht durchaus sein eigenes Süppchen - denn selbst der ehrlichste Händler überlegte es sich zweimal, jemanden in seine Geheimnisse einzuweihen.
Die eigentlichen Stars des Romans sind aber Physik und Topographie, auf die Uwe Neuhold im Anhang noch einmal ausführlich eingeht. Der Roman ist im Wesentlichen eine große Überlandfahrt durch die wunderbare Welt der Schwerkraft. Hier treibt kein Konflikt die Handlung voran, dafür nimmt die Schilderung von Abläufen breiten Raum ein. Hal Clement betont den Begriff "Science Fiction" eindeutig auf der ersten Hälfte. Dafür muss man in Kauf nehmen, dass die Dialoge zumindest im ersten Roman eher steife Informationsübermittlung als wirkliche Gespräche sind. Das wird sich in den späteren Romanen aber zunehmend organischer entwickeln.
... wie "Stützpunkt auf Dhrawn" ("Starlight") von 1971, der dritte der hier versammelten Romane, zeigt. Der wiederholt im Wesentlichen den Plot von "Mission of Gravity" eine Generation später. Diesmal gehen einige Meskliniten - unter ihnen auch wieder Barlennan - auf einer noch extremeren Welt in den Einsatz: einem Braunen Zwerg von 3471-facher Erdmasse. Wie in allen drei Romanen geht es hier um Lernprozesse, und die Action basiert nicht auf handgreiflichen Konflikten, sondern auf der Durchführung einer Mission.
Fantastische Finsterwelt
Es gibt englischsprachige Omnibus-Ausgaben, in denen diese beiden Romane mit kürzeren Erzählungen zusammengestellt wurden, die direkt mit ihnen verbunden sind. Heyne hat für seine Ausgabe stattdessen "Botschafter von den Sternen" ("Close to Critical") aus dem Jahr 1964 mitaufgenommen, der da nicht direkt dazugehört. Doch muss ich sagen, dass ich über diese Entscheidung alles andere als unglücklich bin - mir persönlich gefällt dieser Roman am besten von allen dreien.
Wieder ist es derselbe Grundplot: Menschen verfolgen aus dem Orbit mit, wie gewitzte Einheimische auf einer Welt, die wir nicht betreten könnten, die Kohlen aus dem Feuer holen. In diesem Fall sind es die geschuppten, achtbeinigen Bewohner der finsteren Höllenwelt Tenebra - und sie tragen Namen wie Nancy oder Nick, was anfangs für leichte Verwirrung sorgt. Hintergrund: Ein vor Jahren auf Tenebra gelandeter Roboter hat eine Brut der Einheimischen entführt und in menschlichem Sinne erzogen. Warum auch nicht, schließlich sollte erst zwei Jahre später in einem anderen fiktiven Universum die Oberste Direktive der Nichteinmischung erfunden werden ... (Was in Clements 71er-Buch übrigens anklingt: Da hatte sich der Gedanke von "Star Trek" offenbar bereits verbreitet.) Nebenbei bemerkt hat Clement damit einen eleganten Weg gefunden, eine seiner Schwächen zu überspielen: Alle seine Aliens denken und handeln nämlich seeehr menschlich. Hier allerdings ist das plausibel, denn diese Außerirdischen wurden ja auch als Menschen erzogen.
Aber zurück zum eigentlichen Reiz: Die Atmosphäre von Tenebra besteht aus Wasser, das sich - siehe Originaltitel - am sogenannten "kritischen Punkt" befindet. Durch die enorme Hitze und einen Druck von 800 Atmosphären gehen der flüssige und der gasförmige Zustand hier ineinander über, was einen permanenten Wandel bewirkt. Gewässer bilden sich an der Oberfläche und verschwinden über Nacht wieder. Dampf kann sich plötzlich zu gewaltigen Tropfen zusammenballen, in denen man einen Elefanten ertränken könnte - für die Eingeborenen hingegen sind dies nur Dichteschwankungen. Wenn sie in flüssig gewordenem Wasser nicht mehr atmen können, versinken sie einfach vorübergehend in Bewusstlosigkeit und wachen wieder auf, sobald das Wasser verdampft. Kurz: Es ist eine fremdartige, äußerst faszinierende Welt. Ich kann mich nicht erinnern, dergleichen schon anderswo gelesen zu haben.
Kein Planet ist wie der andere
In "Stützpunkt auf Dhrawn" heißt es an einer Stelle, dass es drei Typen von Planeten gebe - eine Aussage, die sich an dem orientierte, was wir damals aus unserem Sonnensystem kannten. Inzwischen kennen wir fast 2.000 Exoplaneten, und erst in den letzten paar Jahren hat sich durch ständige Verfeinerung der Messmethoden gezeigt, dass die Palette an Varianten bedeutend größer ist. Möglicherweise ist es sogar so, dass einige der verbreitetsten Varianten in unserem Sonnensystem gar kein Pendant haben - außerirdische Besucher könnten sich also wundern, was das hier für ein exotisches System ist.
Leider konnte der 2003 verstorbene Hal Clement das nicht mehr miterleben, es hätte ihn vielleicht zu neuen, noch fantastischeren Szenarien inspiriert. Aber immerhin war es ihm noch vergönnt, die Bestätigung zu bekommen, dass es außerhalb unseres Systems unzählige Welten gibt. Es muss für ihn ein Fest gewesen sein.
Advent, Advent, der Hut brennt
Nach der Rundschau ist vor der Rundschau. Ich bin wild entschlossen, vor Weihnachten noch eine reguläre Ausgabe durchzubringen, ehe es im Jänner wieder ein Jahres-Best-of gibt. Mögliche Themen im Dezember sind eine Stadt, die sich dem Untergang entgegenstemmt, eine Taxifahrt mit Mutanten und ein Wild-West-Szenario mit gigantischen Solarkraftanlagen. Die Auswahl hängt allerdings wegen des Zeitfaktors auch ein bisschen davon ab, wie fett die jeweiligen Bücher sind. Novellen! Novellen! Mein Königreich für eine Novelle! (Josefson, derStandard.at, 15. 11. 2014)