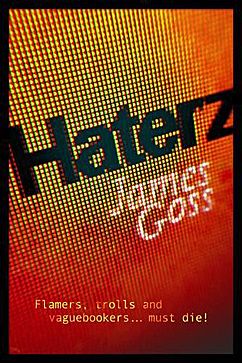
James Goss: "Haterz"
Broschiert, 333 Seiten, Solaris Books 2015
Das waren noch Zeiten, als die Geschwister Pfister "The internet is for porn" aus dem Musical "Avenue Q" sangen. Inzwischen heißt es in den Worten George R. R. Martins: "The internet is toxic". Stündlich braut sich in Foren weltweit der Hass zusammen und wartet darauf, sich im nächsten Shitstorm entladen zu dürfen. Dave indes, die Hauptfigur in James Goss' neuem Roman "Haterz", hat seinen eigenen Weg gefunden, wie er mit Hassern umgeht: Er bringt sie alle um.
Kennt noch jemand die Lolcats?
There's something wrong with the internet. If you think about it for a second, you'll see I'm right. I mean, I'm not saying the internet made me kill Danielle, but it certainly helped. So beginnt Daves Manifest über seinen Kampf gegen Forentrolle, Cyber-Mobber, Spammer, Scammer, Softwarepiraten, Hassposter und schlampige Interpunktion. Zwischendurch wirft er dabei auch Schlaglichter auf die Geschichte des Internets, von weithin in Vergessenheit geratenen harmlosen Phänomenen wie den Lolcats bis zu aktuellen Erscheinungen, an die sicher niemand nostalgisch zurückdenken wird. Stichwort Gamergate.
Denn Dave, ein arbeitsloser Schauspieler und hauptberuflicher Spendenkeiler, war von Anfang an dabei. Der leicht misanthropisch veranlagte junge Mann leidet am Auskennersyndrom: Er war in der Schule Fan von "Friends", ehe es zur populärsten Sitcom der Welt wurde (und hat es danach konsequenterweise nicht mehr angeschaut). Genauso ging es ihm mit den diversen Modeerscheinungen im Netz - er weiß, was gut war, ehe es schlecht wurde. Und Wissen plus Unzufriedenheit ergibt Sprengstoff.
Das Morden beginnt
Daves erstes Opfer ist besagte Danielle, die Freundin seines besten Kumpels Guy. Als wäre sie mit ihrer Facebook-Überpräsenz nicht schon nervtötend genug, droht sie Dave eines Tages auch noch, ihn öffentlich bloßzustellen. Daraufhin kippt er der Allergikerin ein paar zermahlene Erdnüsse in den Drink. Das schlechte Gewissen plagt ihn nach dieser Tat im Affekt nicht gerade - dafür beginnt es ihn zu gruseln, als plötzlich via E-Mail und SMS anonyme Botschaften bei ihm eintreffen: Wir wissen, was du getan hast. Direkt gefolgt von: Wir sind bereit, dich zu sponsern, wenn du damit weitermachst.
An dieser Stelle kommt, wenn man so will, der einzige Genre-Aspekt ins Spiel - wenn auch nicht Science Fiction, sondern allenfalls Mystery. Wer ist es, der Dave auf potenzielle Opfer ansetzt? Eine Geheimorganisation? Das Internet selbst, das sich mit seiner Hilfe von lästigen Phänomenen säubern will? Er selbst jedenfalls nennt seine Sponsoren fortan die Killuminati und eine mysteriöse maskierte Frau, die ihm gelegentlich bei seinen Taten beisteht, die Ninja.
Täter werden Opfer
Ironischerweise ist Dave den Schatten von Danielle immer noch nicht ganz los - seine nächsten Taten stehen alle indirekt mit ihr in Verbindung. Da wäre zunächst der Scammer Fast Eddy, der die Charity-Welle im Gedenken an Danielles Allergietod ausnützt, indem er falsche Spendenkonten einrichtet. Bastler Dave stellt ihm auf einem Extrem-Marathon eine ausgeklügelte Todesfalle. Oder die Trolle, die Guys neue Freundin mit Hasspostings bombardieren, einfach nur weil sie seine neue Freundin ist. Einer droht, ihr Haus in die Luft zu springen, ein anderer, sie mit einer Bierflasche zu vergewaltigen - Dave wird das alles postwendend und wortwörtlich in die Tat umsetzen.
Weitere Mitglieder im Monsterkabinett sind unter anderem eine Autorin erotischer Krimis, die für ihr Eigenmarketing eine skrupellose Politik der verbrannten Erde verfolgt (was mich sehr an das aktuelle Puppygate erinnert, siehe die beiden letzten Seiten dieser Rundschau). Oder ein 14-jähriges Mädchen, das Kampagnen organisiert, die jeden online vernichten, der Kritik am Teeniepopstar Harry Paperboy wagt. Woraufhin Dave Harry entführt und auf einen elektrischen Stuhl setzt, der sich beim ersten neuen Hasskommentar einschaltet: Ein Szenario, wie wir es aus Filmen von "Untraceable" bis "Saw" kennen ... und den Ausgang auch.
Loser Aufbau
Interessanterweise folgt "Haterz" nicht der Eskalationskurve, die man vielleicht erwarten würde, von harmlosen Aktionen bis zu immer brutaler werdender Gewalt. Stattdessen können auf kühl geplante Morde gänzlich gewaltlose Streiche folgen, in denen Dave als sympathischer Held rüberkommt. Auch steigert er sich nicht sukzessive in einen Wahn hinein: Selbstzweifel hat er von Anfang an, und er ist auch stets bereit, es zuzugeben, wenn eine Aktion unerwünschte Folgen zeigt oder mal ganz erfolglos bleibt. Wozu auch die Erfahrung gehört, dass Trolle per definitionem unbelehrbar sind.
Zum Teil mag dieser Aufbau James Goss' Vita geschuldet sein. Goss ist ein britischer Autor und TV-Produzent, der bislang für Serien wie "Doctor Who", "Being Human" und "Torchwood" gearbeitet hat. Vielleicht hat dies sein Denken soweit geprägt, dass "Haterz" den Charakter eines Episodenromans erhielt: Mit einem Story-Arc und Kapiteln, die sich mal mehr, mal weniger darauf beziehen - und auch einigen, die als abgeschlossene Kurzgeschichten komplett für sich allein stehen könnten. "Haterz" wirkt wie eine Mini-Serie mit wechselnder Schwerpunktsetzung. Was allerdings konstant bleibt und den Roman letztlich zusammenhält, ist der Humor. Und der ist spitze.
Spaß garantiert
It's funny what autocorrect tells you about yourself. I remember feeling a bit surprised the day my phone went for "fuck" not "dual". Oh dear, I thought, perhaps I should swear less in texts. I wonder if your average racist has that moment of self-realisation when their phone picks "scum" over "science". Daves Betrachtungen liefern reihenweise Zitierfähiges - großartig etwa die Beschreibung eines pompös angekündigten sozialen Netzwerks, das immer noch kaum jemand besuchen will, als the howling tundra of Google+. Oder eine treffende Beobachtung aus einem gentrifizierten Viertel Londons: In the centre of the plaza, two people drank coffee on a bench carefully designed to be comfortable to sit on for only ten minutes and absolute agony to try and sleep on.
Bei der Lektüre von "Haterz" wird man mehrfach laut auflachen - das ist ebenso garantiert wie der Schauder, der einen überkommt, wenn man die fiktiven Umtriebe mit ihren nicht minder scheußlichen realen Pendants vergleicht. Jeder Zeit ihr Buch. "Haterz" hätte das Zeug zum Bestseller - allerdings frage ich mich, ob es dafür im richtigen Verlag erschienen ist. Solaris ist ein Verlag für Science Fiction und Fantasy, und als solches werden seine Produkte auch wahrgenommen - selbst wenn sie, wie dieses Buch, eigentlich gar keine SF sind. Bei einer allfälligen Übersetzung ins Deutsche wäre Goss bei einem Mainstreamverlag vielleicht besser aufgehoben.
Trotz einiger Schwächen im Aufbau ist "Haterz" eine klare Kaufempfehlung. Mit Betonung auf der ersten Silbe, denn für Gratislesen hat Dave in seinem Manifest auch nichts übrig (und man will ja nicht riskieren, dass er einen daheim besucht): I won't bore you with any of the arguments about piracy. Hell knows, you're probably reading a pirated epub of this on your phone and thinking Thank God I didn't waste my money on this before passing this on to ten of your friends. Thanks. I hope your cock falls off.

Jeff Strand: "Der unglaubliche Mister Corpse"
Broschiert, 280 Seiten, € 12,95, Voodoo Press 2015 (Original: "The Sinister Mr. Corpse", 2011)
Nach all den It-Girls und It-Boys, die wir in TV und WWW über uns ergehen lassen mussten, schlurft nun der Welt erster It-Zombie ins Scheinwerferlicht - tausendmal interessanter als Paris Hilton und nur halb so steif. Der US-amerikanische Autor Jeff Strand pendelt seit Jahren gekonnt zwischen Bizarro, Horror und Humor; in diesem Roman konnte er vor allem seine witzige Seite ausleben.
Die letzten Stunden eines Losers
Stanley Abernath heißt unser "Held", ist 35 Jahre alt und muss immer noch gelegentlich seinen Eltern Essen aus dem Kühlschrank klauen, um über die Runden zu kommen. Eigentümer eines Filmunternehmens zu sein klingt nach was - doch niemand kauft den Trash von "Demented Whackos Videos". Stanley ist hochverschuldet und weint sich jede Nacht rituell in den Schlaf. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt: Stanley erhob sich von seiner Pritsche und zog sein T-Shirt wieder an. Nach seinem täglichen Weinen fühlte er sich immer erfrischt. Es würde bald besser werden, er konnte es spüren. Und obwohl er innerhalb der nächsten Stunde tot sein würde, hatte er recht.
Stanleys Tod ist übrigens ein irritierendes Beispiel für "Life imitates art": Er wird nämlich von einem Milchlaster erfasst, eingeklemmt und ertrinkt in der auslaufenden Milch. Das könnte man superskurril finden, wäre nicht vor drei Wochen erst eine Meldung über den Ticker gekommen, dass in Indien der Fahrer eines solchen Milchlasters auf genau diese Weise zu Tode gekommen ist. Es ist eine seltsame Welt.
Unverhoffter Neuanfang
Für Stanley jedenfalls fängt damit alles erst an. Der Unternehmer Richard Brant sieht in ihm nämlich den perfekten Kandidaten für sein Projekt Zweite Chance. Und so wird Stanley zwei Monate nach seinem Tod wiedererweckt. Gut, er ist nicht mehr ganz so ansehnlich: Fleckige graue Haut spannt sich pergamenten über seine Knochen, und von der Nase oder seinem Penis ist auch nicht viel übriggeblieben. Aber ansonsten ist er wieder ganz der Alte - und hat, das sei an dieser Stelle gleich erwähnt, genauso wenig Appetit auf Menschenfleisch wie zuvor.
Zwischenbemerkung: Das Porträt auf dem Cover deckt sich in diesem Punkt zwar nicht mit der Beschreibung im Roman. Ansonsten halte ich es aber für ein klasse Titelbild im TV-Zeitschriftendesign, was zur Handlung insgesamt ausgesprochen gut passt. Einer der raren Fälle, in denen das Tibi der deutschen Ausgabe besser ist als das originale, denn "Mister Corpse" ist in erster Linie eine Mediensatire. Stanley wurde nämlich nur zu einem Zweck zurückgeholt: um Geld in Brants Kassen zu spülen. Der macht Stanley unmissverständlich klar, dass er das Eigentum von Projekt Zweite Chance ist - aber weil für ihn selbst zum ersten Mal in seinem Leben und Tod auch genug rausspringt, macht er mit.
Stanley erhält eine persönliche Assistentin, die ihm Medienschulungen gibt (was unter anderem bedeutet, ihn von übermäßigem Gebrauch von Schimpfwörtern abzuhalten), und startet als der unglaubliche Mr. Corpse durch. Schon der Reanimierungsprozess war live im Fernsehen übertragen worden. Es folgen eine Pressekonferenz, Interviews, TV-Auftritte, Werbeclips, ein Rap-Video und ein floppendes Musical. Die Werbeverträge wurden schon ausgehandelt, als Stanley noch am Verwesen war - und binnen kurzem liegt Merchandising vom T-Shirt bis zur Actionfigur in den Regalen. Alles könnte prima immer so weiter laufen, wäre da nicht erstens Stanleys wachsende Unzufriedenheit mit seinem Dasein als Produkt und zweitens der psychopathische Serienkiller Henry Sweet, bei dem man noch etwas länger rätseln darf, wie er wohl mit der Haupthandlung zusammenhängt.
Großer Spaß!
Wie schon gesagt, lebt der Roman von seinem Witz. Interessanterweise kommt der aber - trotz des bizarren Plots - nicht in erster Linie durch Situationskomik zustande. Skurrile Situationen gibt es zwar so einige: Etwa wenn Stanley beschließt, seine Beinahe-Unsterblichkeit dafür zu nutzen, als maskierter Superheld auf Verbrecherjagd zu gehen (was natürlich voll ins Auge geht). Oder in Form einer sehr schönen Umkehrung des klassischen Zombie-Motivs gegen Ende; ich wette, das war eine der Ausgangsideen des Romans.
Nein, primär liegt der Witz in den Dialogen. Stanley ist unreif, aber nicht dumm. Er mag sich nichts vorschreiben lassen, reißt gerne pubertäre Witze und lotet die Grenzen der Geduld seiner Gesprächspartner wieder und wieder aus. Das Ergebnis sind herrliche Ping-Pong-Dialoge, die sich durch den ganzen Roman ziehen und ihn damit zu dem machen, was er ist: ein großer Spaß mit einem sympathischen Typen, mit dem man gerne mal ein Bier trinken oder ein Gehirn essen gehen möchte.
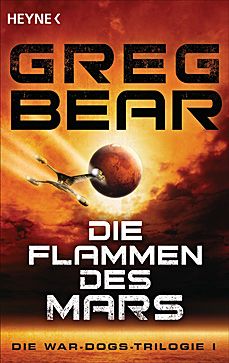
Greg Bear: "Die Flammen des Mars"
Broschiert, 429 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "Wardogs", 2014)
Ein alter Bekannter meldet sich zurück. Und es scheint, als hätte der seit bald 50 Jahren aktive Hard-SF-Star aus Kalifornien die Lehre aus seinem Ich-wäre-gerne-der-Zenit-meines-Lebens-geworden-Roman "Die Stadt am Ende der Zeit" von 2008 gezogen. Seitdem bäckt Greg Bear jedenfalls wieder kleinere Brötchen - oder besser gesagt: leichter verdauliche. Die gruselige Space Opera "Das Schiff" von 2010 hat mir bedeutend besser gefallen als die esoterische "Stadt", danach schrieb Bear für die "Halo"-Reihe. Sein jüngstes Werk liegt irgendwo in der Mitte: Es ist der Start einer Trilogie zwischen Military- und Hard-SF.
Die Welt in der nicht allzu fernen Zukunft
Veteranenstatus hat nicht nur Bear selbst, sondern auch die Hauptfigur von "Wardogs". Sergeant Michael Venn ist ein kampferprobter Skyrine (Sky-Marine), der bereits einige Einsätze auf dem Mars hinter sich hat. Dort ist die Menschheit nicht unbedingt aus eigenen Stücken aktiv geworden: Vor einigen Jahren sind "Gurus" genannte Außerirdische auf der Erde gelandet, die der Menschheit allerlei technologische Wohltaten zukommen haben lassen. Allerdings fordern sie nun dafür auch einen Preis ein. Ihre alten Erzfeinde - die Menschen bezeichnen sie als "Antags", kurz für Antagonisten - sind ihnen nämlich ins Sonnensystem gefolgt und haben auf dem Mars einen Brückenkopf angelegt.
Dieses Grundszenario wird in den weiteren Bänden der Trilogie noch eine größere Rolle spielen, immerhin sind da noch viele Fragen offen. Man weiß ja nicht mal, wie die Gurus aussehen, so geschickt halten sie sich im Hintergrund. Aber einige Infosplitter sind doch dazu angetan, die Wohltäter der Menschheit verdächtig erscheinen zu lassen. Etwa dass sie im Geheimen längst die Weltpolitik bestimmen und sich zwar - bis auf ihre Forderung nach Marssöldnern - weitgehend zurückhalten, aber doch die eine oder andere vermeintlich harmlose Regelung durchgesetzt haben. Und kann man jemanden zu den Guten zählen, der Universitäten aushungern lässt?
Erinnerungslücken nach Marsbesuch - klingt bekannt?
Zu Beginn des Romans kehrt Michael gerade von seinem jüngsten Einsatz auf dem Roten, wie der Mars durchgängig genannt wird, zur Erde zurück. Die Substanz, die ihn den langen Raumflug überstehen ließ, hat Spuren hinterlassen - aber da ist auch noch etwas anderes an Michael, wie wir im letzten Teil des Romans erfahren werden. Beide Faktoren führten jedenfalls dazu, dass unser Ich-Erzähler zunächst einen etwas desorientierten Eindruck macht.
Dieses Gefühl reicht der Autor ungefiltert an uns weiter. Auf den ersten Seiten werden wir mit einer wahren Flut an neuen Wörtern - Kosmolin, Skyrines, Spaceframes, Orbital, Timeout, Engel - konfrontiert, wie das in Genreromanen ja ganz gerne mal gemacht wird. Dazu kommt aber noch eine zweite Welle, die nicht auf das Worldbuilding, sondern auf den Plot bezogen ist - hier ein Ausschnitt: Aber es stört mich nicht, allein zu sein. (...) Nicht, wenn Joe zurückkehrt und mir erklärt, wie alles gelaufen ist. Was es mit dem wahren Geheimnis auf sich hat, mit den Muskis und dem Drifter, der Siliziumseuche und dem Turm der klugen Diamanten. Mit Teal. Und den Voors, fiesen, habgierigen Hurensöhnen ... Im Grunde fasst Greg Bear hier bereits die gesamte folgende Handlung zusammen (ohne dass wir zu diesem Zeitpunkt auch nur ein einziges Wort verstehen würden, versteht sich).
Möglich ist dies deshalb, weil der Roman im Rückblick erzählt wird: Erst versucht Michael seine Erinnerungen allein zu sortieren, später wird er noch eine Gesprächspartnerin erhalten. Und eines sei vorneweg gesagt: "Muskis" hat eine sehr schöne Herleitung.
Eine Soldatengeschichte
Michaels nach und nach rekonstruierte Geschichte ist Bear-typisch von Hard-SF geprägt, was sich nicht nur in der verwendeten Technologie äußert. Unter anderem steigen wir auch zum Eisenkern eines abgestürzten Mondes hinab und dürfen am Einschlag eines Kometen teilhaben. Aufmerksame Bear-Fans werden zudem eine Anspielung auf seine "The Way"-Reihe ("Äon") entdecken. Ist zwar eine andere Version der Zukunft, aber ein Mathematiker hat sich da offenbar auch in dieses Universum herübergestohlen.
Was die Komponente "Military SF" betrifft, bin ich mir nicht sicher. Manche scheinen damit automatisch Heroismus und dergleichen zu assoziieren - den sucht man hier vergebens. Allerdings setzt Bear auch keine vordergründig pazifistischen Botschaften. Es ist einfach eine Soldatengeschichte, geschildert aus der Perspektive derjenigen, die im Einsatz stehen, ihre - teilweise selbstgewählte - Aufgabe erfüllen und diese mit galligem Humor kommentieren, wenn's grade mal eine Atempause gibt. Der Titel "Wardogs" weist ja schon auf den Grundton der Erzählung hin. Und Sätze wie "Physik ist das, was einen umbringt, doch Biologie ist das, was dich töten will" bringen das Denken der Beteiligten auf den Punkt.
Resümee
Auf mich wirken die ProtagonistInnen jedenfalls ziemlich glaubhaft. Dass sich Bear, der den Roman den Soldaten des Zweiten Weltkriegs und des Korea- und Vietnamkriegs widmet, von Veteranen beraten hat lassen, kommt der Geschichte eindeutig zugute.
Perfekt ist "Die Flammen des Mars" nicht - dafür sind für meinen Geschmack zu viele unterschiedliche Parteien auf dem Mars vertreten (fast wie bei den angeblich abgelegenen Inseln von "Lost" oder "Gilligan's Island", auf denen zeitweise ja auch Durchreiseverkehr wie am Frankfurter Flughafen herrschte). Aber spannend ist der Auftakt der Trilogie allemal. Auf Teil 2 heißt es noch ein bisschen warten, der kommt im Oktober erst mal im Original raus.
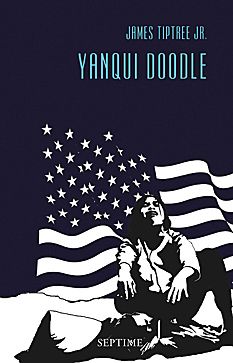
James Tiptree Jr.: "Yanqui Doodle"
Broschiert, 512 Seiten, € 23,90, Septime 2015
Ich freue mich bekanntgeben zu dürfen, dass ich mich geirrt habe. Beim vorangegangenen Band der James-Tiptree-Jr.-Werkschau von Septime, "Sternengraben", hatte ich noch betrauert, dass sich darin der schriftstellerische Niedergang von Tiptree bzw. Alice B. Sheldon in den letzten Jahren ihres Lebens zeige. Doch handelte es sich bei diesen Erzählungen aus der Mitte der 80er Jahre zwar (für Tiptree-Verhältnisse) um einen Tief-, aber nicht um den Endpunkt.
Dieser Band hier umfasst nämlich noch spätere Werke - zugleich sind darunter die letzten, die Sheldon vor ihrem erweiterten Suizid 1987 geschrieben hat. Zu meiner Überraschung habe ich einige davon als Erzählungen wiedererkannt, die ich vor einer halben Ewigkeit schon einmal gelesen und nicht als Spätwerke erkannt hatte (genauer gesagt hatte ich damals auch noch kein Interesse an Chronologien). Ich hätte sie eher in den frühen 70ern, also dem Beginn von Tiptrees großer Zeit, eingeordnet. Und sie gehörten für mich immer ganz selbstverständlich zum "Tiptree-Kanon" - also einem Werk, dessen Qualitäten mich dazu gebracht haben, Tiptree neben Cordwainer Smith ins Regal mit den LieblingsautorInnen zu stellen.
Lesenswertes aus den letzten Jahren
Ein solches Beispiel wäre etwa die beklemmende Titelgeschichte "Yanqui Doodle": In irgendeinem lateinamerikanischen Land, in dem die USA einen Putsch gegen die linke Regierung organisiert haben, findet ein erbarmungsloser Bürgerkrieg statt. US-Soldat Don Still wurde verwundet und liegt nun in einer Entzugsklinik - denn die GIs werden unter enthemmende Drogen gesetzt, ehe sie in den Kampf ziehen. Als die Wirkung der Mittel langsam abklingt, steigen in Don nicht nur die Schmerzen hoch, sondern auch Erinnerungen an die Massaker, die er verübt hat. Also will er unbedingt zur Front zurück - dorthin, wo es die schönen Drogen gibt. Mark Siegel, ein Freund Tiptrees aus ihren späten Jahren, zitiert im Nachwort aus Briefen der Autorin: "Ich bin eine geladene Waffe, ich bin eine geradezu schmerzhaft geladene Waffe, gänzlich außerstande, diejenigen vor den Lauf zu bekommen, die meine Feinde sind." Don wird seinen Feind finden.
Ebenfalls im Gedächtnis geblieben ist mir "Oh kehre, selige Zeit, mir zurück" ("Backward, Turn Backward"), eine Quasi-Zeitreisegeschichte mit dem Charakter einer biblischen Parabel. Eine neue Technologie ermöglicht einen Besuch in der Zukunft - und zwar in der Form, dass man mit Geist und Körper seines späteren Ichs für einige Zeit den Platz tauscht (das zukünftige Ich erinnert sich natürlich an den Trip und freut sich bereits auf seinen "Urlaub in der Vergangenheit"). Die ProtagonistInnen besuchen eine dystopische Zukunft, in der ein normales Leben nur noch in Gated Communities möglich ist; vor den Mauern herrschen Gewalt und Anarchie. Aber es ist nicht das, was die ambitionierte Diane schaudern lässt - sondern der Umstand, dass sie ein Leben in der Mittelklasse führen wird. Und obwohl sie von ihrem zukünftigen Ich weiß, dass ihr Jahrzehnte eines glücklichen Lebens bevorstehen würden, droht dieser Umstand sie zu einem folgenschweren Entschluss zu verleiten.
Die Engel im Himmel und im Weltraum
Kürzer, aber ebenfalls voller Tiptree-Feeling sind zwei Erzählungen mit metaphysischem Charakter. Als Gott starb, überlebte ihn der Teufel noch eine Weile, lautet der sehr schöne Eröffnungssatz von "Unser Dämon vor Ort" ("Our Resident Djinn"). Nach Gottes Tod steigt Satan zum Himmel empor (kurze Lunchpause unterwegs inklusive) und baldowert mit Petrus die Nachlassverwaltung aus. Ihr Plan: Der Himmel soll abtransportiert und im Vorhof der Hölle wieder aufgebaut werden. Die allegorische Erzählung glänzt mit Humor - allerdings begegnet der nette Satan am Ende dem, was nach Himmel und Hölle kommen wird. Und das lässt ihn frösteln.
In "Zum Zweiten" begegnen Astronauten auf dem Mars Besuchern aus einem anderen Sonnensystem und reisen mit diesen zur Erde zurück. Die Angli sehen zwar aus wie fliegende Kraken, sind aber so freundlich und hilfsbereit, dass man sie bald wie Engel verehrt ... womit man auch nicht ganz daneben liegt, wie sich noch zeigen wird. Echte lebende Götter werden hier ebenso geboten wie die Lösung des Überbevölkerungsproblems (beides freilich ein bisschen anders, als man es sich vorgestellt hätte). Womit auf der Erde allerdings keiner gerechnet hat, ist der Umstand, dass die sympathischen Aliens eines Tages einfach wieder abreisen könnten; darum auch das wunderbare Wortspiel im Originaltitel "Second Going".
Weiters im Angebot
"Komm, leb mit mir" ("Come Live with Me") kehrt einen altgedienten SF-Plot ins Positive: Raumfahrer landen auf einem fremden Planeten und treffen dort auf Symbionten, die menschliche Körper übernehmen und dadurch sogar Tote wiedererwecken können. Im Ton ist mir die Geschichte allerdings ein wenig zu kitschig.
Weniger stark - aber doch ein bisschen - kommt die Rührseligkeit in der Novelle "Die Farbe von Neandertaleraugen" ("The Color of Neanderthal Eyes") durch. Hier macht Erdenmann Tom Jared alleine Urlaub auf einem paradiesischen Planeten und wirft nach der Begegnung mit dessen friedlichen Bewohnern bald jede Regel für den Erstkontakt über Bord. Er hat Sex mit einer Einheimischen, sorgt für Technologie- und Wissenstransfer und greift schließlich sogar zur Laserpistole, als seine neuen Freunde von einem weniger pazifistischen Volk angegriffen werden. Zwar plagen Tom Gewissensbisse, dass er eine derart paradiesische Kultur auf Kriegstauglichkeit trimmt - aber er hat einen bedrohlichen Präzedenzfall im Hinterkopf: nämlich wie seine eigene Spezies einst die Neandertaler verdrängte.
Gänzlich aus der Reihe tanzt "Herz Drei" ("Trey of Hearts"), das als Eröffnungsgeschichte dieses Bands eine etwas seltsame Wahl ist. Handlungsreisende Sheila erinnert sich sehnsüchtig daran, wie sie einst zwei Aliens in künstlich gezüchteten Jungmännerkörpern die Grundzüge der menschlichen Sexualität beibrachte ("Ich glaube, ich will deinen Körper examinieren"). "Xenophilie" war schon in Tiptrees früher Schaffensperiode mehrfach Thema von Erzählungen ("And I Awoke and Found Me Here on the Cold Hill's Side", "Mamma Come Home"). Hier allerdings wird der Sex explizit und sehr ausführlich beschrieben und ist das eigentliche Thema der Geschichte.
Würdiger Abschluss
Kennt man Alice B. Sheldons Lebensgeschichte, schaudert man schon beim Einstieg von "Oh kehre, selige Zeit, mir zurück" unwillkürlich: Ein alt und gebrechlich gewordenes Ehepaar liegt im Bett - später werden wir zudem noch erfahren, dass die Frau in der Schublade ihres Nachtkästchens einen Revolver hat. Wie könnte man da nicht daran denken, wie Sheldon erst ihren Ehemann und dann sich selbst erschoss?
Auch in der letzten Erzählung dieses Bands, "Mitten im Leben" ("In Midst of Life"), erschießt sich die Hauptfigur, gelangweilt von ihrem routinierten Leben. Doch nach seinem Selbstmord findet sich Amory in einer säkularen Nachwelt wieder - einem Konstrukt, das sich aus seinen Erinnerungen und denen anderer Menschen zusammensetzt. Und er muss feststellen, dass er zurück auf Los gegangen ist, denn auch in dieser Geisterwelt geht seine Suche nach Erfüllung weiter. Hoffnungslos, ohne deprimierend zu sein, ist die melancholische Geschichte eine gelungene Gratwanderung - und ein würdiger Abschluss dieses überraschend starken Bands.
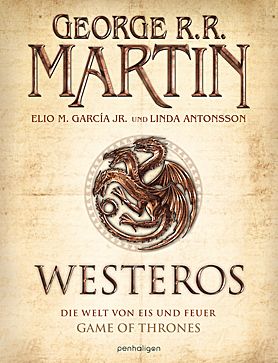
George R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. & Linda Antonsson: "Westeros. Die Welt von Eis und Feuer. Game of Thrones"
Gebundene Ausgabe, 336 Seiten, € 30,90, Penhaligon 2015 (Original: "The World of Ice & Fire: The Untold History of Westeros and the Game of Thrones (A Song of Ice and Fire)", 2014)
Feeeeeeett. Ich dachte, das wäre einfach so'n Bildband. Stattdessen handelt es sich um eine wahre Enzyklopädie, ein illustriertes historisches Kompendium zur Serie. Zur Buchserie, wohlgemerkt. Stills vom Set der TV-Serie darf man sich hier nicht erwarten.
Nicht weniger als 27 IllustratorInnen haben hier mitgearbeitet, darunter so prominente Namen wie Michael Komarck oder der nicht zuletzt als Tolkien-Illustrator bekannte Ted Nasmith. Zu meinen persönlichen Favoriten zählen auch Jordi González Escamilla von wegen Detailschärfe und die Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Douglas Wheatley - aber das ist rein subjektiv. Objektiv lässt sich aber feststellen, dass die Vielzahl an Mitarbeitenden einen positiv-paradoxen Effekt hat. Bei nur zweien oder dreien neigt man unwillkürlich dazu, sie nach persönlichem Geschmack in "die Guten" und "die weniger Schönen" einzuteilen. Aus dem großen Kollektiv hingegen ergibt sich in Summe schon viel eher wieder ein einheitlicher Gesamtlook. Ach ja, und auch die Karten von Michael Gellatly können was - auch wenn bei Westeros' Nachbarkontinent Essos wie üblich das Meiste der Vorstellung überlassen bleibt.
Mehr als nur ein Nachschlagewerk
Aber der wunderschön gemachte Band ist auch in Hinblick auf das geschriebene Wort nicht zu verachten. Trotz der unzähligen Farbillustrationen - viele davon ganzseitig - kommt bei über 300 Seiten von 30 x 22,5 Zentimeter Größe auch ein ganz gewaltiger Textkorpus zusammen. Für dieses Buch muss man sich eindeutig Zeit nehmen, will man es nicht ausschließlich als Nachschlagewerk nutzen.
... und das wäre schade, weil sich die liebevolle Gestaltung auch auf die Historiographie selbst erstreckt. Denn es ist nicht etwa George R. R. Martin oder irgendein neutrales Abstraktum, die uns hier die Geschichte von Westeros nahebringen. Nein, es ist ein zur Zeit von König Robert Baratheon lebender Maester mit Namen Yandel. Und diese In-Universe-Perspektive hat Auswirkungen. Wie etwa: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing - also schleimt Yandel seinen Brötchengeber an ("nur wenige waren je so freigiebig und barmherzig wie Robert Baratheon") und prognostiziert ihm in einem eigenen Kapitel ("Die glorreiche Herrschaft") ein Goldenes Zeitalter. Wir wissen ja, was draus geworden ist.
Darüberhinaus befindet sich Yandel trotz aller Belesenheit auf dem Wissensstand, den man in Westeros vor dem Beginn der Romanserie hatte - was ihn zu einigen Fehlannahmen veranlasst - etwa dass Riesen ausgestorben seien -, die er aber als ebenso unumstößliche Fakten präsentiert wie die Punkte, in denen er tatsächlich recht hat. Versierte Fans der Buch- und TV-Serie können das als Insidergags genießen. Es ist aber auch praktisch für Neulinge, da sie sich hier auf den Status quo ante bringen lassen können, ehe sie mit der eigentlichen Serie starten. Am Ende kommt allerdings ein ganz kurzes Nachwort, das ebenso wie die Ahnentafeln der Herrschergeschlechter von Westeros auf dem aktuellen Stand ist.
Martin spricht durch Yandel
Mit dem quellenkritischen Maester Yandel haben wir einen ausgesprochen vergnüglich zu lesenden "Autor". Er klagt über den mangelnden Erhaltungszustand historischer Schriftrollen, ätzt über andere Vertreter seiner Zunft und beschwert sich über zweifelhafte Zeugnisse. Darüberhinaus kann er es sich nicht verkneifen, plumpen Heroismus (außer natürlich wenn es um Robert Baratheon geht) auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Formulierungen wie "die Schlacht am Königsweg, von den Teilnehmern als 'das Schlammige Durcheinander' bezeichnet" spiegeln Martins Linie ironischer Demystifizierung wider. Siehe auch diese wunderbare Passage über das vermeintlich überirdische Erscheinungsbild der Valyrer:
Die große Schönheit der Valyrer - sie hatten Haar wie helles Silber oder Gold und Augen, die in vielen verschiedenen Violetttönen leuchteten, einmalig unter allen Völkern der Welt - ist weithin bekannt und galt oft als Beweis dafür, dass in valyrischen Adern tatsächlich besonderes Blut geflossen sei, was sie von geringeren Menschen unterschied. Doch manche Maester verweisen darauf, dass man bei Tieren durch gezielte Zuchtwahl erstaunliche Ergebnisse erzielen kann und dass abgeschottete Völker oft bemerkenswerte Abweichungen von dem aufweisen, was als üblich gilt.
Der Aufbau
Der erste Abschnitt des Bands, "Die Geschichte des Altertums", reicht von den ältesten Zivilisationen der Welt über die diversen Einwanderungswellen in Westeros bis zur Eroberung durch die Targaryens. Das liest sich ziemlich ähnlich wie das "Silmarillion". Und glaubt man hier bereits, mit einer nicht verarbeitbaren Menge an Namen (von Völkern, Personen, Orten und Schlachten) geflutet zu werden, so ist dies doch erst eine lockere Einstimmung auf das, was danach folgen wird.
Der zweite Abschnitt ist den diversen Targaryen-Königen bis zu Roberts Revolution gewidmet. Es folgen ausführliche Vorstellungen der sieben Königslande - wieder von der Urgeschichte bis zur Gegenwart reichend - inklusive Geographie und regionaler Besonderheiten: Eine Art Reiseführer durch Westeros, der im letzten Abschnitt des Bands noch durch die benachbarten Inseln und Kontinente (Mehrzahl!) sowie jene Regionen ergänzt wird, die man nur noch aus zweifelhaften Gerüchten kennt.
Un-glaub-lich viele Namen
Und in all diesen Teilen geht's rund. Es wird nicht nur jeder genannt, der mal in einer Schenkenschlägerei einem anderen eins mit dem Schwert übergezogen hat, weil er dessen Cousine geschwängert hat. Wir erfahren auch den Namen der Cousine und was später aus ihrem Kind geworden ist. Ab Abschnitt 2 enthält der Band so unfassbar viele Namen, als wäre er das Telefonbuch - respektive das Briefrabenhalterverzeichnis - von Westeros und Essos.
Ich kann nicht einmal im entferntesten erahnen, wie viele der hier Genannten auch schon in einem der Romane erwähnt worden sind - das zu erkennen, obliegt Hardcore-Fans. Ich bin schon froh, im historischen Mahlstrom eine Erwähnung von Dunk aus "Der Heckenritter von Westeros" identifiziert zu haben. Aber eines ist sicher: Wenn all diese Namen kanonisch sind, muss Martin daheim ein gigantisches Privatwiki angelegt haben, um sich nicht in Widersprüche zu verheddern. Dann braucht man sich auch nicht wundern, warum es immer so lange dauert, bis ein neuer Roman fertig wird. Da ist es schon eher ein Mirakel, dass er sich überhaupt noch etwas zu schreiben getraut.
Insgesamt also: Eine große Empfehlung für alle Fans von "Das Lied von Eis und Feuer" und solche, die es noch werden wollen. Manisch, magisch, majestätisch. Und bluttriefend bis zum Gehtnichtmehr - wie Geschichtsbücher halt so sind.
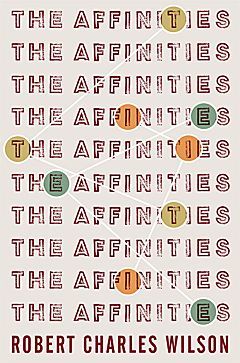
Robert Charles Wilson: "The Affinities"
Gebundene Ausgabe, 300 Seiten, Tor Books 2015
Die schöne Welt der neuen Medien und sozialen Netzwerke war ja schon in den ersten beiden Büchern dieser Rundschau Thema. Jetzt kommt jemand, der das Ganze tatsächlich zu einem sciencefictionesken Szenario weitergesponnen hat: Robert Charles Wilson.
Zugegeben, sein letzter Roman "Burning Paradise" war unterm Strich ein klein wenig enttäuschend. Andererseits hat sich der kanadische Autor mit Romanen wie "Spin" oder "Darwinia" mehr als genug Kapital für einen Vertrauensvorschuss erschrieben. Und den rechtfertigt er mit diesem Roman: Obwohl er im Grunde auf eines der klassischen Motive der Science Fiction - eine "neue Menschheit", die sich anschickt, die alte zu ersetzen - zurückgreift, gelingt es ihm, daraus eine Idee abzuleiten, die tatsächlich neu ist.
Soziale Tiere finden ihre Herde
Und Wilson braucht dafür weder eine genetische Mutation noch massiven Technologieeinsatz, sondern nur ... Soziologie und Systemtheorie. Im Roman ist von "Teleodynamik" die Rede; keine Eigenschöpfung, auch dieses Wort ist der realen Welt entnommen. Ausgehend von der in "The Affinities" mehrfach zitierten Prämisse, dass der evolutionäre Erfolg des Menschen auf seiner Fähigkeit zur Kooperation beruht, ist hier jemand auf den Plan getreten, der diese Fähigkeit optimiert. Der israelische Wissenschafter Meir Klein (der im Roman nur eine Nebenrolle spielt) hat Algorithmen entwickelt, mit denen sich Menschen zu für sie optimalen Gruppen zusammenfügen lassen, den Affinities.
Anfangs wird dies als eine Art Dating-Agentur missverstanden, tatsächlich geht es um etwas ganz anderes. "Our evaluations look beyond race, gender, sexual preference, age, or national origin. Affinity groups aren't about excluding differences. They're about compatibilities that run deeper than superficial similarity", erklärt eine Mitarbeiterin des Unternehmens InterAlia, das Tests anbietet, in denen festgestellt wird, ob man sich für eine Affinity eignet. Jeder kennt den Effekt, wenn er jemand Neues trifft und es - auch in durchaus nicht-sexueller Weise - ganz einfach klick macht.
Was im normalen Leben ein seltener Glücksfall ist, wird durch Kleins Algorithmen zur Garantie: Affine Menschen sind zwar nicht gleich, aber "polykompatibel". Sie verstehen einander besser als andere und können besser zusammenleben und -arbeiten als mit anderen. Und weil es verschiedene Formen optimaler Kooperation gibt, bilden sich insgesamt 22 Affinities mit durchaus unterschiedlichem Charakter heraus. Vorstellen muss man sich eine Affinity wie eine künstliche Ethnie, die über den ganzen Kontinent bzw. sogar Globus verteilt ist und sich in regionale Zweige (sodalities) und lokale Gruppen von etwa 30 Mitgliedern (tranches) gliedert. Übrig bleibt die große Restmenge derjenigen Menschen, die laut Test für keine davon geeignet sind. Das birgt sozialen Sprengstoff.
Die Segregation beginnt
Hauptfigur und Ich-Erzähler des Romans ist der aus New York State stammende Adam Fisk, der in Toronto Grafikdesign studiert - sehr zum Missfallen seines autoritären Vaters. Adam hat sich in seiner Familie nie sonderlich zuhause gefühlt. Entsprechend groß ist seine Freude, als InterAlia sein "Sozionom" (die soziologische Entsprechung seines Genoms, eine Art Karte seiner sozialen Interaktionen) auswertet und konstatiert, dass er zu Tau passt, einer der größten Affinities. Schon bald ist Adam in der lokalen Gruppe von Tau bestens vernetzt, zieht bei anderen Taus ein und fühlt sich in deren Haus von Anfang an heimischer, als es bei seiner Blutsfamilie je der Fall war.
Einen ersten Vorgeschmack auf die Synergie, die zwischen den Taus wirkt, bekommen wir, wenn sie gemeinschaftlich einen Stalker verjagen. Obwohl hier sonnenklar ist, wem unsere Sympathie gilt, wirkt das doch schon ein kleines bisschen unheimlich. Dieses Gefühl steigert sich, wenn Adams neue Freundin Amanda zu Wort kommt, die ihm in Gedanken schon weit voraus ist. Ihre Loyalität gilt ausschließlich Tau: "These big abstractions - God and country and family. They used to have power over me, as if they were real and important. But they're not." Ist es nicht ein klassisches Sektenmerkmal, wenn die sozialen Beziehungen zu jeder anderen Gruppe gekappt werden? Amanda verwendet auch als Erste das abfällige Wort "tether" für alle Freunde und Familienangehörigen, die nicht zu Tau gehören - "tether" wie "Leine", weil es sich um lästige Anbindungen handle, von denen man nur eingeschränkt wird. Die Entwicklung der folgenden Jahre spiegelt sich auch darin wider, wie "tether" mit zunehmender Selbstverständlichkeit in Adams Sprachgebrauch einsickert.
Die Gesellschaft verändert sich
Seit den 70ern oder spätestens dem Cyberpunk der 80er Jahre haben wir uns an Zukunftsgesellschaften gewöhnt, in denen der Staat seine gesellschaftsgestaltende Macht an Wirtschaftskartelle verloren hat. Bei Wilson ist ein gänzlich neuer Player dabei, an den beiden anderen vorbei die Gesellschaft umzukrempeln. Das hat durchaus seinen Reiz - lieber Grassroots-Gruppen als skrupellose Konzerne, möchte man meinen. Aber so harmonisch das Leben innerhalb einer Affinity auch ist, nach außen wird's zunehmend problematisch.
Denn die Affinities entwickeln sich mehr und mehr zu Parallelgesellschaften. Sie bauen ihre eigenen Finanz- und Gesundheitssysteme auf (Tau-Spitäler etwa behandeln keine Außenstehenden). Von einer eigenen Polizei und einem eigenen Parlament ist die Rede, und bald wird man auch ein eigenes Sicherheitssystem brauchen, denn ein gewaltsamer Konflikt zwischen verschiedenen Affinities und/oder dem Rest der Gesellschaft scheint immer unvermeidlicher. Jahrzehnte nach der Gründung der Affinities bezeichnet eine Außenstehende sie als circled wagons in a hostile desert.
Wirkt nach
Der Roman enthält wieder einige Wilson'sche Trademarks: Von einer spannenden "Big Idea" und der glasklaren Sprache abgesehen, ist dies zum einen der Umstand, dass sich das Geschehen über einige Jahrzehnte erstreckt. Und zum anderen, dass das große Rahmengeschehen auf die persönliche Ebene heruntergebrochen wird. Viel stärker noch als "Spin" ist "The Affinities" eine Geschichte um Familie und Freundschaft, während das globale Szenario im Hintergrund bleibt - diesmal vielleicht mehr, als dem einen oder der anderen lieb ist. Und obwohl die Klimax des Romans unter anderem mit einem weltweiten Stromausfall und einem möglichen Nuklearangriff auf Indien aufwartet, läuft die eigentliche Entscheidung auf einen Loyalitätskonflikt Adams hinaus: Affinity versus Familie und Freunde.
"The Affinities" hat bei mir schon nach einigen Seiten dieses ganz bestimmte Glücksgefühl ausgelöst, das auf die Gewissheit hinausläuft, ein gutes Buch lesen zu werden. Und so ist es auch gekommen. Wie gesagt: Man muss Wilsons Entscheidung akzeptieren, das Globale (= das eigentlich SFische) zu Gunsten des Persönlichen hintanzustellen. Aber dafür sind wir mittendrin in Adams seelischem Zwiespalt und dürfen uns selbst die Frage stellen, ob wir eher das Gute oder das Schlechte an dieser neuen Form der Wahlfamilie sehen wollen. Die Affinities werden weder glorifiziert noch dämonisiert, ihre Vor- und Nachteile erörtert Adam im Gespräch mit In- und Outsidern, wie es anschließend die LeserInnen tun können und höchstwahrscheinlich auch tun werden. Ein spannendes Buch, das zum Diskutieren anregt - yep, Wilson is back.
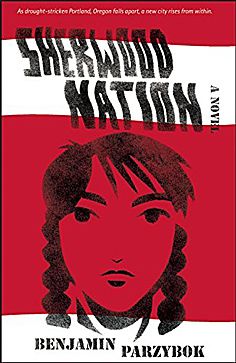
Benjamin Parzybok: "Sherwood Nation"
Broschiert, 400 Seiten, Small Beer Press 2014
Ein Buch, das gleichermaßen Optimismus und Pessimismus in sich trägt, gleichzeitig rührend und nüchtern, witzig und ernsthaft ist, eine Liebesgeschichte und eine Revolution erzählt - und bei der Schilderung dieser Revolution an Robert A. Heinleins "The Moon Is a Harsh Mistress" ebenso denken lässt wie an George Orwells "Animal Farm": Das ist US-Autor Benjamin Parzybok mit seinem zweiten Roman "Sherwood Nation" gelungen - satte sechs Jahre nach seinem schrägen Debüt "Couch".
Das Szenario
Zur Ausgangslage: Veränderungen in den Strömungen des Pazifiks haben die amerikanische Westküste austrocknen lassen. Wer konnte, hat sich nach Osten abgesetzt, ehe die Rest-USA die Flüchtlingsströme mit einer neuen Binnengrenze stoppten. Das ausgedörrte Land ist verlassen, der verbliebene Rest der Westküstler hängt ohne große Hoffnung in den abgewirtschafteten Städten herum, wo eine sich recht feindselig gebärdende Nationalgarde Wasserrationen verteilt. Eine davon ist der Schauplatz des Romans: Parzyboks Heimatstadt Portland, Oregon.
Einmal mehr haben wir es also mit dem in den vergangenen Jahren häufiger vertretenen Szenario eines leisen, langsamen Kollapses zu tun - vergleichbar mit Darin Bradleys "Chimpanzee" oder Will McIntoshs "Soft Apocalypse". Aber auch an John Scalzis Anthologie "Metatropolis" sei hier noch einmal erinnert, in der es darum geht, wie sich die Städte von heute durch Grassroots-Initiativen den Herausforderungen von morgen stellen können. Und genau darum geht es auch in "Sherwood Nation" - allerdings muss hier für die Zukunft gekämpft werden.
Maid Marian betritt die Bühne
Hauptfigur des Romans ist Renee, eine junge Barista und Geschichtsstudentin, die sich ihrem Alter und dem Indie-Geist des US-Nordwestens entsprechend gerne auch mal politisch engagiert. Eines Tages nimmt sie an einer Aktion gegen die Ungerechtigkeit der Wasserverteilung teil. Die läuft nicht ganz so wie geplant und wird unverhofft zum Ausgangspunkt von etwas Neuem: Die Fernsehbilder zeigen eine junge Frau mit schwarzen Zöpfen - sie sieht aus wie die Tochter von Fidel Castro und Pippi Langstrumpf, heißt es -, die Wasserflaschen an Bedürftige verteilt. In den Medien läuft sie bald unter der Bezeichnung "Maid Marian", und Renees Freund Zach, der aus der Werbung kommt, ist als Erstem klar, dass hier eine neue Marke geboren wurde.
Renee wird ihre neue Rolle bald annehmen. Zunächst versteckt sie sich im ärmsten Viertel Portlands vor der Polizei. Dann zieht sie dort ein Nachbarschaftshilfe-Netzwerk auf - und ehe man sich versieht, wird daraus eine Sezession. Maid Marian erklärt das Viertel zur unabhängigen Mikronation Sherwood und lässt diese von den grüngewandeten "Rangern" bewachen, die sich rasch um ihre neue Ikone versammeln. Manchmal hadert Renee mit ihrer neuen Macht - aber gleichzeitig genießt sie sie auch immer mehr. Renee gelingt es, den BewohnerInnen ihrer kleinen Nation wieder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Aber nicht alles ist eitel Wonne: Sie geht ein Zweckbündnis mit dem Gangsterboss Gregor ein, trifft einige sehr harte Entscheidungen, nennt Sherwood selbst ausdrücklich eine Diktatur - und als sie mit Sabotage konfrontiert wird, antwortet sie mit der Invasion eines angrenzenden Stadtteils. Alles steuert letztlich auf einen gewaltsamen Höhepunkt zu.
Humanistische Grundhaltung
Die grimmigeren Züge seines Romans gleicht Parzybok mit viel Menschlichkeit aus. Rührend, wenn Zach und die ins Exil gegangene Renee einander Morsebotschaften schicken, die sie über die Dächer hinweg mit einem Laserpointer auf einen Wasserturm projizieren.
Oder nehmen wir Renees Gegenspieler, Portlands Bürgermeister Brandon Bartlett. Der wird nicht etwa als Schurke gezeichnet. Stattdessen bringt Parzybok ihn uns wiederholt im häuslichen Umfeld - videospielend oder bei seinem Ehemann Christopher Halt suchend - nahe. Bartlett wäre ein guter Bürgermeister für gute Zeiten geworden. Stattdessen sieht er sich in einen immer härter werdenden politischen Mehrfrontenkrieg hineingezogen und ist davon völlig überfordert. Während einer TV-Ansprache an die Bevölkerung Portlands bricht er in ein kindlich verzweifeltes "I want you to like me!" aus.
Kein Protagonist wird auf seine Rolle reduziert. Parzybok versteht es, jedem von ihnen liebenswerte Züge zu verleihen - auch Gangster Gregor oder dem neurotischen Nevel, einem Arbeitskollegen Zachs. Nevel träumt davon, der heldische Beschützer seiner kleinen Familie zu sein - er weiß bloß nicht, wie. So hält er es für die beste Idee, Nacht für Nacht an einem immer komplexeren Tunnelsystem unter seinem Haus weiterzugraben, das bar jeden Sinns ist (für die Handlung aber noch eine Rolle spielen wird). Außerdem sorgt Nevel mit seinen skurrilen Gedankengängen zwischendurch für Comic Relief. Als nach der Sezession Sherwoods die von ihm befürchteten Riots ausbleiben, denkt er etwa: There was a crash from across the street and the fear returned, but it was quiet enough through the windows that he wondered if people were rioting privately in the comfort of their own homes. "Sherwood" ist durchgängig sprachlich erfrischend - und immer wieder muss man einfach laut auflachen, ehe es wieder ernst wird.
Gute Lektüre
Für die Romanfiguren fühlt man nicht zuletzt deshalb so viel Sympathie, weil sie nicht die typischen Heroismusprofis sind, die immer wissen, was zu tun ist, sondern meistens geradezu amateurhaft agieren. Kein Wunder, sind sie doch allesamt mit einer für sie völlig neuen Situation konfrontiert. Sehr menschlich, das Ganze. Am wenigsten gilt dies noch ausgerechnet für die Hauptfigur Renee, die bei mir zugegebenermaßen den Daenerys-Targaryen-Effekt ausgelöst hat (mit anderen Worten: sie ist mir stets ein bisschen unheimlich geblieben).
Insgesamt ein sehr schöner Roman über ein nur allzu realistisches Zukunftsszenario - bis auf einen einzigen Punkt: Klimatologisch gesehen ist es unmöglich, dass Portland ein Schicksal wie das in "Sherwood Nation" beschriebene droht, wie Parzybok im Nachwort selbst zugibt. Aber in anderen Regionen, wie zum Beispiel hier ...
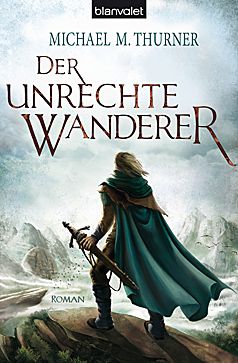
Michael M. Thurner: "Der unrechte Wanderer"
Broschiert, 505 Seiten, € 14,40, Blanvalet 2015
Wattebäusche in Kampfer tränken und in die Nase stopfen! Es geht wieder in die gräulich stinkende Fantasywelt Michael M. Thurners, die er uns bereits in "Der Gottbettler" so nahe brachte, dass es uns den Atem verschlug. Auch in "Der unrechte Wanderer", das auf dem "Gottbettler" aufbaut, aber ebenso wie dieser eine weitgehend abgeschlossene Handlung hat, wird wieder jede Substanz, die der menschliche Körper abzusondern vermag, ihren Auftritt haben - inklusive Ektoplasma.
Eigenwillige Welt
Die Hauptanlaufstelle für Mittelalter-Fantasy bin ich zugegebenermaßen nicht. Aber bei Thurner kann man immerhin darauf hoffen, dass er ein paar originelle Ideen zum Worldbuilding einfließen lässt. Und dass sich nicht nur axtschwingende Zwerge und Hoodie tragende AssassinInnInnInnInnen in der Handlung tummeln (und Meisterdiebe natürlich, beinahe hätte ich auf die Meisterdiebe vergessen). Einen diplomierten Food-Designer, der in Teilzeit Tupperpartys organisiert, bringt Thurner zwar auch nicht - stattdessen bestreiten Hexen, Huren, Zauberer und ein Arbeitsloser das Geschehen. Aber gut, in eisenzeitlichen Gesellschaften war die Palette an Ausbildungswegen ja auch überschaubar.
Und was das Worldbuilding und den gesellschaftlichen Aufbau seiner Welt anbelangt, da hatte Thurner tatsächlich wieder einige hübsche Ideen. Zum Beispiel einen wandernden Hexenturm, der mit den in ihm hausenden Frauen in einer Art Symbiose lebt - mehr schlecht als recht gesteuert von einem Hexensessel aus, einer Art organischem Cockpit mit zwangsintegrierten Körperteilen (man[n] möchte in einen Hexenturm nicht einbrechen ...). Oder ein Reitmensch, der seinen verkrüppelten Herrn durch die Gegend trägt, ihn füttert und ihm die Windeln wechselt. Oder die Baumstadt Torhauvn, das etwas andere Lothlorien. Und allen voran die Treibgierde: Eine Insel, die sich unter einer Zeitblase befindet, damit sich dort männliche und weibliche Magie in extremer Zeitlupe befetzen können, ohne den Gang der Außenwelt zu stören.
Neue Gesichter ...
Aus dieser Treibgierde wird eines Tages die Titelfigur des Romans buchstäblich ausgeschieden. Eldar, der "unrechte Wanderer", findet sich somit in der für ihn fernen Zukunft wieder - im Grunde ist "Der unrechte Wanderer" also auch ein Zeitreiseroman. Und ein bisschen zeitgenössischer Horror kommt auch dazu: Zunächst landet Eldar, der von Fischern aufgegriffen wird, nämlich in einer Hillbilly-Siedlung, deren Bewohner Namen wie Monlar der Schisser und Matty Arschlöffel tragen, und muss dort eine Behandlung über sich ergehen lassen, die an Folterpornos im Kino denken lässt. Später kommt er unter äußerst blutigen Umständen frei und ist von da an Spielball im Kampf zweier magischer Fraktionen: Sowohl die weiblichen Wicca als auch die männlichen Magicae (keine Ahnung, warum sie eine feminine Endung haben) reißen sich um das "Objekt" aus der Treibgierde, in dem sie den Schlüssel zu großer magischer Macht vermuten.
Im Grunde also ist Eldar, der die meiste Zeit über einen recht nutzlosen Eindruck machen wird, ein lebender MacGuffin. Zur heimlichen Hauptfigur des Romans mausert sich hingegen Amelia Dusong: Einstmals eine reiche Kaufmannsfrau, wurde sie dazu gezwungen, sich im Heerestross des Gottbettlers, der seine ganz eigene Vorstellung von sozialem Ausgleich hatte, zu prostituieren. Nach dem Ende seiner Feldzüge macht sich Amelia - inzwischen mit jeder Menge Überlebensfähigkeit ausgestattet - auf die Suche nach ihren verschwundenen Söhnen. Eine eher hoffnungslose Mission, die sie aber schließlich mit Eldar und den übrigen ProtagonistInnen zusammenbringen wird, um eine questentaugliche Fellowship zu bilden.
... und alte Bekannte
Wieder mit dabei sind zwei alte Bekannte aus dem Vorgängerroman, die gleichzeitig als StellvertreterInnen des zentralen Konflikts fungieren: Terca, von der wir mittlerweile wissen, dass sie keine Durchschnittshexe ist, sondern bereits Jahrtausende auf dem Buckel hat und ebenso lange an den Fäden des Geschehens zieht. Und der junge Zauberer Pirmen Courtix, der im "Gottbettler" noch ein Sympathieträger war, sich aber innerlich wie äußerlich sehr zu seinem Schlechteren verändert hat. Da die Macht der Magicae auf Hass und Schmerz basiert und durch Selbstverstümmelung wächst, hat sich Pirmen einen erklecklichen Prozentsatz seiner Körperteile amputieren lassen. Und ist nun ein mächtiges Scheusal, das seinen geduldigen Reitmenschen mit seinem Benehmen ebenso wie mit seinen Körperfunktionen quält.
Womit wir auch schon beim dritten alten Bekannten aus "Der Gottbettler" wären, der hier wiederkehrt: Der Odeur von Untergang, wie es zu Anfang des Romans einmal heißt. Eine poetische Formulierung für die unhygienischste Fantasywelt seit Terry Gilliams "Jabberwocky".
Es wird zu einigen überraschenden Wendungen kommen - was nicht zuletzt daran liegt, dass in jeder Figur mehr steckt, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Beim Quasi-Zombie Nerbo Falthaut ist es der übernatürliche Parasit, der seinen Leichnam mobil hält. Bei Amelia ist es eine Gabe, von der sie selbst nichts weiß. Terca ist sowieso undurchschaubar, sogar für sich selbst. Eldar hat keinerlei Erinnerungen an seine Zeit in der Treibgierde, außer dass er seine verlorene Geliebte retten muss: Eine noble Mission ... wären da nicht auch gewalttätige Schübe, in die er manchmal verfällt, als hätte er plötzlich eine vollkommen andere Persönlichkeit. Und was Pirmen anbelangt: Bei dem schlummert tief in seinem zerstörten Körper möglicherweise noch irgendwo ein Herz.
Fantasy mit SF-Herz
Ein Wort noch zum zentralen Konflikt des Romans. Da hätten wir auf der einen Seite die ebenso machtgierigen wie destruktiven Magicae mit ihrer vollkommenen Verachtung für körperliche Unversehrtheit. Und auf der anderen Seite die rational, aber kaum weniger skrupellos agierenden Wicca mit ihren Langzeitplänen (so lang, dass sich Terca manchmal kaum noch daran erinnern kann, was sie selbst vor Jahrtausenden ausgeheckt hat). Irgendwie erinnert mich das unwillkürlich an den Machtkampf zwischen Bene Tleilax und Bene Gesserit.
Undenkbar wäre die Parallele nicht, immerhin kommt Thurner aus der Science Fiction. Von dort hat er auch einige Tugenden mitgebracht - allen voran die, eine eigenständige Welt zu konstruieren und sich nicht ausschließlich auf Archivmaterial zu stützen. Und darum ist "Der unrechte Wanderer", das vielleicht einen Tick weniger abgeschlossen ist als "Der Gottbettler", genauso lesenswert wie sein Vorgänger.
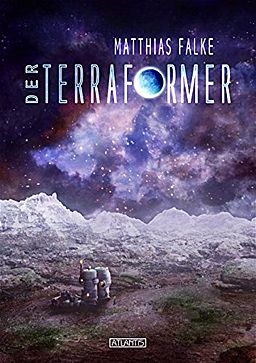
Matthias Falke: "Der Terraformer"
Broschiert, 300 Seiten, € 14,30, Atlantis 2014
Für LeserInnen, die in der Buchhandlung erst einmal ein paar Seiten schmökern, ehe sie sich für Kauf oder Nichtkauf eines Buchs entscheiden, setzen AutorInnen ganz gerne einen Knalleffekt an den Anfang ihres Romans. Nicht so Matthias Falke, der uns als Start über einige Seiten hinweg einen routinemäßigen Arbeitsablauf kredenzt. Es ist ein ruhiger Einstieg, der sich gut als Eröffnungssequenz eines Films eignete. Doch vielleicht ist es gerade diese Routine, die aus dem betulich vor sich hin arbeitenden Anders McCoy später noch einen Superagenten mit selbstausgestellter Lizenz zum Töten machen wird. Töten mit den Mitteln eines Terraformers wohlgemerkt.
Anders hat im Auftrag einer interstellaren akademischen Organisation die Aufgabe übernommen, einen besiedelbaren, aber noch gänzlich unbelebten Planeten zu terraformieren. Im Alleingang! Zu diesem Behufe setzt er zunächst allerlei gentechnisch aufgemotzte Mikroben aus, die binnen weniger Jahre das erledigen sollen, was auf der Erde einige hundert Jahrmillionen gedauert hat. Nebenbei: Die Gentechnik sorgt zwar fürs Tempo des Terraformings - allerdings frage ich mich unwillkürlich, wie diese Welt danach jemals zu einem ökologischen Gleichgewicht finden wird, wenn da Superorganismen in Umlauf sind, die innerhalb von Monaten die ganze Atmosphäre umkrempeln könnten. Dürfte eine ziemliche evolutionäre Hölle voller tickender Zeitbomben werden - aber das nur am Rande bemerkt, für die weitere Handlung spielt der Planet ohnehin keine Rolle mehr.
Die Steine kommen ins Rollen
Eigentlich sollte Anders ja allein auf seiner Welt sein. Doch eines Tages kommt ein Fremder aus der Geröllwüste gestapft: Ein Bewohner der etwas rückständigen Erzwelten, wie sich herausstellen wird, den man hier wegen einer Ehrenschuld ausgesetzt hat. Körperlich und charakterlich erweist er sich als genauso klobig wie sein Name Roderick Stirgardsson. Ehre, Stärke und Familie sind seine wichtigsten Werte: der perfekte Widerpart also für den vernunftgeprägten Softie Anders. Das ungleiche Duo entwickelt bald eine typische Männerfreundschaft, die ohne viele Worte auskommt - Anders fragt seinen Gast erst nach Wochen, wie er eigentlich hierhergekommen ist -, und das alleine hätte bereits Stoff genug für eine stimmungsvolle Novellette abgegeben.
Von mir aus hätte das auch gerne noch eine Weile so weitergehen können, aber Falke stellt den kontemplativen Gang rasch ab und switcht auf Such- und Verfolgungsjagdmodus. Stirgardsson leiert Anders dessen Rettungskapsel aus dem Kreuz und setzt sich ab, um seine Ehre wiederherzustellen. Dafür schwebt Stirgardssons Todfeind Orlufsson ein, entführt (aus für mich übrigens nicht nachvollziehbaren Gründen, aber what the heck) Anders und nimmt ihn auf eine Raumstation voller vierschrötiger Erzweltler mit.
Anders allein im All
So findet sich der leicht angestaubte Wissenschafter also plötzlich allein unter Wikingerklingonen wieder ... und stellt fest, dass es ihm Spaß macht. Auf seine Rolle als Maskottchen reagiert er zunächst überraschend entspannt und später sogar mit wachsendem Vergnügen. Ohne dass Falke es groß aussprechen müsste, erleben wir mit, wie sich jemand - erst einmal aus seiner grauen Routine herausgerissen - freispielt und Schritt für Schritt seine neue Rolle als selbstständiger Akteur akzeptiert.
Anders begegnet Stirgardssons kratzbürstiger Ehefrau Ragna, begibt sich mit ihr auf die interstellare Suche nach ihrem Mann und ist ihr von Anfang an in innigem Zank verbunden. Sie bitchen hin, sie bitchen her - einmal mehr spielt Falke seine größte Stärke aus: Nämlich in munterer Weise das Zusammenspiel seiner Figuren zu zeichnen; das hat er ja bereits in "Kristall in fernem Himmel" vorgeführt.
Über den witzigen Dialogen zwischen Anders und Ragna hätte ich fast die äußerlichen Attraktionen vergessen, von denen es natürlich auch einige gibt. Unter anderem einen riesigen ausgehöhlten Asteroiden, einen Wüstenplaneten voller tödlicher Pilzsporen und ein waschechtes Thing (nicht Ben Grimm von den Fantastischen Vier oder sonst ne englische Bedeutung, sondern im germanischen Sinne).
Der eine oder andere Mangel, aber ansonsten ...
Ein paar Unwahrscheinlichkeiten muss man schon konstatieren. Etwa dass Stirgardsson auf der Oberfläche eines ganzen Planeten rein zufällig nahe genug an Anders' Terraformingstation abgesetzt wurde, um sie noch erreichen zu können, ehe seine Vorräte aufgebraucht sind. Oder dass Anders Ragna, die er noch nie zuvor gesehen hat, in einer Menschenmenge allein aus Stirgardssons Beschreibung wiedererkennt. Oder dass man ihm ganz ohne akademischen Formularmarathon mal eben das modernste Raumschiff der Galaxis für eine Privatqueste zur Verfügung stellt. Und alle drei Unwahrscheinlichkeiten waren notwendig, um die Handlung fortführen zu können.
Ein erzähltechnischer Aspekt hat bei mir zudem ein paarmal für leichte Irritation gesorgt: Auch wenn in dritter Person erzählt wird, kann man bis zu einem gewissen Grad Einblick in die Gedankengänge einer Figur erhalten. Einer Figur pro Abschnitt, zumindest in einem Roman, der wie "Der Terraformer" erzählt wird. Wenn wir aber im selben Kapitel lesen, was sich abwechselnd im Kopf der einen und der anderen abspielt, dann wirkt das merkwürdig. Aber das sind Kleinigkeiten.
Insgesamt ist "Der Terraformer" - trotz der genannten Abstriche - ein unterhaltsamer Roman irgendwo zwischen Space Opera, Hard SF und Pulp. Und kann mit einigen der heuer für den Kurd-Laßwitz-Preis nominierten Bücher durchaus mithalten.
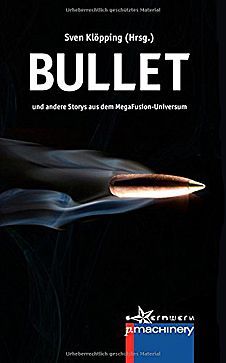
Sven Klöpping (Hrsg.): "Bullet"
Broschiert, 195 Seiten, p.machinery 2014
Shared Universes lese und bespreche ich nur in Ausnahmefällen - ich habe dabei immer das Gefühl, dass mir zuviele Insiderinformationen fehlen, um die Erzählungen angemessen beurteilen zu können. "Bullet" scheint da aufs Erste auch nicht geeignet zu sein, Schwellenängste abzubauen. Immerhin enthält der schmale Band von weniger als 200 Seiten ein zehnseitiges(!) Glossar. Dazu kommen dann noch eine ganze Menge Fußnoten in den einzelnen Erzählungen - und trotzdem werden Massen unerklärter Neologismen über einem zusammenschlagen. Aber "Bullet" enthält auch gleich zwei Erzählungen, die beim Kurd-Laßwitz-Preis (KLP) als beste Kurzgeschichte nominiert sind, also habe ich den schon länger bei mir herumliegenden Band doch noch in Angriff genommen.
Hintergrund
Das Grundszenario des von Sven Klöpping geschaffenen "MegaFusion"-Universums ist eine den ganzen Globus umspannende Stadt - ähnlich also wie bei "Magnus dem Roboterkämpfer" oder "John Difool". Vom Feeling her deutlich näher an Letzterem, denn hier sind Zynismus und skrupelloser Kapitalismus Trumpf (in "Glücklichland" von Frederic Brake beispielsweise betreiben Konzerne ihr Headhunting mit Schusswaffen). Das liest sich mehr als alles andere wie Cyberpunk und fühlt sich darum auch eher an, als würde es 30 Jahre in der Zukunft liegen - statt der veranschlagten ca. 3.000. Immerhin gibt's hier auch noch E-Zigaretten und Einkaufswagen.
"Shared" ist das MegaFusion-Universum übrigens erst mit diesem Band - bis dato hatte Klöpping es mit einer ganzen Reihe von Erzählungen allein bestückt. Hier hält er sich mit nur zwei kürzeren Erzählungen weitgehend zurück, beide davon mit auffälligem Schluss ("Crime Sponsoring" über einen angehenden Attentäter mit einer schadenfrohen Schlusspointe, "Homebasejump!" über einen Adrenalinjunkie, der sich von Wolkenkratzern stürzt, mit einem seltsamen Nachsatz aus der realen Welt, wie ihn TV-Verfilmungen zur Einordnung des Geschehens gerne vor den Credits einblenden).
¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ándale!
Mit "Der große Gig" von Dirk Ganser alias D. J. Franzen legt die Anthologie einen Kickstart hin: Ein Ermittler klinkt sich in die rekonstruierten Erinnerungen eines Musikmanagers ein, um eine Welle von Selbstmorden zu klären, die mit den Auftritten einer Band in Zusammenhang zu stehen scheinen. Das wird für den Ermittler zu einem Hochtempo-Trip voller schneller, greller Impressionen und wartet zudem mit einem gelungenen Twist auf. Der "Gig" ist nicht hundertprozentig frei von Klischees (für jeden "sabbernden Idioten" sollte ein Autor fünf Euro ins Phrasenschwein werfen, ebenso wie für einen - hier zum Glück nicht enthaltenen - "gähnenden Abgrund"). Aber insgesamt liefert Franzen einen wirklich guten Auftakt ab.
Zugleich ist damit die Vorgabe für den Rest der Anthologie gemacht: Sex, Gewalt, Geld, Drogen, Gossensprache und ein bisschen Rock'n'Roll. Und vor allem: Tempo. Christian Künne mit "Die Uhr schlägt nicht mehr" und Michael Schmidt mit "She" setzen Franzens erzählerischen Sprint fort; das liest sich teilweise wie Stuckrad-Barre auf Speed.
Die Kandidaten
Da tut es gut, wenn nach diesem Trio der erste KLP-Nominierte seinen Auftritt hat und das hysterische Tempo rausnimmt. In Thorsten Küpers "Der Mechaniker" soll ein Software-Spezialist einen reichen Klienten aus einer wahrhaft misslichen Lage befreien: Den hat nämlich ein Robotermädchen mit dem Mund am Penis arretiert wie ein Jagdhund, der auf sein Herrchen wartet. Die - schon wieder - mit einem Twist aufwartende Geschichte ist im Prinzip Golden-Age-SF (plus Sex-Einschlag, den man sich damals nicht getraut hätte) und zählt tatsächlich zu den stärksten Erzählungen der Anthologie.
Witzigerweise könnte man auch dem zweiten KLP-Nominierten das Golden-Age-Siegel aufdrücken, wenn man die Story erst mal auf den Kern reduziert und den aufgesetzten Kraftmeierslang, von dem ich Vincent Voss eher abgeraten hätte, abzieht (wer sagt heute noch "Stecher"?). Sein "Bullet" entwirft jedenfalls ein klassisches Dilemma: Ein verbitterter Mann, der Frau, Job und Status verloren hat, erhält ein für eine fiktive Zukunftswelt typisches unmoralisches Angebot. Otis hat nämlich in einer Lotterie drei Kugeln gewonnen - inklusive der Zusicherung von Straffreiheit, wen auch immer er damit erschießen wird. Ziemlich großartige Idee.
Stilistisch ist die gesamte Anthologie stark von Pop-Literatur beeinflusst, was natürlich bedeutet: Geschmackssache. Völlig aus dem Rahmen fällt hingegen Stefan Blankertz, der sich in "Rambo II" in Sprachdekonstruktion übt: Der richtige Happen für alle diejenigen, die 2013 Reinhard Jirgls "Nichts von euch auf Erden" geschafft haben. Also nicht für mich - aber mit einer Geschichte wie "Rambo II" wartet nicht jede SF-Anthologie auf, das verdient Respekt.
Das Thema Sprache
Ein zentrales Element im Worldbuilding von "MegaFusion" ist die Sprache. Hier als Neupalaver bezeichnet, was einige AutorInnen tendenziell in Richtung Denglish, die anderen eher als Sammelsurium von Neologismen interpretieren. Eine künstliche Zukunftssprache zu entwerfen, ist in der SF natürlich nichts Neues - siehe etwa Anthony Burgess' "A Clockwork Orange" oder John Brunners "Stand on Zanzibar". Beide Beispiele demonstrieren zugleich allerdings auch, dass kaum etwas so antiquiert wirkt wie der Zukunftsslang von gestern.
Das kann den "MegaFusion"-AutorInnen zwar wurscht sein (Schreiben mit Anspruch auf Zeitlosigkeit ist ja erst recht öde) - allerdings könnte man sich eine gewisse Konsistenz erwarten. Bei einigen AutorInnen kommt das Neupalaver hier aber als krude Mischung aus nord- und süddeutscher Umgangssprache, aus Früh-80er-Coolsprech und 15 Jahre jüngerem Hip-Hop-Slang daher, was dann extrem künstlich wirkt. Deutlich besser kommt das in "Revenge" von Marianne Labisch rüber, die hier unter dem putzigsten Pseudonym seit langem schreibt: Diane Dirt. Ich kann aus der Ferne nicht beurteilen, inwieweit sich die Kodderschnauze ihrer Hauptfigur an einen real existierenden deutschen (rheinländischen?) Dialekt hält, aber zumindest stechen hier keine völlig unpassenden Wörter als sprachliche Fremdkörper raus.
Highlight
"Revenge" ist die Geschichte einer in den Untergrund verbannten Prostituierten, die in die Welt der Reichen und Schönen zurückkehrt, um Rache zu nehmen. Und ist meine Lieblingsgeschichte in dieser Anthologie nicht nur deshalb, weil sie Witz hat, sondern weil sie auch in einer ungewöhnlichen Form erzählt wird: Nämlich wie ein Audioprotokoll, bei dem nur die Stimme der Hauptfigur zu hören ist. Es gibt weder beschreibende Passagen, noch hören wir die Dialogteile von anderen Figuren, sondern ausschließlich die Antworten unserer fiesen "Heldin" - und das reicht völlig. Gekonnt gemacht. Und zwar nicht für den KLP, aber dafür - zusammen mit Küpers "Mechaniker" - für den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert. Zu Recht, wie ich finde.
Wie schon gesagt: Nicht allen AutorInnen hier kaufe ich die Gossensprache ab - bei einigen hatte ich doch den Eindruck, sie hätten beim Schreiben ein verschämtes Grinsen im Gesicht getragen (Hihi, ich hab "Scheiße" sagen dürfen. "Arschloch."). Andererseits hat Klöpping mit der Vorgabe des Grundtons dafür gesorgt, dass "Bullet" etwas hat, was man jeder Anthologie nur wünschen kann: einen eigenständigen Charakter.

Hardy Kettlitz: "Die Hugo Awards 1953 - 1984"
Klappenbroschur, 315 Seiten, € 19,50, Golkonda 2015
Was für ein Timing! Der erste Teil von Hardy Kettlitz' genrehistorischem Rückblick auf die Hugo Awards erscheint fast genau zu dem Zeitpunkt, da der altehrwürdige Science-Fiction-Preis in die vielleicht größte Krise seiner Geschichte gestürzt wird. Für ältere Semester bekommen Rudi Carrells legendäre Worte "Das wäre Ihr Preis gewesen" plötzlich eine ganz neue Bedeutung ...
Die leidige Gegenwart
Ein ausführlicherer Überblick über die unter dem Schlagwort "Puppygate" kursierende Kontroverse ist hier nachzulesen. Als Kurzzusammenfassung für Ungeduldige, an denen die Sache bislang vorbeigegangen ist: Eine Gruppe erzählerisch und politisch konservativ ausgerichteter AutorInnen hat sich von den Preisvergaben der vergangenen Jahre übergangen gefühlt und die nach wie vor unbewiesene Behauptung in den Raum gestellt, eine kleine Clique von Linken, Feministinnen usw. würde durch Absprachen und ein intransparentes Auswahlverfahren alle Spielarten von Science Fiction, die ihr nicht in den Kram passen, blockieren. Weshalb besagte konservative AutorInnen, die unter dem Emblem "Sad Puppies" firmieren ... eine kleine Clique gebildet haben, die durch Absprachen und ein intransparentes Auswahlverfahren alle Spielarten von Science Fiction, die ihr nicht in den Kram passen, blockiert. In diesem Fall in allen Punkten nachweisbar und nachgewiesen.
Mittel ihrer Wahl war eine vorgefertigte Liste von Nominierungen für die im August vergebenen Hugo Awards. Diese drückten sie mittels Blockabstimmung ihrer AnhängerInnen durch und hebelten damit die individuellen Nominierungen von Fans weltweit fast zur Gänze aus: Die Arithmetik macht es nämlich auch einer kleinen Minderheit leicht, sich durchzusetzen, wenn der an Zahl bedeutend größere Rest einzeln und divergent abstimmt. Inwieweit dieses Vorgehen zu der von den "Sad Puppies" eingeforderten Demokratisierung der Hugo Awards passt, sei dahingestellt - es war formal regelkonform. (Noch. Änderungen des Nominierungsverfahrens werden bereits diskutiert.) Und nicht nur, dass sie für ihren persönlichen Profilierungsversuch einen weltanschaulichen Hintergrund bemühen. Verschärft wird die Situation noch dadurch, dass sie sich bei ihrem Coup von einer ideologisch wesentlich radikaler gesinnten Gruppe mit Namen "Rabid Puppies" unterstützen ließen - mit dem christlichen Verleger Vox Day, der sich bereits in der Gamergate-Kontroverse als Brandstifter hervorgetan hat, als zentraler Figur.
Getrennt marschiert, vereint zugeschlagen: Zusammen haben die beiden "Puppies"-Gruppierungen es geschafft, dass von den insgesamt 85 Hugo-Kandidaten in allen Kategorien 59 von ihren beiden Listen kommen. Der gesamte Rest der Fan-Welt muss sich mit ganzen 26 begnügen - in einigen Kategorien stehen sogar ausschließlich "Puppies"-Kandidaten zur Wahl. Die von den "Puppies" geschaffene Variante von Demokratie entspricht damit einer Bürgermeisterwahl, bei der sämtliche KandidatInnen aus derselben Partei kommen. Dieser noch nie dagewesene Umstand, verbunden mit der ideologischen Agenda der "Puppies", hat zu einem Aufschrei im Fandom geführt - und der zu der nicht enden wollenden, aber genau genommen auch nicht enden dürfenden Puppygate-Debatte, in der die SF-Welt nun seit Wochen steckt. Was kann man tun, um den angesehensten Science-Fiction-Preis der Welt zu retten? Mir fällt nur eines ein, das steht am Schluss dieser Rundschau. Jetzt erst mal zurück in ein bedächtigeres Zeitalter.
Es war einmal
Angesichts dieses mit Zähnen und Klauen geführten Kulturkampfs fühlt sich Hardy Kettlitz' Hugo-Rückschau an, als würde man nach der Straßenschlacht mal eben in Omas Wohnung zu Kaffee und Kuchen vorbeischauen. Alles so schön ruhig hier! Das Buch ist eine lückenlose Gesamtaufstellung aller PreisträgerInnen von 1953 bis 1984. Und das nicht nur in den prestigeträchtigsten Kategorien wie "Bester Roman" - vom besten Fanillustrator bis zum besten Semiprozine wird hier auf niemanden vergessen. Ehre, wem Ehre gebührt.
In Zeiten von Wikipedia wird sich mancher natürlich die Frage stellen, wozu er das auf Papier braucht - aber man sollte nicht unterschätzen, wie effizient ein gut in der Hand liegendes Buch für einen schnellen Überblick ist. Und zur Ausgangsbasis für Stöbersafaris im Antiquariat werden kann. Dabei hilft ungemein, dass Kettlitz, der mit der langjährigen Reihe "SF Personality" die vielleicht wichtigste Sammlung von SF-bezogener Sekundärliteratur im deutschsprachigen Raum herausgibt, mit makelloser Sorgfalt vorgegangen ist: Zu jedem Werk wird angegeben, unter welchem Titel bzw. welchen Titeln es auf Deutsch erschienen ist, in welcher Sammlung man es findet - und wenn es auf Deutsch nie herauskam, dann ist das ebenfalls vermerkt. Die Bilder der Buchcover sind zwar schwarzweiß und kaum größer als Briefmarken, aber gut genug gerendert, dass man darauf sogar die Untertitel lesen kann - was ebenfalls hilfreich ist.
Ein konkretes Beispiel, was diesen Nutzen-Aspekt anbelangt: In meiner Kindheit hatte ich mal einen alten Comic-Band, der auf SF-Kurzgeschichten basierte. Den hätte ich - wie das halt so ist - in meinem zweiten SF-Leben als Erwachsener gerne wieder gehabt. Aber ohne noch irgendeinen Titel oder Autor oder Verlag nennen zu können - also keine Chance. Aus den Inhaltsangaben in Kettlitz' Band konnte ich nun tatsächlich rekonstruieren, wie diese Comic-Anthologie einst hieß, zumindest im Original ("Starstream" aus den 70er Jahren; falls jemand weiß, wie die deutsche Ausgabe hieß, gerne posten). Lang lebe Hardy Kettlitz!
Was noch besser ginge
Ein kleiner Abstrich ist für mich, dass Kettlitz gerne mit dem Inhalt eines Werks auch gleich den Schluss miterzählt. Sollte einem also etwas verheißungsvoll Klingendes unterkommen, von dem man zuvor noch nie gehört hat, kneife man beizeiten die Augen zusammen und schiele am Rest des Absatzes vorbei. Klar, mit steigendem Alter eines Werks wird es immer lächerlicher, von "Spoilern" zu reden. (Haben Romeo und Julia glücklich bis ans Ende ihrer Tage gelebt und so viele Kinder bekommen wie die Waltons? Ob Odysseus wohl jemals nach Hause gefunden hat?) Aber wenn wir uns im noch folgenden Band 2 bis an die unmittelbare Gegenwart herantasten, scheint mir ein Tick mehr Vorsicht angebracht.
Ein weiterer Punkt, in dem sich ein solches Buch als der Wikipedia überlegen erweisen könnte, wäre forcierte Hintergrundbetrachtung. Das eine oder andere Essay zum Wesen der Hugos oder der SF insgesamt hätte man hier schon unterbringen können, aber außer einer kurzen Einführung von John Clute und Peter Nicholls beschränkt sich der Band auf die Fakten. Mit kleineren Ergänzungen im Haupttext - etwa wenn Kettlitz in einem Jahrgang mit vielleicht schwächeren PreisträgerInnen ergänzt, was im betreffenden Jahr noch so erschienen ist und keinen Hugo erhalten hat. Oder wenn er die Inhaltsangaben mit seiner persönlichen Meinung würzt. (Und wenn er das tut, ist er sich seiner stets sehr sicher: "Zweifellos ...", "Es besteht kein Zweifel ..." oder mein persönlicher Favorit: "Das erkannten auch die Leser und Kritiker.").
Der Atem der Geschichte
Das Stöbern in alten Tabellen kann schon witzig sein - wenn man etwa nachliest, dass ein alter Haudegen wie Philip José Farmer auch mal als "Best New SF Author" galt (1953) und Urgestein Robert Silverberg als "Most Promising New Author" debütierte (1956). Ein paar Mal geht es sogar über den Genrehorizont heraus, und aus der nüchternen Faktenauflistung weht uns der Atem der Zeitgeschichte entgegen: So war 1969 "Yellow Submarine" der Beatles als "Best Dramatic Presentation" nominiert. Und im Jahr darauf gewann in derselben Kategorie kein Werk der Fiktion, sondern die Fernsehübertragung der Mondlandung.
Einen direkten Brückenschlag von der Vergangenheit zur Gegenwart findet man übrigens auch: 1982 wurde erstmals Mike Glyer mit einem Preis bedacht, der sich in seinem später noch vielfach ausgezeichneten Fanzine "File 770" ausführlich mit den Aktivitäten innerhalb des SF-Fandoms beschäftigte. Damals noch auf Papier. Heute, über 30 Jahre später, ist Glyers "File 770" eine Website, die ich in den vergangenen Wochen täglich besucht habe, da sie die beste, weil umfassendste Dokumentation des Stimmensturms von Puppygate bietet. So sieht ein Genre mit lebendiger Tradition aus.
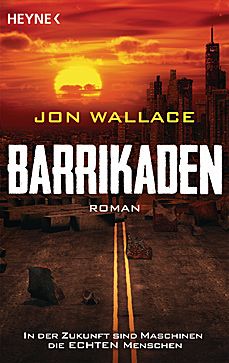
Jon Wallace: "Barrikaden"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "Barricade", 2014)
Vor dem Schlusswort noch ein Hinweis auf eine Übersetzung: Hand aufs Herz - niemand liest Rezensionen ausschließlich vor dem Kauf, um sich eine Übersicht über neuerschienene Produkte zu verschaffen. Man blättert sie auch nach der Lektüre noch einmal ganz gerne durch, um zu sehen, ob andere die Meinung bestätigen, zu der man gekommen ist. Zu dem Motiv gibt's auch eine Unterkategorie für RezensentInnen: He, ich hab das Buch schon in der Originalausgabe besprochen - und jetzt hat es ein Verlag übersetzt. Die fanden es offenbar auch gut, juhu!
Kurz zum Inhalt
Jon Wallaces "Barricade" hatte ich sogar in meinen Jahrescharts (hier der Link zur Langrezension) - am 11. Mai kommt nun die deutschsprachige Ausgabe heraus. Es ist ein ebenso witziger wie bitterböser Roadtrip durch ein postapokalyptisches Großbritannien, der die LeserInnen so ganz nebenbei mit ein paar äußerst ungemütlichen Situationen konfrontiert.
Der Hintergrund: Die künstlich gezüchteten Ficials (so heißen sie auch auf Deutsch) sollten den Menschen eigentlich im Alltag helfen - stattdessen haben sie sie weitgehend ausgerottet. Was vom Homo sapiens übrig blieb, haust nun in der Wildnis, siecht an den Folgen von ABC-Waffeneinsätzen vor sich hin und attackiert bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Ficials, die sich in den Städten verbarrikadiert haben. Kurz: Die Menschen nehmen hier die Rolle ein, die in klassischen postapokalyptischen Szenarien von Mutanten und Ungeheuern gespielt wird - während wir die genozidgeübten Ficials als die zu verteidigende Zivilisation akzeptieren müssen. Hat was!
+++ Alles ist anders +++
An dieser Stelle folgt üblicherweise ein kurzer Ausblick auf die kommende Rundschau in möglichst kryptischer Formulierung. Stattdessen halte ich diesmal aus aktuellem Anlass - Puppygate - klare Worte für angebrachter. Ich rufe alle LeserInnen der Rundschau dazu auf, sich an der Abstimmung über die heurigen Hugo Awards zu beteiligen.
Stimmberechtigt ist jeder SF-Fan weltweit, der sich für die World Science Fiction Convention anmeldet. Dazu muss man diese aber nicht direkt besuchen (mein Glückwunsch allerdings an alle, die sich den Luxus gönnen, zur anderen Seite der USA nach Spokane, Washington zu fliegen). Es gibt auch eine "Supporting Membership", die 38 Euro kostet und in der Ferne dasselbe Stimmrecht verleiht, als wäre man vor Ort. Zur Online-Registrierung kommt man hier: Worldcon 2015: Registration. Die vergangenen Wochen haben eine noch nie dagewesene Welle an Neuregistrierungen für die Wahl gesehen - es ist eine Mobilmachung in Pelennor-Dimensionen. Und das Spannende: Niemand vermag zu sagen, welcher Seite des Konflikts diese Stimmen zugute kommen werden.
Warum soll ich da mitmachen?
Natürlich ist da jetzt die Frage berechtigt: Was gehen mich US-amerikanische Kulturkriege an? Nun, erstens gehen uns amerikanische Befindlichkeiten auf lange Sicht leider immer etwas an. Zweitens heißt es nicht umsonst "World Convention", und wie sich schon die Ents sagen lassen mussten: "You are part of this world, aren't you?" Und drittens: Wer Science Fiction - was völlig legitim ist - als reinen Zeitvertreib betrachtet und nicht als etwas, für das man sich engagieren müsste ... nun, selbst der muss sich in einem stillen Moment der Wahrheit stellen, dass es nicht an einem großen kosmischen Zufall liegt, was da so im Regal seiner Buchhandlung zum Kauf bereitliegt. Die Hugo Awards waren seit jeher ein wichtiger Indikator für deutschsprachige Verlage, welche Werke sie übersetzen könnten. Was man unter anderem daran ersehen kann, dass mit nur zwei Ausnahmen alle Hugo-Gewinner der vergangenen 35 Jahre auch auf Deutsch erschienen sind. Auf einem immer kleiner werdenden Übersetzungsmarkt ist es erst recht sinnvoll, diesen Indikator nicht komplett anderen zu überlassen.
Darum: Mitstimmen - wie und auf welche Weise, bleibt natürlich jedem und jeder selbst überlassen. Aber Hauptsache mitstimmen. Dein Genre braucht dich. (Josefson, 9. 5. 2015)