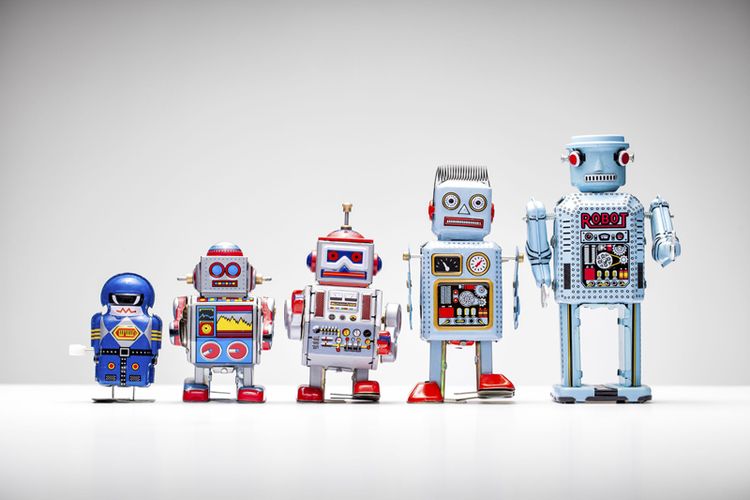Man trifft sie auf Straßen und in Kaffeehäusern: Menschen mit einer Spendenbüchse, die für Kinder mit Leukämie oder anderen lebensbedrohlichen Leiden sammeln. Manch einer mag sich da wundern. Wieso muss in einem so wohlhabenden Land wie diesem noch immer Geld für Kranke gesammelt werden? Gibt es etwa keine umfassende Gesundheitsversorgung und bestens ausgestattete Spitäler?
Ganz so einfach ist das leider nicht. Gerade in Bezug auf die Behandlung von kindlicher Leukämie hat die Medizin zwar große Fortschritte gemacht und damit die Heilungschancen stark erhöht, doch für weitere Durchbrüche fehlt schlichtweg das Geld, wie die Kinderärztin Ruth Ladenstein am St.-Anna-Kinderspital berichtet.
Gegen einige seltene Formen des Blutkrebses gebe es noch keine wirklich guten, gezielten Therapien. Es herrsche weiterhin Forschungsbedarf. "Und das geht nicht ohne Drittmittel."
Teure Entwicklungskosten
Die pharmazeutische Industrie indes hat oft kein Interesse. Die Patientenzahlen sind zu gering, um damit Profite zu erwirtschaften. Der finanzielle Aufwand dagegen ist enorm. Eine große klinische Studie kostet leicht achtstellige Summen, allein für die erforderlichen Versicherungen können schon einige Millionen fällig werden.
Geldmangel ist allerdings nicht das einzige Problem. Um die Wirksamkeit eines neuen Medikaments auf solider wissenschaftlicher Basis zu prüfen, muss man es Patienten verabreichen. Betrifft es spezielle Krankheiten von Kindern, dann eben auch ihnen. "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen", betont Ladenstein.
Die kindliche Physiologie weise viele wichtige Unterschiede auf, die zu berücksichtigen seien. Trotzdem müssen sich Ärzte oft behelfen. Sie setzen Standardwirkstoffe ein und berechnen die Dosis auf Basis des geringeren Körpergewichts. Vor allem bei Babys kann diese Praxis Risiken bergen, meint Ladenstein. "90 Prozent der Medikamente sind nicht speziell für die Allerkleinsten getestet."
Studien mit und für Kinder
Die am Wiener St.-Anna-Kinderspital tätige Expertin plädiert deshalb eindringlich für mehr Forschung. Doch es ist mühsam, genug Teilnehmer für klinische Studien zu finden. Zum einen wegen der Seltenheit einiger Krankheiten, zum anderen, weil die Eltern der jungen Patienten oft skeptisch sind. Ihr Liebstes als Versuchskaninchen? Nein, danke.
Ladenstein will diesen Bedenken entgegentreten. Als Geschäftsführerin der Organisation Kinderarzneiforschung (Okids) verweist sie auf die besonders intensive Betreuung minderjähriger Studienteilnehmer. Und die Kleinen haben natürlich auch schneller Zugang zu neuen, potenziell vielversprechenden Medikamenten. Um weitere Aufklärungsarbeit zu leisten, brachte Okids vergangene Woche eine spezielle Informationsbroschüre heraus.
Die Pädiatrie hat vor allem im Bereich Tumorbehandlung hohe Hürden zu bewältigen. Jedes Jahr erkranken in Europa rund 15.000 Kinder an Krebs. Etwa 3000 von ihnen sterben. Die Behandlung mit gängigen Chemotherapeutika kann Erfolg haben, doch die meisten dieser Wirkstoffe wurden ursprünglich gegen typische Erwachsenentumore wie Brust- oder Prostatakrebs entwickelt, einige sind noch nicht für den Einsatz bei Kindern freigegeben.
"Heute", erklärt Ruth Ladenstein, "geht die Zulassung nach Indikation", auf Basis des Krankheitsbildes also. Ein Medikament lasse sich aber besser aufgrund seiner physiologischen Wirkung einstufen. Denn die kann es in einem Brustkarzinom oft genauso gut entfalten wie in einem kindlichen Muskelsarkom.
Gendefekte erforschen
Leider ist auch die Vielfalt an seltenen, gefährlichen Erbkrankheiten bei Mädchen und Buben erstaunlich groß. Mucopolysaccharidose, kurz MPS, zum Beispiel kommt in mindestens sieben verschiedenen Varianten und mehreren Dutzend Subtypen vor. Verursacher sind einzelne Gendefekte mit verheerenden physiologischen Folgen.
Der Hintergrund: Überall im menschlichen Körper werden ständig sogenannte Mucopolysaccharide produziert. Deren langkettige Moleküle haben diverse Funktionen, doch ihre Lebensdauer ist begrenzt. Nach Gebrauch bauen Zellen sie wieder ab und recyceln die Bestandteile:
Dieser Prozess erfordert das koordinierte Zusammenspiel von nicht weniger als elf verschiedenen Enzymen. Kein Einziges darf fehlen, sonst sammeln sich immer mehr unverarbeitete Mucopolysaccharidreste an. Molekularer Müll, sozusagen. Den Zellen und Organen bekommt diese Verschmutzung gar nicht gut. Die Symptome reichen, je nach MPS-Typ, von Wachstumsstörungen über Herzwandverdickung, einer vergrößerten Leber und Hautschwellungen bis hin zu geistiger Behinderung.
DNA reparieren
Die ersten Anzeichen weisen oft nicht eindeutig auf MPS hin – man muss das Erbgut unter die Lupe nehmen. Viele der Patienten indes werden nicht älter als 20, 30 Jahre. Ihre Behandlung konnte lange nur auf Symptombekämpfung abzielen, aber inzwischen gibt es neue Perspektiven.
Enzymersatztherapien führen dem Körper den fehlenden, nicht von ihm selbst produzierten Stoff zu. Unter Normalbedingungen kann das künstlich hergestellte Enzym allerdings nicht die Blut-Hirn-Schranke passieren, sodass die Gehirnzellen weiter Schaden nehmen. Zur Überwindung dieses Problems werden zurzeit molekulare Transportmechanismen entwickelt.
Weitere Möglichkeiten bietet der Einbau von synthetischen DNA-Sequenzen mit dem Code für das jeweils fehlende Enzym. Sie lassen sich mit umgebauten Viren ins Erbgut der Zellen einschleusen. Auch auf diesem Gebiet wird intensiv geforscht. "Durch neue Wege neue Hoffnung schaffen", sagt Ruth Ladenstein. (Kurt de Swaaf, 10.12.2015)