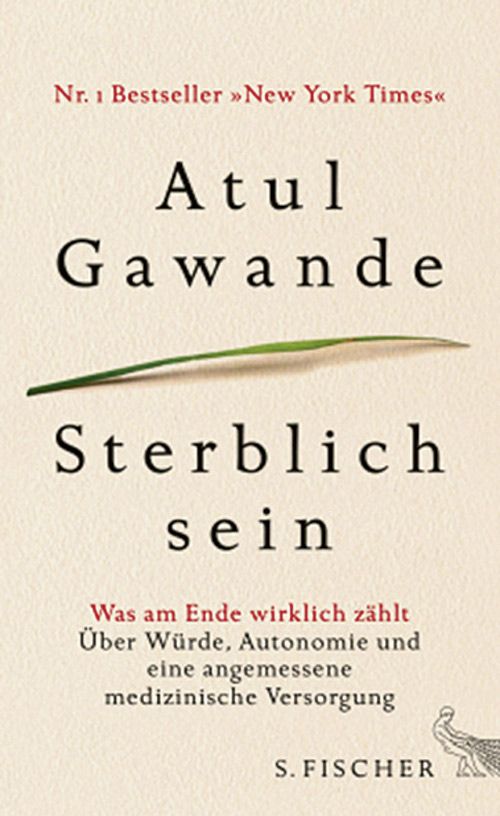STANDARD: Sie haben ein Buch über ein Thema geschrieben, das die meisten Menschen lieber verdrängen. Warum?
Atul Gawande: Ich bin Arzt. Ich schreibe Bücher, weil mir diese Arbeit hilft, Probleme durchzudenken – Probleme, die mich jeden Tag beschäftigen. Als junger Arzt habe ich über die Unwegsamkeiten in der Ausbildung nachgedacht, später über andere Unzulänglichkeiten unseres Berufsstandes. Jetzt bin ich lange genug Arzt, um zu wissen, dass es viele medizinische Probleme gibt, die ich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht lösen kann. Die Frage ist: Wie gehe ich mit unheilbar kranken Patienten um?
STANDARD: Sie meinen mit Todkranken?
Gawande: Nicht unbedingt. Ich spreche von Patienten, für die die Medizin keine Heilung anbieten kann. Das ist etwa dann der Fall, wenn alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Es gibt aber auch viele chronische Erkrankungen, die tendenziell nur noch schlechter werden, ein Prozess, der also durch nichts mehr aufzuhalten ist. Dann gibt es viele Menschen, die für eine Therapie zu alt sind. Sie werden immer zahlreicher und machen einen Großteil unserer Patienten aus. Die entscheidende Frage ist: Wie kann ich, wenn ich ein Problem nicht mehr lösen kann, trotzdem Zuversicht vermitteln. Darin sind wir Ärzte unheimlich schlecht.
STANDARD: Wie meinen Sie: Darin sind wir Ärzte schlecht?
Gawande: Wir können uns ganz schwer eingestehen, dass wir keine Lösung mehr anbieten können. Aber wir doktern weiter herum und schlagen alle möglichen Optionen vor, ohne uns die Frage zu stellen, ob sie auch für Patienten wirklich sinnvoll sind. Wir haben eine hohe Kunst darin entwickelt, den Tod hinauszuzögern. Wenn wir Patienten mit einer unheilbaren Erkrankung vor uns haben, fokussieren wir uns auf die Krankheit, weniger auf den Menschen, der sie hat. Das machen wir schon sehr lange. Weil Ärzte am Ende des Lebens die wichtigsten Ansprechpartner sind, ist der Tod oder das Sterben nicht mehr ein natürlicher Prozess, sondern ein medikalisierter Vorgang.
STANDARD: Was wäre die Alternative?
Gawande: Die zentrale Frage sollte sein, was Patienten guttut, wenn sie unheilbar krank sind. Ein einschneidendes Erlebnis war die Krebsdiagnose meines Vaters. Er ist Arzt, ich bin Arzt, meine Mutter ist Ärztin. Als wir erfuhren, dass wir es mit einem unheilbaren Gehirntumor zu tun haben, war das ein Schock. Wir holten Meinungen ein. Es gab widersprüchliche Empfehlungen. Wir waren angesichts der Optionen total überfordert.
STANDARD: Ist das eine persönliche Geschichte?
Gawande: Nein, sondern nur der letzte Anstoß, mich mit Sterblichkeit, einem komplett unterbelichteten Thema in unserer Gesellschaft, auseinanderzusetzen. Für dieses Buch habe ich mit mehr als 200 Patienten und ihren Familien gesprochen, ich war in Pflege- und Altersheimen, habe mich mit Hinfälligkeit auseinandergesetzt.
STANDARD: Was ist die Quintessenz Ihrer Recherche?
Gawande: Dass es eine Art von kollektivem Hadern mit dem Tod gibt. Dass es Menschen gibt, die besser und die schlechter damit zurechtkommen, und dass es Weichenstellungen dafür gibt. Als Sohn eines unheilbar kranken Vaters hatte ich keine Ahnung, wie wir trotz dieser schweren Situation Zuversicht bewahren können. Dabei wäre es doch sehr wichtig, Menschen mit ihrer Sterblichkeit so zu konfrontieren, dass sie einen Weg finden können.
STANDARD: Ist das überhaupt die Aufgabe von Ärzten?
Gawande: In unserem Studium lernen wir jedenfalls nichts über die Sterblichkeit. Das Sterben wird immer ausgeklammert. Wir lernen, wie der Körper funktioniert, welche Krankheiten es gibt, wie man Probleme wieder in Ordnung bringt. Die Idee, den Körper reparieren zu können, hat mich auch Chirurg werden lassen. Ich bringe Dinge wieder in Ordnung – mit meinen beiden Händen. Es gibt aber eben Grenzen.
STANDARD: Welche Grenzen?
Gawande: Widersprüche. Zum Beispiel jenen, wenn wir durch unser ärztliches Handeln enormes Leid verursachen. Und das machen wir ganz sicher. In der Medizin gibt es dieses Credo, dass Überleben immer die Priorität haben muss, mehr als das Wohlergehen eines Patienten. Wie es jemandem nach einem Eingriff gehen wird, daran denken wir oft gar nicht, wenn wir Entscheidungen für eine Therapie treffen. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, der nur um des Lebens willen leben will. Die Dinge, für die Menschen leben, sind immer größer und vielfältiger als die Tatsache, bloß am Leben zu sein.
STANDARD: Wie hat sich Ihre professionelle Einstellung zu Patienten verändert?
Gawande: Ich habe im Zuge meiner Recherchen herausgefunden, dass jeder Mensch, solange er lebt, ein Ziel hat. Das hört im Alter und in der Krankheit nicht auf. Kein Mensch sagt, das Ziel seines Lebens ist ein guter Tod. Insofern musste ich erkennen, dass es meine Aufgabe ist, die Frage zu beantworten, was für den Patienten vor mir ein gutes Leben ist, ein gutes Leben bis zum Ende. Man stirbt schließlich nur einmal.
STANDARD: Und wie unterscheidet sich das von Ihrem früheren Zugang?
Gawande: Wir Ärzte sind das fundamentale Problem. Wir und unser Unvermögen zu begreifen, was Erfolg in der Medizin bedeutet. Da sitzt man einem unheilbar kranken Menschen gegenüber, weiß, dass man ihn nicht heilen kann, weiß aber auch nicht, wie lange dieser Patient mit seiner Erkrankung noch leben wird und vor allem, wie und woran er sterben wird. Das ist ein Dilemma, das wir meist mit der Frage lösen: "Wollen Sie kämpfen?" Und dann bieten wir alles Mögliche an, suggerieren eine Behandlung. Das ist aber der falsche Zugang, denn wir gehen von der Annahme aus, dass es rein darum geht, die Lebenszeit zu verlängern. Richtig ist vielmehr die Frage: Wofür und warum wollen Sie am Leben sein? Und was sind Sie bereit, dafür in Kauf zu nehmen. Mit dieser Fragestellung verändert sich alles. Denn plötzlich geht es darum, genau diese Ziele zu bewahren.
STANDARD: Können Sie ein Beispiel geben?
Gawande: Entscheidende Fragen an Patienten sind aus meiner Sicht: Was denken Sie ganz persönlich über Ihren Gesundheitszustand? Wovor fürchten Sie sich? Was ist Ihnen wichtig im Leben? Und was sind Sie bereit, dafür zu opfern? Und was ist für Ihre Lebensqualität unbedingt notwendig? Der Vater meines Freundes sagte zum Beispiel: "Solange ich im Fernsehen Fußball anschauen und dabei Schokoladeeis essen kann, ist alles okay für mich. Wenn das eines Tages nicht mehr so ist, dann bitte lasst mich gehen." Als Arzt konnte ich mich gut danach richten. Es ist eine hilfreiche Orientierung bei sämtlichen Entscheidungen.
STANDARD: Wie funktionierte das bei Ihrem Vater?
Gawande: Für ihn war das Wichtigste, dass er so lange wie möglich weiter als Chirurg arbeiten kann. Danach haben wir uns gerichtet, haben nicht operiert, solange seine Hände noch nicht gelähmt waren.
STANDARD: Verändern sich diese Ziele nicht ständig?
Gawande: Natürlich, aber es ist ein natürlicher Prozess. Als mein Vater nicht mehr arbeiten konnte, war ihm am wichtigsten, mit Freunden zu sein, mit der Familie zu essen. Er war ein sehr sozialer Mensch. Wir haben uns in allen Entscheidungen daran orientiert – auch wenn es um die Chemotherapie ging. Vielleicht kann man aber sagen, dass allen Menschen eines gemeinsam ist: Sie wollen kein langes Leiden und keine Schmerzen. Und insofern ist es am Ende des Lebens Aufgabe des Arztes, dafür zu kämpfen, dass jeder Tag bestmöglich verläuft.
STANDARD: Denken Sie, dass Nichtstun manchmal die bessere Lösung als Therapie ist?
Gawande: Unheilbar Kranken das Leben so angenehm wie möglich zu machen hat erwiesenermaßen einen Effekt auf die Lebensdauer. Es gibt eine Studie mit Lungenkrebspatienten, die eine ganz bestimmte Form der Erkrankung hatten. Ihre durchschnittliche Überlebensprognose war elf Monate. Man teilte sie in zwei Gruppen ein. Die eine bekam reguläre Chemotherapie, die andere Palliativtherapie, was bedeutete, dass es bei jeder Maßnahme darum ging, die individuell definierten Kriterien von Lebensqualität eines Patienten zu berücksichtigen. Die Diskussion rund um diese Studie hatte zur Folge, dass einige die Chemotherapie abbrachen.
STANDARD: Wie war das Endergebnis?
Gawande: Patienten ohne Chemotherapie lebten durchschnittlich um 25 Prozent länger. Sie verbrachten mehr Zeit zu Hause, mussten weniger ins Spital. Die meisten Menschen wollen übrigens daheim und nicht im Krankenhaus sterben. Das Gegenteil ist der Fall.
STANDARD: Sich als Patient gegen eine Therapie zu entscheiden wird doch fast wie ein Skandal betrachtet, oder?
Gawande: Nicht, wenn sich Ärzte und Familie darauf einigen, sich an dem zu orientieren, was "einen guten Tag haben" für einen Patienten bedeutet. Medikamente oder Therapien sollten das nicht zerstören.
STANDARD: Wie definieren Sie Leiden?
Gawande: Dann, wenn die Selbstbestimmung aufhört, beginnt Leid. In vielen Pflegeheimen ist das der Fall. Ich erinnere mich an eine Alzheimerpatientin, deren größte Freude es war, trockene Kekse zu essen. Das wurde ihr aber von ihrem Arzt verboten, weil die Gefahr, sich zu verschlucken, zu groß war. Ähnliches passiert tausende Male. Ich denke, hier sollte sich der Zugang zu den Dingen ändern. Die großen Probleme am Ende des Lebens beginnen immer, wenn wir plötzlich auf die Hilfe anderer angewiesen sind, abhängig werden, Selbstbestimmung verlieren. Das verursacht das größte Leid.
STANDARD: Was raten Sie Patienten und ihren Angehörigen, wenn es um Arztgespräche geht?
Gawande: Ich denke, es wäre besser, wenn Patienten ihre Ärzte mehr als Berater denn als Verkäufer betrachten. Als mein Vater krank wurde, holten wir zwei getrennte Meinungen ein. Die beiden Onkologen rieten uns ganz unterschiedliche Therapien. Mein Vater, meine Mutter und ich hatten zusammengerechnet 120 Jahre Medizinwissen aufzuweisen, doch wir waren komplett überfordert. Keiner der beiden Krebsspezialisten fragte meinen Vater, was ihm im Leben wichtig ist. Dafür lieferten sie uns durchschnittliche Überlebenszeiten.
STANDARD: Sind Zahlen keine Orientierung?
Gawande: Nein. Mit mittlerer Überlebenszeit können Nichtmathematiker kaum etwas anfangen. Die Frage, die Ärzte beantworten sollten, ist die, was das kürzeste und was das längste Überleben bei einer Therapie war. Nur so bekommen Menschen eine realistische Einschätzung von der Zeit, die ihnen noch bleibt. Mein Vater musste hören, dass seine durchschnittliche Überlebenszeit drei Jahre sind. Das hat ihn und uns überrascht, er dachte, es wäre länger. Danach wusste er, dass er jeden Tag voll nutzen musste. De facto lebte er nur noch ein Jahr.
STANDARD: Was tut ein guter Arzt bei einer schlechten Prognose?
Gawande: Als Arzt sollte man sich weniger auf die Krankheit seines Patienten als auf dessen Wünsche konzentrieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Irgendeine experimentelle Therapie gibt es immer noch. Die meisten Ärzte glauben nicht einmal selbst daran, wenn sie sie vorschlagen. Meist verlängern solche Therapien nur das Leid und nehmen Menschen die Selbstbestimmung.
STANDARD: Könnte eine im Voraus festgelegte Patientenverfügung die Weichen stellen?
Gawande: Meist werden bei solchen Instrumenten die falschen Fragen gestellt. Reanimation? Beatmung? Künstliche Ernährung? Darunter können sich Gesunde nichts vorstellen. Es geht also darum, die Vorlieben eines Menschen vor gesundheitlichen Krisen zu kennen. Sie immer wieder zu thematisieren, sie verändern sich ja auch. Drei Viertel aller Menschen in der westlichen Welt brauchen am Lebensende Unterstützung. Wenn wir wissen, was jemand mag und was nicht, bringt das eine enorme Erleichterung. Ich hatte einen Patienten, dessen letztes wichtigstes Ziel war es, sich mit einem Buch in sein Bett verkriechen und lesen zu können. Seine Kinder und Enkelkinder zu sehen zählte für ihn wenig. Daran konnte ich mich als Arzt gut orientieren. Es gibt so viele unterschiedliche Lebenskonzepte und Wünsche, die wir als Ärzte berücksichtigen und unterstützen können.
STANDARD: Braucht man nicht unendlich viel Zeit, diese Wünsche herauszufinden?
Gawande: Ich sage nur eines: In einem Operationssaal fragt niemand, wie lange ich brauchen werde. Dort gibt man mir alle Zeit der Welt. Wir haben in den letzten Jahrzehnten der Technologie in der Medizin viel zu große Bedeutung zugeschrieben und die menschlichen Faktoren vernachlässigt. Und nein, es dauert nicht lange, über die Wünsche von Menschen zu sprechen.
STANDARD: Haben Sie selbst Angst vorm Altwerden?
Gawande: Erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass ältere Menschen auch sehr glücklich sein können. Sie müssen sich nichts mehr beweisen. Das kann eine durchaus neue und gute Erfahrung sein. Natürlich habe auch ich vor Gebrechlichkeit Angst. Ich denke aber, dass ich, solange ich das Gefühl habe, mein Leben autonom gestalten zu können und nicht von Ärzten und Institutionen kontrolliert zu werden, diesen Prozess gut aushalten werde. Es gibt doch die Frage: "Was würden Sie am letzten Tag Ihres Lebens machen?" Da hat jeder seine Antwort. Stellen wir uns doch vor, wie würden jeden Tag so leben, als wäre es der letzte. Dann wäre das Lebensende eine gute Zeit. (Karin Pollack, CURE, 26.5.2016)