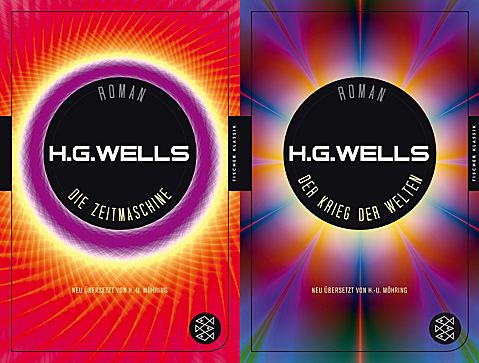
H. G. Wells: "Die Zeitmaschine" & "Der Krieg der Welten"
Gebundene Ausgaben, 237 bzw. 303 Seiten, € 20,60 bzw. € 22,70, Fischer 2017 (Original: "The Time Machine", 1895 & "The War of the Worlds", 1898)
Für unsere Reihe "Lesen wir doch mal wieder einen Klassiker" tun sich hier gleich zwei hervorragende Gelegenheiten auf: Der Fischer-Verlag hat vor kurzem die beiden vermutlich bekanntesten Romane von H. G. Wells in neuer Übersetzung wiederveröffentlicht. Und ob es nun an der liegt oder an Wells' erzählerischem Vermögen: Beide lesen sich nach wie vor frisch. Vor allem "Der Krieg der Welten" verblüfft mit seinem Tempo – das würde man sich auch von so manchem heutigen SF-Autor wünschen!
Dass Wells nicht nur originelle Ideen hatte, sondern es auch verstand, diese gekonnt rüberzubringen, zeigen überdies einige tendenziell humorvolle Kurzgeschichten, die der Ausgabe von "Krieg der Welten" angefügt sind. "Der denkwürdige Fall von Davidsons Augen" dreht sich um einen Mann, der nach einem [insert Handwaving-Erklärung here]-Unfall blind für seine Umgebung ist, weil seine Augen nun das sehen, was sich gleichzeitig auf der anderen Seite der Erde abspielt. Diese Erzählung würde sich, was Idee und Umsetzung anbelangt, noch heute in jedem aktuellen Best-of-Kurzgeschichten sehr gut machen. Ähnlich gelungen ist "Das Land der Blinden", in dem ein Mann ein Tal erreicht, dessen BewohnerInnen keine Augen mehr haben. Er reibt sich schon die Hände, weil der Sehende bekanntlich der Blinden König ist ... doch da hat er sich sauber verrechnet, wie sich zeigen wird.
Paarlauf der Klassiker
Aber zurück zu den beiden Haupterzählungen, deren Handlung man als bekannt voraussetzen darf. Faszinierend sind die vielen Parallelen zwischen diesen zwei Klassikern. Das fängt schon damit an, dass beide mit der Zeitreise respektive der Alien-Invasion ein bis heute fix zum SF-Repertoire gehörendes Subgenre mitbegründet haben. Und anders als die meisten Werke des anderen "Vaters der Science Fiction", Jules Verne, sind sie auch bis heute pure SF geblieben.
Beide teilen auch das Los, dass sie mehr Menschen über ihre Filmadaptionen als über die Romanform selbst bekannt sein dürften. Das heißt wiederum in beiden Fällen eine zum Kultklassiker gewordene Version aus der Mitte des 20. Jahrhunderts ("The War of the Worlds" 1953 und "The Time Machine" 1960) sowie jeweils eine aus dem neuen Jahrtausend (2005 bzw. 2002), auf die die Reaktionen etwas gemischter ausfielen. Interessanterweise fühlten sich auch in beiden Fällen die Macher der Neuverfilmungen bemüßigt, den Stoff mit Human Drama anzureichern: Steven Spielberg versah seinen Weltenkrieg wieder mal mit einer Vater-Sohn-Kiste und in der "Time Machine"-Schnulze von Simon Wells zog der Zeitreisende gar los, um seine Verlobte zu retten.
Mit Wells hatte das alles nicht mehr viel zu tun. Der war bekannt dafür, auf die zwischenmenschlichen Aspekte keinen besonderen Wert zu legen (bezeichnendes Indiz: in beiden Romanen tragen die meisten Figuren keinen Namen – nicht einmal die beiden Ich-Erzähler!). Seine Protagonisten spiegeln dies in ihren Motivationen klar wider: Der Zeitreisende zieht nämlich aus reiner Neugier los. Und der Erzähler von "Krieg der Welten" äußert zwar ein paar Lippenbekenntnisse über die Sorge um seine (ebenfalls namenlos bleibende) Ehefrau. In Wirklichkeit stellt er sie aber kurzerhand bei Verwandten ab und bricht geradezu begeistert in Richtung marsianische Invasionsarmee auf, um Katastrophen schauen zu gehen.
Blaupause des Genres
Wie einflussreich die beiden Erzählungen waren, zeigt sich an den zahllosen Variationen ihres Stoffs, die seitdem in Literatur und Film erschienen sind. Insbesondere "Krieg der Welten" hat geradezu eine Blaupause für sein Subgenre geschaffen, was den Ablauf betrifft: Erst wird ein mysteriöses Phänomen am Himmel gesichtet, dann stehen alle staunend und spekulierend um ein gelandetes Objekt herum. Es folgt der Schock einer ersten Gewaltexplosion. Dann sammelt sich voller Trotz und Zuversicht die Gegenwehr, im Roman herrlich mit diesen Worten karikiert: So ähnlich mochte sich ein ehrbarer Dodo auf Mauritius in seinem Nest aufgespielt haben, als er die Ankunft jenes Schiffs kommentierte, dessen erbarmungslose Besatzung nach tierischer Kost gierte. "Wir werden sie morgen zu Tode picken, meine Liebe." Die Gegenwehr zerbricht, es folgen Chaos und Entsetzen, das Wandern durch postapokalyptische Landschaften ... und nach all dem dann irgendwie doch noch ein Happy End.
Motivgeschichtlich interessant auch, wie man im Originaltext einige Details findet, die in den Verfilmungen – in mutierter Version – als beeindruckende Regieeinfälle erscheinen; beispielsweise der zerstörte Zug oder das Auftauchen der marsianischen Dreifüße über der Baumlinie in Spielbergs "Krieg der Welten". In der "Zeitmaschine" wiederum fand ich die eher koboldhaft beschriebenen Morlocks nie so spannend wie die riesigen Krebse, denen der Zeitreisende bei einem Trip in die fernste Zukunft begegnet, wo sie sich scherenklackernd durch die Gezeitenzone einer sterbenden Welt schleppen. Auch diese Verkörperungen des Niedergangs sind seitdem immer wieder im Genre aufgetaucht – denken wir nur an die "Lobstrosities" in Stephen Kings Saga vom Dunklen Turm.
Dauerthema Evolution
Im Anhang der Neuausgabe der "Zeitmaschine" finden sich gleich mehrere Texte zum Thema Evolution: einem der zentralen Punkte in Wells' Schaffen, insbesondere in diesen beiden Romanen. Die Biologie wird dabei stets mit der Soziologie verknüpft. So hat sich die Gesellschaft des Jahres 802.701 in "Die Zeitmaschine" in die kindlich-arglosen Eloi und die kannibalischen Morlocks aufgespalten. Das war aber keine zufällige Entwicklung, sondern eine Fortsetzung des von Wells antizipierten Trends der zunehmenden Aufspaltung von – wortwörtlich – Ober- und Unterschicht. Hier hat der Klassenkampf Biss.
In "Krieg der Welten" wiederum wird die Evolution nicht nur in Form der Mikroben, die die marsianischen Invasoren letztlich zur Strecke bringen, zum Akteur. Auch die Marsianer selbst sind nicht einfach irgendwelche Weltraumkraken. Ihnen wird eine – zugegebenermaßen abenteuerlich konstruierte – Abstammung von ursprünglich menschenähnlichen Wesen attestiert, die mit zunehmendem Grad an Technisierung alles "Überflüssige" wegentwickelten, bis sie letztlich kaum mehr als Gehirne mit ein paar Restfortsätzen waren. Ähnliches prognostizierte Wells der Menschheit in ferner Zukunft, wie die Evolutionstexte im "Zeitmaschine"-Anhang zeigen. Beide Bücher sind übrigens mit exzellenten Nachwörtern versehen, in denen Elmar Schenkel Wells' Werke in den zeitgenössischen Kontext stellt.
Kalt und immer kälter
In "Die Zeitmaschine" sind es Klassenkonflikte, die im Umweg über die Evolution auf die fast schon satirische Spitze getrieben werden. In "Krieg der Welten" ist es der Kolonialismus. Nüchtern verweist Wells (bzw. sein Erzähler) auf Beispiele aus der menschlichen Geschichte: In einem Ausrottungskrieg der europäischen Einwanderer wurden die Tasmanier trotz ihrer Zugehörigkeit zur Menschheit im Zeitraum von nur fünfzig Jahren vollständig vom Antlitz der Erde getilgt. Sind wir solche Apostel der Barmherzigkeit, dass wir uns beklagen dürfen, wenn die Marsianer uns im selben Geiste bekriegten? Später schreibt er sogar wortwörtlich von der Schreckensherrschaft des Menschen, die nun eben von einer anderen abgelöst werde. Größer könnte der Kontrast zum Menschenbild von "Independence Day" nicht sein!
Hätten irdische Bakterien nicht das entscheidende Wörtchen mitgeredet, dann wäre es am Ende vielleicht so gekommen, wie es eine weitere namenlose Figur ("der Artillerist") dem Erzähler prognostiziert und mit dieser These auch auffallend unwidersprochen bleibt: Die unterlegene Menschheit werde sich in ihre Rolle als Zuchtvieh der Aliens einleben und sich nach einiger Zeit fragen, wie ihre Ahnen ohne die "Hilfe" der Marsianer überleben konnten – Evolution abgeschlossen. Das ist alles in allem eine sehr kühle Sicht der Dinge und insbesondere des Dings Mensch, die Wells hier auslebt. Kein Wunder, dass die Filmemacher unserer Tage zur Zuckerglasur gegriffen haben.
Wir leben schließlich im Zeitalter der Sequels
Und noch eine letzte Parallele gibt es zwischen diesen zwei Romanen. Die ist zugleich – you saw it coming for a mile – die Überleitung zum nächsten Buch. Beide haben nämlich eine Fortsetzung aus der Feder von Stephen Baxter erhalten. Das grandiose "The Time Ships" ("Zeitschiffe") ist bereits 1995 erschienen. Und heuer zog Baxter mit der Fortsetzung von "Krieg der Welten" nach: "The Massacre of Mankind". Mehr dazu auf der nächsten Seite.
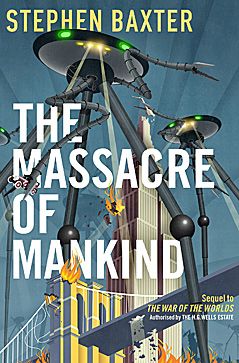
Stephen Baxter: "The Massacre of Mankind"
Gebundene Ausgabe, 464 Seiten, Gollancz 2017
119 Jahre nach dem Erscheinen von H. G. Wells' "Der Krieg der Welten" und in Romanzeit 13 Jahre nach der Auslöschung der ersten marsianischen Invasionsstreitmacht durch irdische Mikroben kommt es nun zu dem, was der Erzähler des Originalromans schon immer geahnt hatte: Die Marsianer kehren zurück – und diesmal haben sie ihre Impfpässe mit dabei.
The Sequel of Sequels
Im Fortsetzungenschreiben hat der britische Erfolgsautor Stephen Baxter mittlerweile Übung: Im vergangenen Jahr hatten wir "Die Medusa-Chroniken", aufbauend auf einer Erzählung von Arthur C. Clarke. Und schon 1995 veröffentlichte er die "Zeitschiffe" als bemerkenswert visionäre Fortsetzung von H. G. Wells' "Die Zeitmaschine". Anders als dieser Roman ist "The Massacre of Mankind" übrigens keine von Wells' Erben abgesegnete offizielle Fortsetzung; Baxter wartete mit dem Projekt genau so lange ab, bis das Copyright ausgelaufen war. Wir dürfen allerdings darauf vertrauen, dass Baxter – dem zu Recht eine Geistesverwandtschaft mit Wells nachgesagt wird – mit seiner Version das Original weitaus höher in Ehren hält als die vielen anderen inoffiziellen Fortsetzungen, die in der Zwischenzeit erschienen sind.
Das beginnt schon beim Titel. Falls den nämlich jemand zu reißerisch findet: Es handelt sich dabei um ein wörtliches Zitat aus Wells' Roman, der in Sachen Brutalität seinem 2017er-Nachfahren übrigens kaum nachstand. Wells wie Baxter beschreiben eindringlich, wie Menschen zu Tausenden von den Hitzestrahlen und dem schwarzen Giftgas der marsianischen Dreifüße hingeschlachtet werden ... und das sind noch längst nicht alle Waffen in ihrem Arsenal.
Apocalypse Redux
Kommen wir zunächst zur Handlung: "The Massacre of Mankind" gliedert sich in vier Abschnitte. Der erste bietet im Wesentlichen eine Wiederholung der Geschehnisse im Originalroman: Die Marsianer landen in der südenglischen Provinz, walzen jeden Widerstand platt und stürzen sich danach auf London. Offenbar von Rachegelüsten für ihre vorherige Niederlage erfüllt, zertrümmern sie dabei eine Sehenswürdigkeit nach der anderen wie in einem Roland-Emmerich-Film.
Da hat es auch nichts geholfen, dass die britische Gesellschaft seit der ersten Invasion (von Baxter aufgrund von Wells' vagen astronomischen Angaben auf 1907 datiert) von einer autoritären Regierung dauermobil gehalten wird. "It was the Berlinification of London", heißt es an einer Stelle über den Militarisierungsgrad der Gesellschaft. Mit Deutschland hat sich das Königreich gezwungenermaßen verbündet, nachdem der Kaiser in dieser Version der Geschichte, in der es statt einem Ersten Weltkrieg den Schlieffen War gab, fast ganz Europa erobert hatte. Andere Alternate-History-Elemente gibt es, aber nur als eingestreute Gags: So ist die Titanic hier dank Panzerung mit Mars-Aluminium nie gesunken und Einstein entwickelt Waffen für den Kaiser. H. G. Wells kommt übrigens (ungenannt, aber erkennbar) auch kurz vor – schon wieder eine Hommage, denn der hatte sich ja schon in seinen eigenen Roman (ebenfalls ungenannt) kokett selbst hineingeschrieben.
Der Anonymität entrissen
Als Hauptfigur und Ich-Erzählerin des Romans fungiert Julie Elphinstone, eine Journalistin und ehemalige Suffragette. Ich habe "Krieg der Welten" unmittelbar vor diesem Roman gelesen und kann daher nur sagen: Ich wusste wusste wusste es! Baxter hat sich wie ein Pteranodon auf alles gestürzt, was im Originalroman eine Sprechrolle oder gar einen Namen hatte – denn das waren wirklich nicht viele. Zum Beispiel wird im Original an einer einzigen Stelle ein Major Eric Eden erwähnt – schon findet er sich hier als tragende Nebenfigur und als einziger Mensch wieder, der je ein Marsschiff betreten hat. Miss Elphinstone wiederum begegnete in "Krieg der Welten" dem Bruder des Erzählers und wird hier zu dessen Schwägerin gemacht.
Zumeist verwendete Wells ohnehin nur funktionale Umschreibungen. Etwa den "Artilleristen", der im Originalroman seine schonungslose Sicht auf das Wesen des Menschen darlegte. Von Baxter mit dem Namen Albert Cook versehen, glänzt er auch hier als faszinierend ambivalente Figur. Opportunist und Widerstandskämpfer zugleich, selbstverliebt und eiskalt den eigenen Vorteil kalkulierend, aber auch eine Stimme der Vernunft: vielleicht ein Verräter an der Menschheit, vielleicht aber auch ein Held. Und zu guter Letzt erhält auch der Erzähler von "Krieg der Welten" selbst nachträglich einen Namen: Walter Jenkins. Er spielt hier jedoch nur eine Nebenrolle.
Die vormalige Namenlosigkeit der Wells-Figuren wird übrigens in witziger Weise thematisiert. Sie alle sind sich nämlich einig, dass sie in Walters/Wells' Buch – hier stets à la "Rotes Buch der Westmark" nur The Narrative genannt – nicht gut weggekommen sind. Und dass ihm das Zwischenmenschliche eben fremd sei. Ein Psychiater hält es ihm vor Augen: "And you don't name your own wife? How do you imagine she would feel about that?" Es ist die vielleicht beste, aber bei weitem nicht einzige Stelle, an der Baxter die Rezeptionsgeschichte von Wells' Klassiker in die Handlung einbaut.
Wo die Parallelen abzuweichen beginnen
I cannot help but acknowledge the long shadow cast by that tombstone of a volume which everyone knows as the "Narrative", the history of the First War penned by Walter, my esteemed brother-in-law, stöhnt Julie (respektive Stephen Baxter) an einer Stelle über die schier unmögliche Aufgabe, ein derart bekanntes Werk fortzusetzen. Baxter tut es, indem er den vollen Hommage-Modus anwirft. Sein Vorwort liest sich fast wie eine Kopie des Originalvorworts (und wie in diesem wird auch hier bereits eine mögliche Deus-ex-Machina-Lösung angedeutet). Die Erzählung erfolgt erneut im Rückblick und bietet damit Raum für einige ominöse Andeutungen ("Ach, hätte ich nur auf ihn gehört!). Und sie wechselt zwischen einem Hauptstrang in erster und einigen Nebensträngen in dritter Person. Wobei Baxter sich etwas beflissener als Wells klarzustellen bemüht, wann und wie die Fremdperspektiven in Julies Aufzeichnungen eingefügt wurden.
Ein klarer Unterschied – Zeichen der Zeit – ist der Umstand, dass Baxters Roman etwa zweieinhalbmal so lang wie der von Wells ist. Heute erzählt man eben breiter. Kürzungen wären im zweiten Teil des Romans durchaus drin gewesen: Der ist – für Baxter-Verhältnisse ein kurzer Zeitsprung – zwei Jahre nach der neuerlichen Invasion angesiedelt und schildert, wie Julie aus dem Exil auf dem Kontinent ins besetzte England zurückkehrt, wo sich die Menschen auf verschiedenste Weise mit der Präsenz der Außerirdischen arrangiert haben. Dieser Teil bringt eine gewisse Bremsung mit sich. In Teil 3 und 4 hingegen, wo die Invasion auf eine globale Ebene gehoben wird, beschleunigt sich das Geschehen wieder deutlich und erreicht fast die erzählerische Ökonomie von Wells.
Eine Empfehlung, fast uneingeschränkt
"The Massacre of Mankind" ist spannend, actionreich, klug (manchmal fast zu klug) in seinen Anspielungen und extrem sorgfältig im Aufgreifen von Wells' Motiven. Baxter muss sich ja die Hände über all die Geschenke gerieben haben, die ihm Wells in Form offener Fragen hinterlassen hat: Von den anthropomorphen Haustieren der Marsianer bis zu ihrer kurz angedeuteten parallelen Invasion auf der Venus wird hier alles wieder aufgegriffen, nichts vergessen. Zudem hat der Roman Witz, was zum einen an den Meta-Betrachtungen von "Krieg der Welten", zum anderen am herrlich britischen Understatement der Handlungsfiguren liegt. Als die Aliens Farmerin Mildred den Traktor unterm Hintern wegschießen, kommentiert sie dies mit: "I find that rather hard to forgive."
Eines allerdings unterscheidet den Roman von seinen eingangs erwähnten Pendants "Medusa-Chroniken" und "Zeitschiffe". Die eröffneten jeweils ganz neue raumzeitliche Horizonte, indem sie den ursprünglichen Handlungsrahmen extrem erweiterten und so trotz Hommagefaktors zu ganz eigenständigen Werken wurden. Das tut "The Massacre of Mankind" nicht. Es ist ... einfach ein Sequel. Ein sehr gelungenes, aber eben nur ein Sequel.
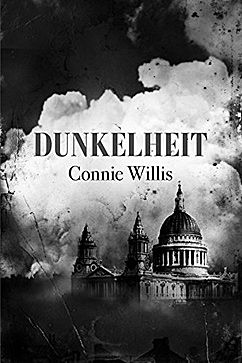
Connie Willis: "Dunkelheit"
Klappenbroschur, 714 Seiten, € 20,60, Cross Cult 2016 (Original: "Blackout", 2010)
Hat schon jemand in "SS-GB" reingeschnuppert? Die neue britische TV-Serie, die auf einem Roman Len Deightons basiert, spielt sich in einem Großbritannien ab, das von den Nazis besetzt worden ist – und wurde sicher nicht zufällig so bald nach dem Erfolg der US-Serie "The Man in the High Castle" auf den Markt geworfen. Und selbst die wurde ja nicht in einem Vakuum geboren: Seit Jahren boomen aufwändig gemachte "Period Dramas", in denen die Ära vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet wird – ob "Downton Abbey", "Indian Summers", "Das Haus am Eaton Place (Next Generation)" und so weiter. Hier wäre großartiges Material für eine weitere Serie!
Der literarische Kontext
"Blackout" ist der erste Teil einer megafetten – und trotzdem alles andere als schwerfälligen – Duologie, mit der die anglophile US-Autorin Connie Willis fast alle großen Genrepreise gewann. Dieser Doppelroman wiederum gehört zu einer Reihe jeweils in sich abgeschlossener Erzählungen um HistorikerInnen, die aus dem Oxford der 2050er bzw. -60er Jahre per Zeitreise zu den Originalschauplätzen ihrer Forschungsgegenstände aufbrechen. Da Willis den Kontext bereits in früheren Büchern etabliert hat, werden wir hier zu Beginn mit diversen Begriffen wie Bühne, Gleitung, Echtzeit oder Blitzzeit konfrontiert, die man sich als Neueinsteiger erst zusammenreimen muss; ergibt sich aber rasch von selbst.
Wichtig zu wissen ist, dass in diesem Universum Veränderungen der Vergangenheit als ausgeschlossen gelten. Offen bleibt nur, ob die verwendete – und von Willis nicht näher beschriebene – Zeitreisetechnologie oder das Zeitkontinuum selbst dafür sorgt, dass es nicht zu Paradoxa kommt, und gegebenenfalls Zeitreisende abseits ihres brisanten Wunschziels absetzt. Zumindest war dies bisher so. Zu Beginn des Romans wird kurz erwähnt, dass nicht mehr jeder Wissenschafter von der Unveränderlichkeit des Zeitablaufs überzeugt ist. Die drei Hauptfiguren des Romans werden ebenfalls noch so ihre Erfahrungen damit machen.
Helden des Alltags
Polly Churchill (den Nachnamen muss sie aus verständlichen Gründen austauschen) reist ins London des Jahres 1940, um zu studieren, wie die Menschen mit der Bombardierung ihrer Stadt klarkommen. Womit wir auch schon beim Kern des Romans wären: "Blackout" (betitelt nach der obligatorischen Verdunkelung Londons) ist ein ausgezeichnet recherchiertes und durch zahllose Details lebendig gemachtes Panorama des Krieges aus der Perspektive des kleinen Mannes bzw. der kleinen Frau. Verkäuferinnen, Fischer, Polizisten, Krankenschwestern: Sie sind die eigentlichen Helden des Geschehens.
Polly selbst hat von ihrem übervorsichtigen Vorgesetzten eine umfangreiche Liste mitbekommen, wann und wo jeweils eine Bombe einschlagen wird und welche Gegend sie unbedingt zu meiden habe. Aber ihr wird auch rasch klar, dass genau diese Gewissheit ihrer Forschungsaufgabe im Weg steht. Nicht zu wissen – das war das Einzige, was Historiker nie verstehen würden. Sie konnten die Gegenwärtler studieren, unter ihnen leben, versuchen, sich in sie hineinzuversetzen, aber sie konnten nicht wirklich das erleben, was sie erlebten. "Weil ich weiß, was passieren wird." Das gilt freilich nur solange, bis Pollys Mission schiefzugehen beginnt und sie sich plötzlich ebenfalls in Ungewissheit wiederfindet.
Satanische Kinder und traumatisierte Soldaten
Pollys Kollegin Eileen O'Reilly (eigentlich Merope, aber das ist nicht 20.-Jahrhundert-kompatibel) hält sich derweil im mittelenglischen Warwickshire auf, wohin Gruppen von Londoner Kindern evakuiert wurden. In der Rolle eines Hausmädchens hat sie vor allem mit dem Geschwisterpaar Alf und Binnie ihre liebe Not – zwei Paradebeispiele für das, was Goldie Hawn in "Overboard" als "Brut der Hölle" bezeichnete: Man muss die beiden mit ihren höchst kreativen Streichen einfach lieben.
Als dritter im Bunde wollte Michael Davies die Evakuierung der britischen Truppen aus Dünkirchen studieren – und zwar aus sicherer Entfernung. Doch nachdem ihn eine Gleitung erst weitab von seinem Wunschziel Dover getragen hat, findet er sich plötzlich viel unmittelbarer im Geschehen als erhofft wieder. Von da an wird ihn die Angst verfolgen, dass er am Brennpunkt Dünkirchen etwas getan haben könnte, das den Verlauf der Geschichte ändern wird. Als er nicht wie geplant ins Jahr 2060 zurückkehren kann, wachsen seine Ängste weiter. Und da auch Polly und Eileen durch diverse Umstände immer wieder an der Rückkehr gehindert werden, drängt sich langsam aber sicher die bange Frage auf, ob das alles nur Zufall ist. Vielleicht hatten die Zeitreise-Warner ja doch recht.
Großes Lesevergnügen
Obwohl sich Connie Willis hier einem dunklen Kapitel der Geschichte widmet, setzt sie gezielt auf Unterhaltungswert und Humor (mehr noch als im früheren "Die Jahre des Schwarzen Todes"). Mit den Streichen der Kinder oder einem Stier, der eine aufblasbare Panzerattrappe auf die Hörner nimmt, setzt es sogar veritable Slapstick-Einlagen. Der Witz ist zur Auflockerung aber auch notwendig, denn menschliche Härtefälle wird uns Willis hier keineswegs ersparen.
Connie Willis ist eine große Autorin – dazu gehört auch, dass sie ihr Handwerk meisterlich beherrscht. Gleich die ersten Kapitel, in denen es um die Missionsvorbereitungen im 2060er Oxford geht, führen dies glänzend vor Augen. Die eigentliche Handlung hat hier ja noch gar nicht begonnen, und doch geht es schon schwindelerregend turbulent zu: Zwischen Terminchaos, Kostümproben, Requisitenbeschaffung im Fundus und Herumärgern mit bürokratischen Regeln kommt hier laufend jemand durch die Tür gestürmt, schrillt das Telefon ("Hallo? Ja, ich weiß, dass Sie für die Erstürmung der Bastille vorgesehen waren ...") und zankt das Zeitreisepersonal. Es ist ein vergnügliches Chaos, ganz ähnlich dem von James Tiptrees "Geburt eines Handlungsreisenden".
Ein anderes Werkzeug aus der Handwerkskiste setzt die Autorin vielleicht etwas zu oft ein: Cliffhanger am Kapitelende. Und sie schreckt dabei auch nicht vor arglistiger Täuschung zurück. Da kommt es jetzt vermutlich nicht völlig überraschend, dass auch das ganze Buch mittendrin aufhören wird. Wer wissen will, wie es mit Polly, Eileen und Mike ausgegangen ist, hat also noch einmal einen 700-Seiter vor sich. Aber ich kann nur sagen: Es lohnt sich! "Licht" ("All Clear") ist vor kurzem ebenfalls auf Deutsch erschienen und wird Teil der nächsten Rundschau sein. Ich freu mich jetzt schon aufs Lesen.

Carlton Mellick III: "Ugly Heaven"
E-Book (Paperbackausgabe bereits angekündigt), 127 Seiten, € 2,99, Voodoo Press 2017 (Original: "Ugly Heaven", 2007)
"In heaven everything is fine ...", sang die Frau im Heizkörper in David Lynchs surrealem Frühwerk "Eraserhead": einem Film, den die literarische Bewegung der Bizarro Fiction immer wieder explizit als eine ihrer Einflussquellen angeführt hat. Mit Eraserhead Press hat sich der wichtigste Verlag der Szene sogar danach benannt.
Von himmlischem Friede, Freude, Eierkuchen war in dem Film natürlich nichts zu spüren – ebenso wenig wie in "Ugly Heaven" von Bizarro-Gründervater Carlton Mellick III, der über Voodoo Press erfreulicherweise mal wieder den Weg ins Deutsche gefunden hat. Der Himmel, in dem die beiden Protagonisten hier nach ihrem Tod erwachen, ist – man kann es sich denken – vor allem eines: bizarr. "Es war ein Glaube auf Erden, dass all eure Fragen beantwortet werden, sobald ihr gestorben seid. Aber in Wirklichkeit gibt es nach dem Tod nur wenige Antworten und eine ganze Menge mehr Fragen", wird eine, die sich im Himmel schon länger eingerichtet hat, einem Neuankömmling reinwürgen.
Willkommen in deinem letzten Leben
Es lohnt sich, Mellicks Vorwort diesmal besonders genau zu lesen. Darin erklärt er nicht nur seine zentrale Motivation für diese Erzählung – nämlich den Kampf gegen die absurde Vorstellung, Menschen nach dem Schema der Himmel-und-Hölle-Religionen in "Gute" und "Böse" zu teilen, obwohl doch moralische Kategorien mit der Zeit beträchtlich schwanken. Er deutet auch bereits einige der Motive an, die im späteren Verlauf eine Rolle spielen werden. Auch wenn sie nur ein Teil des Tsunamis an surrealen Bildern sind, der hier über einen hereinbricht: "Ugly Heaven" ist die wildwuchernde Weiterführung des Gedankengangs im Prolog.
Giftig grün, voller Schlamm, Spinnen, Stachelwürmer ("Sehen wie dämonisches Sperma aus") und schwarzer, tröpfelnder Bäume: Das ist der erste Eindruck, mit dem sich der Himmel zwei Frischverstorbenen präsentiert. An ihr Leben vor dem Tod können sie sich – vorerst – nicht erinnern, nicht einmal an ihre Namen. Also benennen sie sich nach den neuen Körpern, in denen sie aufgewacht sind: Einer, gelblich geschuppt, heißt nun Baum. Und der mit der rosa Reptilienhaut nennt sich halt Lachs. Später wird man ihnen erklären, dass diese neuen Körper die fleischlichen Manifestationen ihrer Seelen seien – und zugleich ihre letzten. Denn auch im Himmel kann man sterben, aber hier folgt nicht wie in Astrid Lindgrens "Die Brüder Löwenherz" auf Nangijala ein Nangilima. Nein, hier stirbt man nach Atheistenart: Nach dem Tod wird einfach nur mehr nichts sein.
Extreme Körperlichkeit
Spätestens wenn Baum und Lachs auf eine junge Frau mit bezaubernder Seepferdchenhaut namens Schwan treffen, entwickelt sich die Geschichte in eine "Und wo ist eigentlich Gott? Tot oder nur verreist?"-Richtung, die als Motiv in der Phantastik ja auf eine lange Tradition zurückschauen kann. Verbunden hier mit moderneren Elementen wie "Matrix"- oder "Truman Show"-artigen Blicken hinter die Himmelskulissen und vor allem einer großen Ladung Body Horror.
Zwischen Seen aus Schweiß, einem Riesenmagen und angriffslustigen Körperteilen bewegen sich die Hauptfiguren durch eine Landschaft, die ein wenig an Mellicks frühere Erzählung "Teeth and Tongue Landscape" erinnert. Und wenn schon Geografie und Requisiten eine so extreme Körperlichkeit vermitteln, kann man sich vorstellen, wie sich hier wohl erst eine Sexszene oder eine Darmentleerung lesen werden. Oder besser gesagt: nein, kann man nicht. Bis es dann kommt.
Es gibt noch mehr!
Wenn "Ugly Heaven" am Ende nicht den runden Eindruck von Erzählungen wie "Cuddly Holocaust" oder "Ultra Fuckers" erreicht, dann liegt es daran, dass Mellick die Geschichte eigentlich in weiteren Bänden fortführen wollte. Zu den Fortsetzungen ist es allerdings nie gekommen. Was es hingegen gibt, ist das Gegenstück "Beautiful Hell" vom auch Horror- und SF-Fans bekannten Autor Jeffrey Thomas: Die beiden Novellen sind 2007 in einem Band erschienen. Voodoo Press hingegen wird "Ugly Heaven" für die kommende Print-Ausgabe mit einem weiteren Werk Mellicks kombinieren, das nicht zuletzt aufgrund seines Titels zu seinen Klassikern gerechnet wird: "The Haunted Vagina".
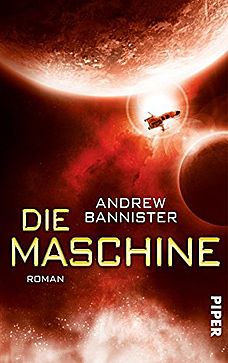
Andrew Bannister: "Die Maschine"
Broschiert, 416 Seiten, € 17,50, Piper 2016 (Original: "Creation Machine", 2016)
Es ist eine unmenschliche Zukunft, in die uns der britische Autor Andrew Bannister in seinem Romanerstling entführt: Da ist ein Planet zum Preis von einer Milliarde Toter erobert worden. Da werden Raumstationen einer Widerstandsbewegung reihenweise mit Atombomben gesprengt. Und da spielen Sträflinge zur Erbauung der Gäste eines Themenrestaurants Krieg im Schützengraben ... mit echten MGs. All das vor dem Hintergrund einer Space Opera, die sich als durchwegs positive Überraschung entpuppt hat – ein gelungenes Debüt.
Das Szenario
Schauplatz des Romans ist eine Spin genannte, vor langer Zeit künstlich erschaffene Region der Milchstraße, in der 21 Sterne und 89 Planeten auf engem Raum und ziemlich abenteuerlichen Bahnen umeinander schwirren. Niemand wusste, wer oder was den Spin erschaffen hatte, und über die Ursache zu spekulieren, war schlicht absurd. Doch wer sein Schöpfer auch gewesen sein mochte, er verfügte offenbar über große Ambitionen, beinahe grenzenlose Energie und Sinn für Humor. Zwar gab es archäologische Spuren, die jedoch in derart viele absichtlich entgegengesetzte Richtungen wiesen, dass sie wahrscheinlich ein Teil des Witzes waren.
Der Spin ist dicht besiedelt – hauptsächlich von Menschen – und war bislang recht heterogen. Seit einiger Zeit wuchert jedoch die Hegemonie wie ein Krebsgeschwür über ihn hinweg: Den Beschreibungen nach dürfen wir sie uns als Zukunftsanalogon des neoliberalen Wirtschaftssystems vorstellen, das sämtliche angeschlossenen Welten gleichschaltet und auf optimale Ressourcenausbeutung trimmt. Widerstand wird gnadenlos ausgemerzt – das hat die schlicht und treffend Andere Gesellschaft genannte Gegenbewegung in Form besagter Atombomben zu spüren bekommen.
Die Maid im Turm
Romanheldin Fleare Haas gehörte einst zu dieser Anderen Gesellschaft – durchaus pikant, denn ihr Vater ist ein hochrangiger Vertreter der Hegemonie. Der schickte die unbotmäßige Tochter kurzerhand ins Exil. Und da finden wir sie zu Beginn des Romans auch vor: Gefangen in einem Turm, der zu einer uralten Monumentalstadt gehört, die auf einem abgelegenen Mond liegt. Es ist einer dieser Orte, an denen die Technologie der Magie nahekommt; Menschen haben sich hier erst später wie Parasiten eingenistet. Generell verdient Bannister Extrapunkte für sein World(s)building: Hier wimmelt es nur so vor kreativ gestalteten Habitaten und Planeten inklusive ungewöhnlicher Flora und Fauna.
Die Befreiung naht in Form von Fleares ehemaligem Lover Muz. Wobei das mit der Form ein bisschen speziell ist ... Fleare mag ja ein paar kleinere – und mittlerweile illegale – körperliche Modifikationen an sich vorgenommen haben. Doch Muz, der ist inzwischen eine gestaltwandelnde Wolke aus Nanomaschinen: praktisch in vielen Lebenslagen, nicht jedoch in der Zweisamkeit. Nach gelungenem Ausbruch machen sich die beiden in die Weiten des Spin auf, um Kontakt zu ihren ehemaligen Kampfgefährten zu knüpfen. Dabei hören sie dann auch zum ersten Mal von jenem Artefakt, das dem Buch seinen Titel beschert hat.
Das Monster
Antagonist des Romans ist nicht etwa Fleares Vater, wie es der Klappentext suggeriert, sondern der darin gar nicht erwähnte Adelige Alameche Ur-Hive. Er ist der zweithöchste Mann im Glücklichen Protektorat, einem skrupellos auf Eroberung ausgerichteten Hinterwäldlerreich im tiefsten Inneren des Spin. Alameche wird schon vor Fleare und Muz mit dem geheimnisvollen Artefakt konfrontiert: Ob Superwaffe oder Datenträger, auf jeden Fall ist es vor langer Zeit auf einer der Protektoratswelten abgestürzt. Und ein nur per Maschinen-Avatar auftretender Botschafter aus dem äußeren Spin ist sehr begierig darauf, dieses Objekt in die Finger zu bekommen. Alameche soll es für ihn bergen lassen.
Unter all den Abscheulichkeiten des Protektorats ist Alameche die abscheulichste: Machtgierig und zynisch, ist er der Urbösewicht schlechthin; immerhin hat er einen Völkermord auf dem nicht vorhandenen Gewissen und lässt auch weiterhin bei jeder Gelegenheit Menschen aus reinem Sadismus töten. Kurz: Er müsste die eindeutigste und damit auch eindimensionalste Schurkenfigur sein, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Erstaunlicherweise kriegt Bannister es aber irgendwie hin, dass man sich für das Monster und seine Selbstbehauptung in den inneren Machtkämpfen des Protektorats tatsächlich interessiert.
Ist außen innen?
Bevor Andrew Bannister seinen ersten Roman geschrieben hat, hatte er offenbar viele gelesen. Mögliche Inspirationsquellen reichen von Alastair Reynolds über Neal Asher bis zu Iain Banks. Mehrfach musste ich auch an die "John Difool"-Comics denken: Vermutlich deshalb, weil sich zu den Reisen durch den äußeren Kosmos in der zweiten Romanhälfte auch solche in den inneren gesellen. Dann geht es nämlich hinein in virtuelle Welten. Formal unterstreicht Bannister dies, indem er in den betreffenden Kapiteln auf Präsens und Erzählen in der ersten Person wechselt: ein überraschender Zug.
An einer Stelle heißt es, dass eine virtuelle Welt ab einem gewissen Komplexitätsgrad zumindest ethisch betrachtet nicht mehr von der realen unterschieden werden darf. Da stellt man sich natürlich unwillkürlich die Frage, wie real die – immerhin künstlich erschaffene – Welt des Spin eigentlich ist. Kein Spoiler, nur eine Spekulation.
Einziger Minuspunkt an diesem ambitionierten Abenteuer: Im Epilog werden einige Dinge Marke "Ach übrigens, das wurde aus ..." kurz erwähnt, obwohl sie sich eine etwas ausführlichere Schilderung noch innerhalb der Haupthandlung verdient hätten. Kommt nicht gerade oft vor, dass ich finde, ein Roman hätte ruhig ein Stück länger sein dürfen! Dass der Folgeroman dies nachholen wird, sollte man nämlich auch nicht erwarten. "Die Maschine" ist zwar Auftakt einer Trilogie, aber offenbar einer nur lose verbundenen. Teil 2, "Iron Gods", wird im Original im Mai erscheinen und anscheinend in einer noch ferneren Zukunft angesiedelt sein. Mit neuen Schauplätzen und neuen Akteuren – nur der Spin selbst, der bleibt uns erhalten.

Uwe Post, Frank Lauenroth, Niklas Peinecke, Frederic Brake, Merlin Thomas, Uwe Hermann & Christian Weis: "Biom Alpha: Der Aufbruch"
Broschiert, 350 Seiten, € 10,30, Books on Demand 2017
Stell dir vor, du bist US-Präsident und die Aliens landen nicht in deinem Vorgarten, wie sie's im Kino immer tun, sondern überall sonst auf der Welt (sogar in A-f-r-i-k-a!). Kein Wunder, dass der christlich-fundamentalistische President Cunningham schäumt: "Ich bin das Zentrum der Welt! Ich will wissen, warum die Außerirdischen nicht bei uns landen. Wir sind von Gott auserwählt!"
Dass die Besucher ihre eigenen Prioritäten in Sachen Landeplätze haben, ist Teil der Strategie des sechsköpfigen Autorenteams von "Biom Alpha", mit gängigen Klischees von First-Contact-Geschichten aufzuräumen. Das kann Cunningham natürlich nicht wissen, darum schickt er eine kleine Militäreinheit los, eines der UFOs in die USA zu entführen. Die Abenteuer der Hijacker-Truppe um Major Walters, die sich bald selbst in der Rolle der Gekidnappten wiederfinden wird, sind allerdings nur ein Handlungsstrang unter vielen. Mit dabei übrigens auch die Diner-Kellnerin Jenny, die auf etwas haarsträubend konstruierte Weise zu den Soldaten stößt. Aber bist du erst mal drin, fragt dich keiner mehr, wie du reingekommen bist.
Dein Körper ist mein Körper
Zur Erinnerung an die Ereignisse aus Band 1, "Die Ankunft": Wir schreiben die 2020er Jahre und im Sonnensystem ist ein Schwarm von Raumschiff-Habitaten mit einem ganzen Vielvölkergemisch an Bord aufgetaucht. Einige kleinere Einheiten sind auf der Erde gelandet und haben je nach Besatzung ganz unterschiedliche Absichten umgesetzt: vom regionalen Eroberungskrieg bis zum Asylantrag. Umgekehrt haben auch zwei Gruppen von Menschen unabhängig voneinander die Flotte erreicht und lernen das Leben im Biom Alpha kennen.
... und zwar hautnah. Sowohl die Astronomin April Reignar als auch der Journalist Marten Karnau fühlen eine gewisse Anziehung zu den pelzigen Angehörigen eines ihrer Gastgebervölker. Noch ein First-Contact-Szenario auf der Liste abgehakt! April wird sich also ein bisschen Furry-Sex gönnen. In klassischer TV-Keuschheit lassen uns die Autoren zwar nur in den Szenen davor und danach mit dabei sein, aber das ist passend, weil irgendwie meta – bekennen die Aliens doch mehrfach, dass sie das Leben auf der Erde über Fernsehserien studiert haben. Marten indes bleibt der Vollzug versagt, weil er vorher eine invasive Begegnung der anderen Art erlebt: Eines der intelligenten Pflanzenwesen, die wir schon in Band 1 kennengelernt haben, fällt ihm buchstäblich auf den Kopf und schnappt ihn sich als Symbiosepartner.
Das Sonnensystem als Raststätte
Im bordeigenen Dschungel der Weltraumhabitate verstricken sich April und Marten in sowohl pflanzliche als auch politische Ränke. An Spannungselementen werden unter anderem aufgefahren: eine Reihe von Terroranschlägen, Sabotageakte außerirdischer Separatisten, der Einsatz einer mikrobiellen Waffe und – ziemlich beklemmend – panisches Gekrieche durch ein Raumschiff, das Sektion für Sektion mit einer desinfizierenden Säure geflutet wird (hier setzt das große Redshirt-Sterben ein). Plus diverse biologische Überraschungen, je nachdem, was im Biom grade so aus dem Gebüsch gesprungen kommt. All das wird schnell und schnörkellos erzählt und ist entsprechend unterhaltsam.
"Menschen glauben, das Universum dreht sich nur um sie", heißt es an einer Stelle. Tja, das können sie sich hier abschminken. Zum Bruch mit Genrekonventionen gehört auch, dass die bunt gemischten Aliens von "Biom Alpha" kein einheitliches Ziel zu verfolgen scheinen. Und – das ist für eine First-Contact-Erzählung geradezu unerhört – dass sie in ihrer Gesamtheit gar kein nachhaltiges Interesse an Erde oder Menschheit haben. Sie planen sogar schon wieder ihre Weiterreise und stopfen sich höchstens noch schnell ein paar Souvenirs ins Gepäck. Dass die Menschheit von technologisch überlegenen Aliens mehr oder weniger ignoriert wird, haben andere Autoren schon als zutiefst demütigende Erfahrung beschrieben (etwa Stephen Baxter in "The Invasion of Venus"). Hier haben die ProtagonistInnen vorerst noch viel zu viel zu tun, um sich darüber groß Gedanken zu machen.
Im Dschungel der Handlungsstränge
Dieser zweite Band der Reihe enthält die ursprünglichen Episoden 4 bis 6 von "Biom Alpha". Ab Band 3, so heißt es im Nachwort, wird die Untergliederung in novellenlange Teile entfallen. Nicht dass die jetzt schon so klar durchgezogen wäre: Die meisten Geschehnisse laufen über die Episoden"grenzen" hinweg weiter. Mehrfach tauchen zudem mittendrin oder gegen Ende einer Episode neue wichtige Handlungsfiguren auf: etwa eine Flüchtlingsgruppe um einen Biomgärtner, dessen Habitat stirbt. Oder ganz zum Schluss eine Gruppe koreanischer MarsforscherInnen, die vom Rest des Geschehens losgelöst ihr ganz eigenes Erstkontakt-Szenario in Form einer tragischen SF/Horror-Kurzgeschichte durchleben – eines der Highlights, nebenbei bemerkt.
"Biom Alpha" hat also eine Handlungsstruktur wie eine Serie. Und zwar eine von der wildwuchernden Sorte, die ein riesiges Ensemble über eine große Zahl von Handlungssträngen verteilt, zwischen denen im Schnelltakt herumgesprungen wird. Typ "Game of Thrones" also oder auch "Downton Abbey" (das sogar noch schneller geschnitten ist, es fällt wegen des Edel-Ambientes bloß weniger auf).
Das schwebt natürlich stets am Rande des Chaos und wird auch nicht jeder Figur gerecht. Wenn beispielsweise Major Walters so lange ein kapiteltragender Akteur war, dann darf man ihn nachher nicht zur Nebenfigur im Handlungsstrang eines anderen Protagonisten degradieren. Und der samt Vorgeschichte sorgsam aufgebaute Buchhändler Eliot, der die Aliens mit dem Voynich-Manuskript in Verbindung bringt, verschwindet auch recht sang- und klanglos wieder. Fürs Erste zumindest. Die Reihe in größeren Einheiten fortzuführen, wie es für Band 3 angekündigt ist, könnte als Chance genutzt werden, die eigentlichen Hauptfiguren zu definieren und diesen dann jeweils einen abgerundeten Handlungsbogen auf den Leib zu schreiben. Man muss ja nicht gleich mit allen Konventionen brechen.
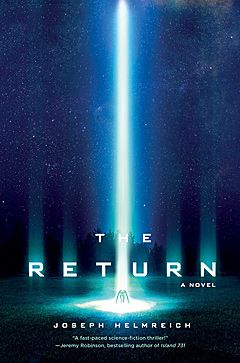
Joseph Helmreich: "The Return"
Gebundene Ausgabe, 248 Seiten, Thomas Dunne Books 2017
Auf ein ebenso simples wie immer wieder effektives Mittel zum Erzeugen eines Verblüffungseffekts setzt US-Autor Joseph Helmreich in seinem Debütroman: die Umkehrung. "Normalerweise" werden Menschen auf einsamen Landstraßen von UFOs entführt und gehen nach ihrer Rückkehr vergeblich mit ihrer Geschichte hausieren. Der Protagonist von "The Return" hingegen ist vor den Augen der ganzen Welt in den Himmel gezogen worden. Und als er eines Tages wieder auftaucht, streitet er alles ab.
Genauer gesagt sollte gerade eine Mondfinsternis im Fernsehen übertragen werden und Astrophysiker Andrew Garland seinen Senf dazu abgeben. Er war mal ein echter Pionier der Wissenschaft, mittlerweile hat er allerdings Karriere als einer dieser dauereingeladenen TV-Experten gemacht – eine Art Peter Filzmaier der Sterne. Gerade fragt ihn der Reporter noch, was das für ein seltsames Licht beim Mond sei, da huscht es auch schon rasant näher und entpuppt sich als Flugobjekt. Und während der Rest der Crew in Deckung hastet, wird der erstarrte Andrew vor laufender Kamera inmitten grünen Lichts an Bord gezogen. Also da liest man doch gerne weiter!
Auftritt für Akteur 2
Ein paar Jahre später ist die Welt nicht mehr dieselbe. Nach diesem unwiderlegbaren Beweis für die Existenz außerirdischer Intelligenz herrscht in der Pop-Kultur wieder ein Weltraumfieber wie in den 60ern. Die Unis werden von Physik- und Astronomiestudienwilligen überschwemmt und Forschungsinstitute wissen gar nicht mehr, was sie mit all den neuen Fördergeldern anfangen sollen. Das liest sich wie ein wahrgewordener Geek-Traum! Erstaunlich eigentlich, denn in der bisherigen Vita von Joseph Helmreich, die zwischen Film, TV, Musik und Sachbüchern angesiedelt war, deutete nicht allzuviel auf eine Vorliebe für Science Fiction hin.
Physikstudent Shawn Ferris jedenfalls ist bereits unter diesen Bedingungen erwachsen geworden. Oder fast erwachsen: Wegen eines Streichs fliegt er nämlich von der Uni – da hilft es auch nicht, dass er ein ähnlich verkanntes Genie ist wie Andrew Garland, sein großes Idol. Umso mehr erschüttert es Shawn, als die Nachrichten die Sensation verkünden, dass ein verwahrloster Andrew in der Wüste von New Mexico aufgegriffen wurde ... und behauptet, dass er sich dort die ganze Zeit über aufgehalten habe.
Es wird verwirrend ...
Bei seinen Versuchen, Andrew zu kontaktieren, gerät Shawn an Rachel, die ihm eine unglaubliche Geschichte erzählt: Der erste Kontakt zu Aliens sei schon 1939 erfolgt, die erste Mondlandung 1951 – und zwar nicht durch die NASA. Stattdessen stecke eine multinationale Weltraumorganisation namens Ambius dahinter (für die Rachel angeblich arbeitet). Und haarsträubender noch: Eines der vielen Alien-Völker, die man bereits kenne, plane einen Angriff auf die Erde. Andrew sollte angeblich ein Instrument zu deren Abwehr entwickeln – jetzt hofft Ambius auf Shawns Hilfe. Aber sind sie wirklich die Wächter der Menschheit – oder einfach nur komplette Spinner?
Derweil flicht sich noch ein dritter Handlungsstrang durch den Roman, der in keinem erkennbaren Zusammenhang mit dem Rest zu stehen scheint. Fernab des Geschehens, in Spanien nämlich, wird der Priester Father Arroyo in Geheimdienstaktivitäten hineingezogen. Dieser Handlungsstrang wird eine reichlich unerwartete Wendung nehmen – und es wird nicht das letzte Mal sein, dass der twistverliebte Autor auf den Spuren Alfred Hitchcocks wandelt.
... und bleibt spannend
Mehr sollte man zur Handlung nicht verraten, denn Helmreich liefert hier einen Mystery-Thriller ab, der vor allem von Überraschungen lebt. Zur Form gibt es auch nicht viel zu sagen – außer, dass "The Return" sehr easy zu lesen ist (was nicht das Gleiche bedeutet wie simpel geschrieben). Englisch-Zögerer brauchen hier wirklich keine Angst zu haben!
Und es ist ein Thriller der ungewöhnlichen Entscheidungen, soviel sei auch noch angemerkt. Das gilt insbesondere für einige auffällige Auslassungen. Manche davon sind eindeutig gewollt und auch absolut gerechtfertigt (Stichwort: Leben und Sinneswahrnehmungen auf anderen Welten), andere hingegen hätten durchaus eine nähere Erklärung verdient (Stichwort: interstellares Reisen). Gut möglich, dass Helmreichs schriftstellerische Entscheidungen am Ende den einen oder die andere nicht zufriedenstellen werden. Aber zumindest bis dahin ist das Ganze ein origineller Trip.
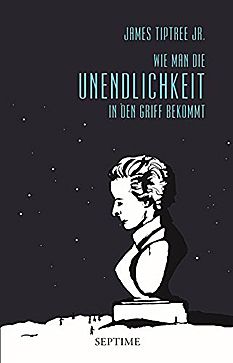
James Tiptree Jr: "Wie man die Unendlichkeit in den Griff bekommt"
Gebundene Ausgabe, 456 Seiten, € 20,60, Septime 2016 (Zusammenstellung aus "Letters from Yucatan and Other Points of the Soul", "Neat Sheets" und "Dear Starbear", 1996-2006)
Es gab eine Zeit, da wollte ich einfach nicht verstehen, warum routinemäßig Tagebücher oder Briefsammlungen von AutorInnen besprochen werden, als wäre das richtige Literatur. "Zählt doch nicht", dachte ich mir. Bis sich irgendwann dann doch noch die höchst banale Erleuchtung einstellte: Wenn jemand ein herausragender Autor ist, hat man eine ziemlich gute Chance, dass sich auch dessen Alltagsprosa großartig liest.
Im Mahlstrom der Worte
Exhibit A: Alice B. Sheldon alias James Tiptree Jr. Man lese nur ihren – wenn man so will – Reisebericht aus Mexiko mit dem Titel "Wie man einen urkomischen Herzinfarkt hat, oder: Du willst also in der Dritten Welt krank werden". Trotz des eigentlich ja todernsten Anlasses ist dieser autobiografische Text derart zum Brüllen komisch wie ... wie ... ja wie die bitterböse Krankenhaus-Satire "The Hospital" (mit George C. Scotts legendärem Satz: "Where do you train your nurses, Mrs. Christie? DACHAU?!"). Ich würde den Text unter Tiptrees besten Kurzgeschichten einreihen.
Oder lesen wir, wie Sheldon zwischen Neid und Bewunderung hin- und hergerissen auf Philip K. Dick reagiert: Und wenn mir seine Sachen in die Hände fallen, laufe ich wieder und wieder darum herum und rede mit mir selbst und schlage mir vor den Kopf und spucke auf meine Schreibmaschine, während sich diese unglaubliche Lawine von Erfindungen und alternativen Realitäten glitzernd und triefend über den ganzen Boden verteilt wie radioaktive Ajax-Lava, die nach Haschisch und Getriebeöl riecht und dabei Bach spielt. Und irgendwann kauere ich mich dann zu einem Häufchen zusammen und schreibe ihm einen weiteren Fanbrief ...
Das große Geschlechter-Kuddelmuddel
"Wie man die Unendlichkeit in den Griff bekommt" ist eine Sammlung von Kolumnen, Reiseberichten, Vor- und Nachwörtern zu Büchern (wozu sich Sheldon/Tiptree nur selten überwinden konnte) und anderen Formaten. Dazu gehören auch Briefe – aber fast nur solche, die in der einen oder anderen Form zur Veröffentlichung bestimmt waren. Eine solche Korrespondenz beispielsweise – mit Genregrößen wie Samuel R. Delany, Joanna Russ oder Kate Wilhelm – erstreckte sich über mehrere Monate und wurde 1975 zu einem "Symposium" zusammengestellt (einige von Sheldons Beiträgen sind hier unter "Mit Tiptree durch das große Geschlechter-Kuddelmuddel" enthalten).
Die Reiseberichte sind teils schwärmerisch (bezogen auf die Wunder der Natur), teils treffsicher böse (wenn es um die Menschen geht) und stets hoch unterhaltsam. Dazwischen wird es ernster, wenn sich Sheldon an Episoden aus ihrem gelinde gesagt bewegten Leben erinnert, beispielsweise an das Elend im besetzten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder wenn sie – wie im "Symposium" – mit KollegInnen über die Rolle der Frau in der SF und der Gesellschaft an sich debattiert. Was sie wohlgemerkt aus der einzigartigen Warte ihres selbstgewählten Verstecks heraus tun musste: als lesbische Frau, die sich mittels Pseudonym als Mann ausgab, der mit dem Feminismus sympathisierte und von vielen für schwul gehalten wurde.
Große Geister im Dialog
Der erste und längste Teil dieser deutschsprachigen Ausgabe ("Briefe aus Yucatan") ist im Original 2000 von Jeffrey D. Smith veröffentlicht worden: einem Herausgeber von Fanzines, dem es in den frühen 70ern gelang, einen festen brieflichen Kontakt zu Sheldon aufzubauen, als Tiptree gerade seinen literarischen Höhenflug antrat. Das aus einem Briefwechsel entstandene Interview zu Beginn zeigt nebenbei bemerkt sehr schön den Unterschied zwischen einem intelligenten (Smith) und einem genialen, hochoriginellen und sprachgewaltigen Menschen (Sheldon).
Den Dialog mit einem gleichermaßen großen Geist dürfen wir im dritten Teil mitverfolgen, einem sich über weite Teile der 70er Jahre erstreckenden Briefwechsel Tiptrees mit der Autorin Ursula K. Le Guin. Julie Phillips, der wir die fantastische Tiptree-Biografie zu verdanken haben, hatte diese Korrespondenz unter dem Titel "Dear Starbear" 2006 veröffentlicht. Dieser Briefwechsel erstreckt sich auch über jene entscheidende Wegmarke in Sheldons Leben hinweg, als 1976 ihr Tiptree-Pseudonym aufflog und sie voller Panik darauf wartete, wie die SF-Gemeinde auf ihre wahre Person reagieren würde. Wenigstens Le Guin hat sie nicht enttäuscht. Zwischen Teil 1 und 3 liegt übrigens noch eine kleine Sammlung von Gedichten Sheldons aus den 1940er und 50er Jahren. Dazu kann ich allerdings nichts sagen, da mir Poesie nicht liegt.
Zwischendurch Luft holen!
Dieser Band ist sicher in erster Linie für Tiptree-Fans interessant – nicht zuletzt, weil oft auf Stories verwiesen wird, die man gelesen haben sollte, um die Anspielungen zu verstehen. Er gibt aber auch Einblicke in eine Ära, als sich sowohl die Science Fiction als auch die Gesellschaft als Ganzes in einer Umbruchsphase befanden: Sehr schön dokumentiert im Briefwechsel Tiptrees mit Le Guin, in dem sie über SF-Kolleginnen ebenso wie über die Rolle der Frau parlieren – mal spielerisch und vor Witz übersprudelnd, mal ernster, stets voller Bewunderung füreinander und ein bisschen auch miteinander flirtend.
Und ich würde auch empfehlen, sich die Lektüre zu portionieren, um nicht überfordert zu werden. Man hat es hier ja mit einer ungeheuer raumgreifenden Persönlichkeit zu tun, da muss man sich zwischendurch wieder ein bisschen sortieren. Wie es an einer Stelle mit augenzwinkernder Angeberei – aber durchaus zutreffend – heißt: "Genies sind leicht überwältigend, schätze ich?"

David Brin: "Der Übungseffekt"
Broschiert, 430 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "The Practice Effect", 1984)
David Brin kennen die meisten entweder über seine höchst erfolgreiche "Uplift"-Reihe oder umfassende Zukunftspanoramen aus späteren Jahren à la "Erde" und "Existenz". And now for something completely different. Der Einzelroman "The Practice Effect" von 1984 schlug eine ganz andere Richtung ein, wie einem spätestens ein Blick auf die Kapitelüberschriften im Inhaltsverzeichnis klar macht ("Et tu, Putzi" werde ich in meinen Wortschatz aufnehmen).
Hier stellte sich Brin ganz in die Tradition humorvoller Begegnungen zwischen Menschen und ... Anderen – allen voran der Klassiker "Die fliegenden Zauberer" von Larry Niven & David Gerrold, auf den der Protagonist dieses Romans auch anspielt (freilich ohne den Titel zu nennen). Andere Beispiele für den Ton dieser Art Erzählungen wären Nivens "Der Flug des Pferdes", "Des Erdenmannes schwere Bürde" von Poul Anderson & Gordon R. Dickson oder "Ich warte auf euch, wenn der Swimmingpool leer ist" von James Tiptree Jr.
"Hä?"
Zur Handlung: In nicht allzu ferner Zukunft hat die Entdeckung des Ziev-Effekts ein Tor zu anderen Welten geöffnet – man muss sie nur mit allerlei Wahrscheinlichkeitsrechnungen im Gewaber des Quantenraums erst mal aufspüren. Eine solche Welt hat sich als recht erdähnlich erwiesen; dummerweise ist seit einiger Zeit kein Forschungsroboter von dort mehr zurückgekommen. Also verpflichtet sich Physik-Postdoc Dennis Nuel, durchs Tor zu gehen und drüben mal nach dem Rechten zu sehen. Auf der anderen Seite erwartet ihn eine tatsächlich erstaunlich irdisch wirkende Welt – inklusive Englisch sprechenden Menschen, die in einer Gesellschaft auf bronzezeitlichem Niveau leben. Damit beginnt für den Wissenschafter, der im Inneren ein großer Junge geblieben ist, ein fantasyeskes Abenteuer.
Es gab, so hatte er damals gelernt, ein paar Laute, die bei den Menschen universale Bedeutung besaßen. Anthropologen verwendeten diese Laute bei ihren ersten Kontakten mit neuentdeckten Stämmen. Dennis schluckte und versuchte es mit einem dieser Laute. "Hä?", sagte er. Anfängliche Missverständnisse sind rasch überwunden – bis auf eine merkwürdige kulturelle Diskrepanz, was die Verwendung von Werkzeugen betrifft. Auf der Welt Tarir scheint man zu den Eigenschaften "alt" und "neu" etwas andere Assoziationen zu haben als auf der Erde. Es dauert einige Zeit, bis es Dennis dämmert, was das zu bedeuten hat.
Übung macht das Meisterstück
Dann allerdings ist er von den Socken: Auf Tarir gelten andere Naturgesetze als auf der Erde! Anstelle des lästigen Abnutzungseffekts gibt es hier einen "Übungseffekt": Je länger man etwas benutzt, desto höher steigt seine Qualität: Messer werden mit dem Schneiden immer schärfer, Häuser durch Bewohnen stabiler, Schmuckstücke durch Beglotztwerden prunkvoller. Die Gesellschaft von Tarir hat sich voll und ganz auf den Effekt des Übens eingestellt, der immer wieder zu skurrilen Ausformungen führt: Da müssen zum Beispiel Sträflinge in edelsten Leih-Klamotten herumlaufen, damit sie für deren Besitzer schön knitterfrei bleiben, und zwischendurch auf die Gefängnismauern einschlagen, was diese fester macht.
Im Vergleich zu dieser hochoriginellen Idee ist die eigentliche Handlung recht konventionell. Dennis, der sich durch seine technischen Kenntnisse rasch den Ruf eines Zauberers erwirbt, gerät ins Visier eines machtgeilen Adeligen und mehrfach in Gefangenschaft. (Als Running Gag enden seine Fluchtversuche stets in Bewusstlosigkeit.) Und er verliebt sich in eine waschechte Prinzessin, als diese – man glaubt es kaum – anmutig auf einem Balkon die Laute spielt. Das ist so kitschig, dass man beim Lesen unwillkürlich an mindestens zwei Mel-Brooks-Filme denken muss ... und nicht überrascht ist, wenn auch die bezaubernde Linnora später ein paar wenig prinzessinnenhafte Verhaltensweisen an den Tag legen wird.
Kein Klassiker, aber unterhaltsam
Im letzten Drittel des Romans hält ein Krieg das Aktivitätslevel hoch. Das hätte Brin durchaus ein wenig kürzer halten können – nimmt man zum Vergleich, wie hastig er ganz am Ende die Erklärung für die seltsamen physikalischen Gesetze auf Tarir herunternudelt, die ja der eigentliche Knüller des Romans sind. Da fühlt sich die Gewichtung nicht richtig an. Was auch mit ein Grund dafür sein dürfte, dass "Der Übungseffekt" nicht der erste Titel ist, der einem zu David Brin einfällt.
Trotz abgeschlossener Handlung finden wir am Ende noch ein paar Anknüpfungspunkte für etwaige Fortsetzungen, zu denen es allerdings nie gekommen ist. Stattdessen schrieb Brin nach diesem Roman das vollkommen anders geartete "Postman" (preisgekrönte Vorlage für den Filmlangweiler mit Kevin Costner) und setzte dann seine "Uplift"-Reihe fort. "The Practice Effect" bleibt in Brins Bibliografie eine Randnotiz – aufgrund der originellen Prämisse, des Humors und Dennis' MacGyverismus-unter-besonderen-Umständen aber immer noch eindeutig lesenswert.
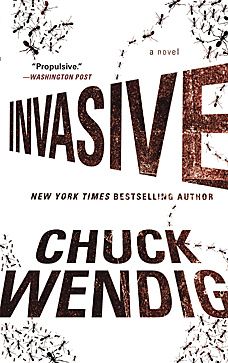
Chuck Wendig: "Invasive"
Broschiert, 384 Seiten, Harper Voyager 2017
Q.E.D.: Krisen holen das Beste aus manchen Menschen heraus. Und das ist hier wirklich ein Glück, denn mit Hannah Stander beschert uns US-Autor Chuck Wendig die wohl pessimistischste Hauptfigur des Jahres. Doch als Hannahs ständige Negativität langsam zu nerven droht, sieht sie sich gezwungen, in die Gänge zu kommen, und mausert sich damit doch noch zur waschechten Romanheldin. Wirkt eben nichts so belebend wie ein paar Millionen giftige Ameisen, die hinter einem her sind, um einen in den Arsch zu beißen!
Chuck Wendig ist ein nicht gerade unterbeschäftigter Autor von Romanen wie auch Comics und Computerspielen, von Science Fiction ebenso wie Fantasy (und was immer "Star Wars" ist). 2015 startete er mit dem Roman "Zer0es" eine gleichnamige Reihe, die sich um verschiedene Formen technologischer Bedrohungen dreht; Singularitäten wäre vielleicht ein zu großes Wort dafür. Das war im ersten Band, durchaus erwartbar, eine Künstliche Intelligenz. In "Invasive" hingegen, das mehrfach auf "Zer0es" verweist, aber gänzlich unabhängig davon gelesen werden kann, sind die Schrecken biologischer Natur.
Hauptfiguren als polare Gegensätze
Hannahs offizielle Bezeichnung ist FBI futurist; soll heißen, sie berät das FBI in Fällen mit brisanter technologischer Komponente. Da wundert sie sich natürlich, als sie zu einem Wochenendhaus gerufen wird, in dem man inmitten hunderter toter Ameisen die Leiche eines jungen Mannes gefunden hat, dem die Haut in kleinen Stückchen abgeschält wurde. Und im Nebenzimmer aufgehäuft. Die Rechtfertigung für Hannahs Mobilisierung wird aber rasch nachgereicht: Die Ameisen waren offenbar genetisch manipuliert. Und sie enthalten die gleichen Biomarker wie ein Stamm von Gentech-Moskitos, die ein Konzern zur Prävention von Infektionskrankheiten gezüchtet hat. Also begibt sich Hannah nach Hawaii, wo sich der Leiter des Konzerns, der isländische Milliardär Einar Geirsson, aufhält.
"Creation and destruction are our human instincts", wird eine der Nebenfiguren zu Hannah sagen und damit die zentrale Dichotomie des Romans auf den Punkt bringen. Die wiederum von Hannah und Einar aufs schönste verkörpert wird. Er, der "altruistic capitalist" mit salbungsvollem Auftreten, investiert in Zukunftstechnologien aller Art und ist dem technischen Fortschritt gegenüber höchst optimistisch eingestellt. Hannah hingegen sieht in allem die potenzielle Gefahr: Sie sitzt im Flugzeug und denkt daran, wie leicht sich der Bordcomputer hacken ließe (eine Anspielung auf den Vorgängerband). Sie blickt aufs Meer hinaus und sieht Überfischung. Sie lässt sich vom Wind umspielen und fühlt den Klimawandel. Kurz: Gegensätzlicher könnten die beiden Hauptfiguren gar nicht sein. Logischerweise landen sie beizeiten im Bett.
Als Tochter sogenannter Doomsday Preppers ist Hannah die Angst vor dem Weltuntergang quasi in die Wiege gelegt worden. Dazu kommen alle möglichen prägenden Erlebnisse: Sie ist als Kind beinahe ertrunken, von Wespen gestochen und von Ameisen gebissen worden, und ein Landstreicher hat sie auch noch attackiert. Für nahezu alles, was in "Invasive" passiert, hat sie bereits ein passendes Kindheitstrauma parat. Das ist ein wenig gar viel an psychologischem Unterfutter, aber Wendig wollte offenbar sichergehen. Laufend pendelt Hannah zwischen Panikattacken und jener "sachlichen Paranoia", die sie für ihr Jobprofil braucht. Das wirkt – zusammen mit der gewissen Entrücktheit, die Hannah ausstrahlt – zunächst etwas mühsam. Aber wie gesagt: Sie muss den Arsch ja noch hochkriegen, sonst beißt die Ameise zu.
The horror! The horror!
Es dauert etwas, bis der klassische Creepy-Crawly-Schrecken wirklich losgeht (41 Prozent des Romans sind da schon rum), aber dann legen die Ameisen wirklich los. In Schwärmen fallen sie über die InselbewohnerInnen her und ziehen ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Was freilich nur klappt, weil sie ihre Opfer erst durch ihr potentes Gift lähmen. Den gleichen Trick hatten einst die Meereswürmer in Philip Wylies düsterem "The End of the Dream" von 1972 drauf – ansonsten könnte man der Zerfleischung ja auch einfach durch ein paar zügige Schritte entgehen. Auch in "Invasive" wird die Glaubwürdigkeit also ein bisschen strapaziert; siehe auch die Megaschwärme, die Wendig hier toben lässt und die letztlich aus nur ein paar wenigen Zuchtbehältern stammen sollen. Oder das Faszinosum, dass Hannah immer wieder die Schritte der Ameisen hört (sooooo viele sind es!). Aber ein paar Ellen Seemannsgarn darf man einer Gruselgeschichte schon zugestehen.
Wie man "Invasive" abgesehen vom vorhandenen Unterhaltungswert einschätzt, hängt witzigerweise primär von der Genrezuordnung ab. Reiht man es dem "Zer0es"-Emblem entsprechend unter technologische Apokalypsen ein, ist es eine originelle Abwechslung zum ewigen Gwirks mit Künstlichen Intelligenzen & Co. Oder man betrachtet es als klassischen Tier-Horror – dann könnte der Roman auch den 70er Jahren entsprungen sein.
Klassisch ist übrigens auch die Whodunnit-Prämisse, gilt es für Hannah und Einar doch vor allem die Frage zu klären, wer die mörderischen Ameisen freigelassen hat. Und warum er die ganze Menschheit auslöschen möchte. Eine mögliche Antwort auf diese Frage wird dafür umso zeitgemäßer klingen: "You ever look at a YouTube comments section? You'd want everybody dead, too."

Patrick Schön (Hrsg.): "Schrecken der Vergangenheit"
Broschiert, 202 Seiten, € 9,90, p.machinery 2017
Die Anthologien des mit dem Science Fiction Club Deutschland verknüpften Verlags p.machinery kann man sich als eine Art Open Channel vorstellen: Hier kommen viele als AutorInnen zu Wort, die auf die eine oder andere Weise in der Phantastikszene aktiv sind. Nicht alle davon schreiben regelmäßig, immer wieder stößt man daher auf neue Namen. Das gilt jetzt insbesondere für mich und diesen Band, in dem ich fast keinen der Beitragenden kannte. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass ich selten Horror lese und der doch ein ziemlich eigenständiger Teil der Phantastik mit tendenziell klaren Grenzen ist.
Wissenschaftliches Weltbild in Gefahr
Wie alle Anthologien steht auch diese unter einem Motto. "Schrecken der Vergangenheit" bezieht sich darauf, dass sämtliche Geschichten im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert angesiedelt sind: Im Zeitalter der Aufklärung mithin, als die Ratio gerade besonders kompromisslos gegen Aberglauben und übernatürlichen Schmafu angaloppierte. Aufbauend auf diesem Grundkonzept werden die Hauptfiguren der 16 hier versammelten Erzählungen nun mit dem leider doch real existierenden Übernatürlichen konfrontiert. Interessantes Detail: Wenn es nach den Lebensläufen im Anhang geht, ist hier die Quote an AutorInnen mit wissenschaftlicher Ausbildung höher als in so mancher SF-Anthologie.
Prototypisch für den Konflikt zwischen Aufklärung und Irrationalität ist beispielsweise Sabine Frambachs "Geisterseher Kant", in dem der große Immanuel nach einer rationalen Erklärung für einen Geist sucht (trotz Pointe ist die anekdotische Geschichte eigentlich eher Anti-Horror). Oder Konstantin Flemigs "Der Tanz des Sufi", das Tagebuch eines Akademikergehilfen, der im Gefolge Napoleons nach Ägypten gereist ist, um das Wesen des Aberglaubens zu studieren. Das unvermeidliche blaue Wunder erleben überdies zwei spanische Kolonialbeamte, die in "Qati Qati" von Sabrina Zelezny die indigene Bevölkerung Perus mit europäischer Arroganz betrachten – bis sie von einem Zauber getroffen werden. Mit dem niedergeschlagenen Aufstand von Túpac Amaru II. hat diese Geschichte übrigens von allen den originellsten Hintergrund.
Längen ...
Länger im Gedächtnis als die drei genannten Erzählungen bleibt aber "Der Spiegelsaal" von Anke Höhl-Kayser. Als Ich-Erzähler fungiert hier ein dekadenter Adeliger, der nicht weiß, wie ihm geschieht, als er in einem Zustand der Lähmung einem ungewissen Ziel entgegentransportiert wird. Spannend! Ebenfalls zu den besseren Beiträgen gehört "Veronika" von Klaus Frank, in dem ein Wissenschafter eine sterbende Schwindsuchtpatientin "magnetisiert" (nichts für LeserInen mit Atemwegsproblemen ...). Zusammen mit Marlene Geselles Geistergeschichte aus der Französischen Revolution, "Eine Rose für den Henker", zeigt dieser Beitrag einmal mehr, dass auch eine Kurzgeschichte eine gewisse Mindestlänge braucht, um in die Gänge zu kommen.
Eine ganze Reihe Geschichten sind um das entscheidende bisschen zu kurz, um diese Schwelle zu überschreiten. Einen Sonderfall stellen dabei die beiden Beiträge von Tanja Hanika dar: "Der Zombiekeller", in dem Dandys zu ihrem Pläsier Cagefights gegen Untote bestreiten (und glaubt hier jemand wirklich, die Käfigtüren würden zubleiben?) und "Wolfsnacht in Grimsriver". Sehr geehrte Frau Hanika: Sowohl die Zombie-Apokalypse im 19. Jahrhundert als auch das aus Werwolf-Paranoia entspringende Bürgerkriegsszenario der zweiten Erzählung wären Stoff für ganze Romane – und potenziell recht interessante obendrein. Das Format Kurzgeschichte allerdings ist mit beiden Plots überfordert und muss am Ende zwangsläufig aus dem Ruder laufen.
... und Tiefen
Sprachliche Fehltritte gibt es, verteilt über den ganzen Band, diverse. Hier staunen wir über geifernde Zähne, da wird wie auf Stelzen gealtertümelt ("Denkst du, nur du wärst der Maskerade fähig?"), dort produziert eine Autorin eine wohl unbeabsichtigte Pointe: "Doch bei der Geburt dieses Jungen starb Clothilde im Kindbett (...) und dem Mann gelang es, Cothilde wieder ins Leben zurückzuholen. Der abergläubischen Landbevölkerung war das suspekt." Naja, das kann man auch als aufgeklärter Stadtmensch des 21. Jahrhunderts der abergläubischen Landbevölkerung nicht verdenken. Aber falls geplanter Gag, dann war er witzig!
Zu meiner Einschätzung von "Schrecken der Vergangenheit" ein kurzer Einblick in die josefsonischen Rezensionsvorbereitungen: Bei Anthologien notiere ich auf meinem karierten DIN-A4-Stichwortzettel zu jeder Geschichte auch immer eine nach oben offene Anzahl von Plussen. Minusse vergebe ich selten – in diesem Band gar keines. Dafür lag alles um einen Median von (k)einem Plus herum: Das höchste der Gefühle waren ein vollständiges und ein eingeklammertes Plus bei Höhl-Kayser. Das ist jetzt nicht unbedingt die Wucht in Tüten.
Durchgehender Grund: Den meisten Erzählungen fehlt dieser gewisse Erlebnisfaktor, dieses Oomph, das auch den Unterschied ausmacht, ob man einen Film im Kino sieht oder sich die Handlung von jemand nacherzählen lässt. Aber auch wenn sich hier noch kein neuer Stephen King und keine neue Shirley Jackson offenbart haben, wecken diese Anthologien doch immer wieder meine Neugier. The quest continues! Beim nächsten Mal ist das Motto "Monster" dran.
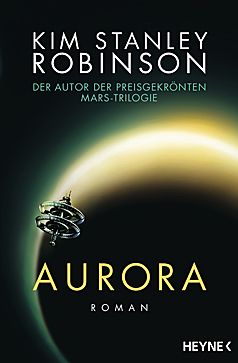
Kim Stanley Robinson: "Aurora"
Broschiert, 555 Seiten, € 15,50, Heyne 2016 (Original: "Aurora", 2015)
Meistens kommt's dann doch anders, als man befürchtet. Nach dem maßlos überschätzten Langweiler "2312" hatte ich an den nächsten SF-Roman von Kim Stanley Robinson (das Steinzeit-Zwischenspiel "Schamane" lassen wir hier mal außen vor) keine besonderen Erwartungen. Und fand "Aurora" dann unerwartet spannend – sogar mit ansteigender Kurve. Was zu einem gewissen Grad dem simplen Umstand geschuldet ist, dass die Reise zwischen Sternsystemen und der Versuch einer Kolonisierung per se einen dynamischeren Plot abgeben als ... ja, was immer es gewesen sein mag, das "2312" zusammenhalten sollte. Aber nicht nur deshalb.
Man beachte: Auch hier ist zwar wieder das drin, was "2312" streckenweise so quälend machte: lexikalische Auszüge, wörterbuchartige Begriffsaufzählungen, wissenschaftliche Trivia et cetera. Der entscheidende Unterschied ist aber weder, dass solche Passagen diesmal etwas weniger Raum einnehmen, noch dass sie in den Fließtext eingearbeitet sind, anstatt die Handlung als ständige Exkurse zu zerhacken. Er liegt darin, dass sie diesmal eine Begründung haben. Und schon wirkt das Ganze nicht mehr so prätentiös.
Was passiert
Kommen wir zunächst zur Handlung: 159 Jahre sind vergangen, seit die Erde 2545 ein Generationenschiff auf die Reise nach Tau Ceti geschickt hat: eindeutig eines der beliebtesten Sternsysteme in der Science Fiction. Es gibt sogar einen eigenen (langen und immer noch nicht vollständigen) Wikipedia-Eintrag "Tau Ceti in Fiction". 2.000 Menschen reisen an Bord dieses Riesentrumms mit, einem Doppelring, der 12 jeweils mehrere Kilometer lange Habitate umfasst, die die Klimazonen der Erde samt Flora und Fauna repräsentieren sollen.
Im ersten Teil des Romans lernen wir dieses Schiff – alter Kniff – aus der Warte von jemand kennen, der selbst noch nicht so ganz den Durchblick hat. Freya ist nämlich erst 14, zudem hat sie womöglich eine gewisse Lernschwäche. Was allerdings auch nur bedeuten könnte, dass sie so "zurückgeblieben" wie wir Menschen des 21. Jahrhunderts ist. Und überhaupt kann man die strengen Standards ihrer Mutter Devi nicht wirklich verallgemeinern. Die ist inoffizielle Chefingenieurin und Problemfeuerwehr und steht ständig unter Strom. Insbesondere Stoffwechselrisse machen ihr Sorgen, also jedes winzige Ungleichgewicht in der schiffsinternen Ökologie.
Von nun an ging's bergab
Dass sich solche Stoffwechselrisse im Lauf der Zeit tatsächlich zu gewaltigen Problemen hochschaukeln können, werden wir später im Roman noch sehen. "Aurora" wirkt in vielem wie ein Gegenentwurf zu den optimistischen Machbarkeitsvisionen von "2312" oder Robinsons bis heute populärstem Werk, der Mars-Trilogie. Und zu den vielen Illusionen, die er hier anscheinend wie Seifenblasen platzen lassen will, gehört auch die Vorstellung, dass das Reisen in einem Raumschiff ein hygienischer Vorgang wäre ...
Bei der Ankunft in Tau Ceti nimmt man Aurora ins Visier, den äußerst erdähnlichen Mond eines größeren Planeten. Dessen Erkundung liest sich auf naturkundliche Weise faszinierend, und einmal mehr kann Robinson hier sein Leib-und-Magenthema – die Ökologie – ausbreiten. Aurora scheint nur aus Wind, Eis und Gestein zu bestehen. Dazu kommt allerdings eine Komponente, mit der vorher niemand gerechnet hatte, und die nun zu einem massiven Problem wird. Damit setzt sich eine Ereigniskette in Gang, auf deren weitere Glieder ich hier nicht mehr eingehen werde, um nicht zu spoilern. Denn was die reine Handlung anbelangt, könnte man "Aurora" in einem Satz zusammenfassen. Wichtiger ist hier ohnehin das Wie.
Unsere Stimme
Im zweiten der insgesamt sieben Romanteile wird ein neuer Erzähler eingeführt, und der beginnt wirklich bei null. Devi beauftragt nämlich den Schiffscomputer damit, die Geschichte der Langzeitmission in eine Erzählung zu kleiden. Womit der zunächst seine liebe Not hat: Ein unlösbares Problem: Sätze linear, Wirklichkeit synchron. Allerdings beide zeitlich. Immer nur eine Sache auf einmal, eins nach dem anderen. Wenn möglich einen Priorisierungs-Algorithmus entwickeln. Immer wieder wird sich der Computer in Nebensächlichkeiten verzetteln und Devi ihn ermahnen: "Schiff! Komm auf den Punkt." – Was eine Metapher ist, und: Oweh! Metaphern durchblickt er ja erst recht nicht.
Wenn man böse sein will, könnte man auch sagen, dass Robinson ganz einfach aus der Not eine Tugend gemacht hat und die Schuld für seine ausschweifende Art des Erzählens nun kurzerhand jemand anderem in die Schuhe schiebt. Dass er selber immer wieder in langsames Fahrwasser gerät, zeigt hier unter anderem der unnötig lang geratene siebte Teil, der den positiven Gesamteindruck aber nicht mehr trüben wird.
Fast schon menschlich
Mit einem so eigentümlichen Erzähler ist alles ein bisschen anders. Werden die Emotionen der nominellen Hauptfiguren beschrieben, klingt dies immer ein wenig off. Es gibt ja keine übliche Introspektion. Stattdessen registriert das allsehende und -hörende Schiff objektive Daten wie Stimmenlautstärke, biometrische Messwerte und dergleichen – und interpretiert diese dann mit vulgärpsychologischem Fachgesimpel, das es sich aus seinen Datenbanken zusammenklauben muss. Was sich zumeist vergnüglich unbeholfen liest.
Typisch für seine Sicht der Welt ist auch Präzision an unüblichen Stellen: Als im Zuge eines gewalttätigen Konflikts Freya und ihre Verbündeten gefangengenommen werden, heißt es nicht einfach, dass sie durch Zertrümmern der Tür ausbrechen, nein: Nach zweiundvierzig Schlägen brach der Knauf ab; nach weiteren zweiundsechzig, die größtenteils Freya ausführte, brach das Schloss aus dem Türrahmen, und die Tür schwang auf.
Aber der Schiffscomputer, der sich im Lauf der Zeit allmählich einer echten Künstlichen Intelligenz annähert (und darauf auch ein bisschen stolz ist), wird immer besser darin, das für die Erzählung Wesentliche herauszufiltern. Und nachdem er erst einmal begriffen hat, was eine Metapher ist (zum Beispiel das Schiff als Organismus zu betrachten ...), da reitet er sie auch ausgiebig zu Tode. Das verzeiht man ihm aber, genauso wie die zwischendurch immer wieder auftauchenden neunmalklugen Anmerkungen und zeitraubenden Erklärungen ... es ist eine Art Sheldon-Cooper-Effekt.
Kann man gut lesen
Ich finde hier vieles wieder, das mich an "2312" gestört hat und mir in "Aurora" keine Probleme bereitet: Erstaunlich, was ein kleines Drehen an der Ironieschraube bewirken kann. Ebenso erstaunlich ist es, dass man ein Werk als unterhaltsam verbuchen kann, das ungefähr so ernüchternd ist wie Tom Godwins "The Cold Equations". Die Erzählung ist langwierig, aber nicht langweilig, und das gilt sogar für einen der seltsameren Höhepunkte des Romans: das vermutlich längste Bremsmanöver in der gesamten Geschichte der Science Fiction.

Linda Nagata: "The Red: Prüfungen"
Broschiert, 520 Seiten, € 16,50, Cross Cult 2017 (Original: "The Red: The Trials", 2015)
Ann Leckie: "Das Imperium"
Broschiert, 448 Seiten, € 15,50, Heyne 2017 (Original: "Ancillary Mercy", 2015)
Und dann gilt es noch zu vermelden, dass seit der letzten Rundschau die deutschen Übersetzungen zweier prominenter Titel erschienen sind. Da hätten wir zunächst mal den zweiten Teil von Linda Nagatas famoser Military-SF-Reihe "The Red", Untertitel "Prüfungen". Der ist in der Rundschau schon vor einem Jahr anhand der Originalausgabe besprochen worden, siehe obigen Link.
Besagte Prüfungen müssen US-Army-Lieutenant James Shelley und seine KameradInnen über sich ergehen lassen. Die stehen nun nämlich vor Gericht, obwohl sie eine wahnsinnige Waffenhändlerin gefasst haben, die im Interesse ihres Konzerns einen Nuklearschlag gegen die USA geführt hatte. Und doch wird Shelley, Held hin oder her, mit Misstrauen beäugt (nicht zuletzt von sich selbst). Steht er doch in einer dubiosen Beziehung zu einer Künstlichen Intelligenz, die sich in Band 1 als sein Schutzengel gebärdet hat ... offenbar aber auch ihr ganz eigenes Süppchen kocht.
Wie in Band 1, "Morgengrauen", sorgen also neben der Kampf-Action auch Paranoia und Verschwörungstheorien für Spannung. Ballern mit Köpfchen! Der Abschlussband der sehr empfehlenswerten Trilogie ("Funkstille") ist übrigens für Juli angekündigt, falls ich dann darauf vergesse.
Ferner tranken Tee ...
Bereits jetzt vollendet ist indessen Ann Leckies "Imperial Radch"-Trilogie. Und sorry: So ehrlich faszinierend ich den Auftakt ("Die Maschinen") auch fand – nach der Ödnis von Band 2 ("Die Mission", also known as "The Empire Drinks Tea") kann ich mich einfach nicht mehr überwinden, den abschließenden Teil "Das Imperium" zu lesen. Gesellschaftliches Worldbuilding reicht eben nur für einige Zeit aus – hat man sich in die betreffende Welt einmal eingelebt, wäre es ganz bezaubernd, wenn darin auch etwas geschähe.
Aber Rundschau-LeserInnen sind ja ein mündiges Publikum, die können sich auch ohne Stichworte aus einer Rezension ihre Meinung bilden. Also holt das Lilienporzellan und die Ingwerplätzchen heraus und diskutiert das unter euch selbst aus! Ich passe.
In der nächsten Rundschau treffen wir einen Besucher aus jener Zukunft, die uns immer versprochen wurde und die sich leider bisher nicht einstellen wollte. Der eine oder andere Hugo- oder Nebula-Kandidat wird vermutlich auch mit dabei sein: Da ist die Auswahl heuer ja wieder so gut wie seit Jahren nicht mehr. (Josefson, 8. 4. 2017)