
Neuaufgelegte Klassiker:
Larry Niven & Jerry Pournelle: "Extraterrestrial – Die Ankunft"
Broschiert, 400 Seiten, € 15,40, Mantikore 2017 (Original: "The Mote in God's Eye", 1974)
Philip K. Dick: "Blade Runner"
Klappenbroschur, 272 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2017 (Original: "Do Androids Dream of Electric Sheep?", 1968)
Ursula K. Le Guin: "Freie Geister"
Klappenbroschur, 432 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2017 (Original: "The Dispossessed", 1974)
David Gerrold: "Zeitmaschinen gehen anders"
Broschiert, 176 Seiten, € 10,30, Heyne 2017 (Original: "The Man Who Folded Himself", 1973)
Am 8. September ist US-Autor Jerry Pournelle im Alter von 84 Jahren verstorben. Pournelle war ein Leben lang auf der konservativen Seite des politischen Spektrums aktiv, unter anderem arbeitete er an der unter der Präsidentschaft Ronald Reagans berühmt gewordenen SDI-Initiative (vulgo Star Wars) mit. Er schrieb Artikel und Kolumnen über Computertechnologie, über Militärtaktik und über Survivalism – also die Vorbereitung auf Katastrophenfälle wie beispielsweise den in seinem Weltuntergangsroman "Lucifer's Hammer".
Als SF-Autor begann Pournelle 1973 bescheiden mit einer Adaption des Films "Flucht vom Planet der Affen". Es folgten zahlreiche weitere Romane, kürzere Erzählungen und von ihm gestaltete Anthologien, die er parallel zu seiner journalistischen und politischen Arbeit veröffentlichte. Ungewöhnlich hoch ist der Anteil an Kooperationen in seinem Werk. Pournelles bevorzugter Schreibpartner war dabei Larry Niven, mit dem ihm auch seine größten Erfolge gelangen: "Inferno", "Lucifer's Hammer" und "The Mote in God's Eye".
Splitter im Auge
Letzteres, im Original 1974 und auf Deutsch ein paar Jahre später als "Der Splitter im Auge Gottes" veröffentlicht, ist nun im Mantikore-Verlag unter dem Titel "Extraterrestrial – Die Ankunft" neu herausgegeben worden; neu übersetzt, sprachlich ok, aber einmal zu wenig durchs Korrektorat gelaufen.
"Extraterrestrial" ist der ideale Lesestoff für Fans der populären SF-Formel von Space Operas und Sternenkriegen. Die Handlung, angesiedelt im frühen 4. Jahrtausend, ergibt sich aus dem Kontakt des wiederauferstandenen Imperiums der Menschheit mit einem Volk von Aliens, das aus einer Reihe spezialisierter Subspezies besteht und nicht so freundlich ist, wie es der erste Anschein vermuten ließ. Der Roman gehört zur "CoDominium"-Future-History, in der Pournelle einen großen Teil seiner Erzählungen verbunden hat, kann aber problemlos als Einzelwerk gelesen werden.
Den nächsten Klassiker aus dem Hause Niven & Pournelle, "Lucifer's Hammer" aus dem Jahr 1977, wird Mantikore im November unter dem Titel "Komet – Der Einschlag" folgen lassen. Und der Name ist Programm: So glimpflich wie in den Filmen "Deep Impact" und "Armageddon" kommt die Menschheit hier nicht davon ...
We love Dick
Bald ist es so weit: Das von vielen SF-Fans gleichermaßen herbeigesehnte wie bang erwartete "Blade Runner"-Sequel kommt in die Kinos. Da weiß man echt nicht, ob man sich mehr freuen oder fürchten soll: Immerhin gilt es den Ruf des Originals aus dem Jahr 1982 zu wahren – das wohl immer noch die beste aller Verfilmungen von Philip K. Dicks Werken ist. (Und gibt es hier irgendjemanden, der sich nach der 2012er Version von "Total Recall" nicht die Augen mit einer Drahtbürste reinigen wollte?)
Im Vorfeld des Kinostarts hat Fischer Tor den "Blade Runner" zugrundeliegenden Roman "Do Androids Dream of Electric Sheep?" aus dem Jahr 1968 unter dem mittlerweile wohl unumgänglichen Filmtitel wiederveröffentlicht. Unbedingt lesenswert! Ob vor oder nach dem Film, spielt übrigens keine Rolle. Wer den Klassiker noch nicht gelesen hat, wird bei der Lektüre nämlich feststellen, dass es sich bei Ridley Scotts Film um eine recht freie Bearbeitung des Originalstoffs handelte.
U wie Ursula und Utopie
Schon etwas früher, ebenfalls neuübersetzt, ist bei Fischer Tor "Freie Geister" erschienen, die jüngste Version des Klassikers "The Dispossessed" aus dem Jahr 1974 (auf Deutsch zuvor unter anderem schon als "Planet der Habenichtse" veröffentlicht). Ursula K. Le Guins Roman gilt als eines der wenigen gelungenen Beispiele für eine Utopie, die nicht langweilig ist – im Allgemeinen gibt Negatives (also eine Dystopie) ja spannenderen Stoff ab als Positives.
Das gelang freilich vor allem dadurch, dass Le Guin ihren Protagonisten aus dem postrevolutionären Idyll seiner Heimatwelt Anarres auf den Nachbarplaneten Urras reisen lässt, der mit seinen hierarchischen und konfliktären Verhältnissen der uns vertrauten Welt wesentlich ähnlicher sieht. There and back again: Im Nachwort der aktuellen Ausgabe verweist Übersetzerin Karen Nölle darauf, wie sich in "Freie Geister" Form und Inhalt verbinden, wie die Rundreise des Wissenschafters Shevek sowohl mit seinen physikalischen Theorien als auch dem Aufbau der Erzählung und dem doppelten Gesellschaftsentwurf des Romans korrespondiert: Das ist schlicht und einfach elegant.
Der Irrsinn des Zeitreisens
Mein persönlicher Liebling unter den Wiederveröffentlichungen dürfte zugleich der am wenigsten bekannte der vier Titel hier sein. "The Man Who Folded Himself" aus dem Jahr 1974 habe ich vor vielen Jahren mit großem Vergnügen gelesen und empfehle die Lektüre daher gerne weiter. David Gerrold gelang es darin nämlich, dem alten und stets ein wenig problematisch gewesenen Thema Zeitreisen ganz neue Aspekte abzugewinnen.
Als Romanheld Daniel von seinem Onkel eine äußerst einfach zu handhabende Zeitmaschine geschenkt bekommt, ist dies der Auftakt eines ungewöhnlichen Abenteuers. Und das geht erst so richtig los, als sich Daniel de facto zu multiplizieren beginnt, indem er sich beim Herumhüpfen durch die Zeit immer öfter selbst begegnet (in jedem Sinne des Wortes ...). Begriffe wie "ichbezogen" oder "selbstverliebt" erhalten hier eine ganz neue Bedeutung. Und sollte noch jemand Zweifel hegen, ob das unterhaltsam sein kann: David Gerrold ist der Mann, der für "Star Trek" die Tribbles erfunden hat.
Ganz war's das übrigens noch nicht mit den Wiederveröffentlichungen: Auf den folgenden Seiten sind auch noch ein paar Bände mit Kurzgeschichten von anno dunnemals enthalten. Der Rest dieser Rundschau ist aber brandneu ... wenn auch auf die eine oder andere Weise rückwärtsgewandt.
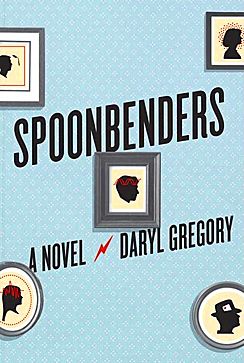
Daryl Gregory: "Spoonbenders"
Gebundene Ausgabe, 416 Seiten, Knopf 2017, Sprache: Englisch
Once, we were amazing. Was für ein wunderschöner, trauriger Satz. Er stammt vom 14-jährigen Matty, Spross einer Familie, die einmal wegen ihrer übersinnlichen Fähigkeiten berühmt war – bis Teddy Telemachus and his Amazing Family im Fernsehen als Schwindler bloßgestellt wurden und wieder in der Versenkung verschwanden. Doch es ist alles längst nicht so klar, wie es zunächst aussieht.
"Spoonbenders" ist der jüngste und vielleicht bislang beste Roman des großartigen Daryl Gregory. Der US-Autor hatte zuvor schon mehrfach auf höchst originelle Weise die Popkultur mit dem Übernatürlichen verquickt: In "Pandemonium" etwa sind Menschen von literarischen und filmischen Archetypen besessen wie von Dämonen, in "We Are All Completely Fine" bilden die Opfer bekannter Horrorfiguren eine Selbsthilfegruppe. In "Spoonbenders" steigt Gregory nun auf die unterste Ebene des Übernatürlichen ab – also dorthin, wo Kartenleger, Homöopathen und das Long Island Medium zuhause sind. Oder eben Löffelbieger. Als Einstimmung ist dem Roman ein Zitat Uri Gellers vorangestellt, auch wenn in "Spoonbenders" ironischerweise gar keine Löffel verbogen werden. Dafür dürfen wir uns unter anderem auf Telekinese, Wahrsagerei und Astralreisen einstellen. Und vor allem auf sehr viel Menschlichkeit.
Blick zurück mit Wehmut
1973 war es, als die Telemachus-Familie öffentlich gedemütigt wurde. Seitdem – wir schreiben inzwischen das Jahr 1995 – sind die damaligen Kinder erwachsen geworden und ringen mit den ganz normalen (plus ein paar ganz und gar nicht normalen) Problemen von Menschen, die irgendwie ihre Familie durchbringen müssen. Die drei Kinder Irene, Frankie und Buddy sind es auch, die zusammen mit Patriarch Teddy und dem kleinen Matty aus der dritten Generation den Roman abwechselnd erzählen: fünf Perspektiven auf ein Puzzle, das sich als ungeahnt komplex erweisen und bis zum Schluss eine Volte nach der anderen schlagen wird.
Beginnen wir mit Matty: Der erlebt mehr als nur einen Höhepunkt, als er seine Cousine heimlich durch ein Loch in der Wand beobachtet. Zum ersten Mal verlässt er da nämlich seinen Körper – und wir erfahren damit gleich zu Beginn, dass sich die Talente der Telemachus-Familie doch nicht nur auf Betrug beschränken dürften. Mattys Mutter Irene beispielsweise kann jede Lüge erkennen: eine Gabe, die ihr das Leben aber eher erschwert als erleichtert – vor allem, was Beziehungen anbelangt. Zu allem Überfluss hat sie ihren Job verloren und muss zusammen mit ihrem Sohn kleinlaut wieder bei Teddy einziehen. Der ist übrigens das einzige Familienmitglied, das tatsächlich über keinerlei übersinnliche Fähigkeit verfügt. Er ist schlicht und einfach ein Trickbetrüger – wenn auch einer mit dem berühmten goldenen Herzen.
Irenes Bruder Frankie wird sogar noch stärker vom Gefühl umgetrieben, ein Versager zu sein. Seine telekinetische Gabe ist schwach und unzuverlässig, kurz: völlig unbrauchbar. Er hat eine Firma in den Sand gesetzt, verdingt sich nun als Vertreter für angebliche Gesundheitstränke und schuldet Kredithaien eine Riesensumme mit beängstigend schnell wachsenden Zinsen. Als er von Mattys Astralreisen erfährt, versucht er sofort, seinen Neffen für einen letzten verzweifelten Coup einzuspannen.
Bleibt noch Buddy. Und dessen Gabe hängt eng mit der Struktur des Romans zusammen.
Kreuz und quer durch die Zeit
Gregory erzählt nämlich nicht linear. In jedem Kapitel erinnert sich der jeweilige Protagonist an prägende Phasen seines Lebens, Vergangenheit und Gegenwart gehen dabei nahtlos ineinander über. (Wobei genau genommen ja schon die Gegenwartsebene, auf der Irene mit einem kreischenden Modem die Möglichkeiten des Internets anno '95 kennenlernt, für uns recht retro wirkt.) Doch die Vergangenheit regt sich noch auf ganz andere Art und Weise: So erhält Teddy unerklärlicherweise immer noch Briefe seiner schon vor Jahrzehnten verstorbenen Frau Maureen; und Maureen geht darin stets auf aktuelle Ereignisse ein. Was es mit diesen Briefen aus dem Totenreich auf sich hat, gehört zu dem Gespinst an Zusammenhängen, die Gregory erst nach und nach in kunstvoller Weise offenlegt.
Buddy spielt darin eine besondere Rolle. Seine Gabe – oder sein Fluch – ist es, die Zukunft zu sehen und zu wissen, dass sie unveränderlich ist. Aber seine Visionen sind offen für Interpretationen, und Buddy sieht es als seine Pflicht an, stets die günstigste Interpretation wahr werden zu lassen. Wenn er etwa in der Zukunft einen Mann mit möglicherweise blutüberströmtem Hemd sieht, sucht er ihn sicherheitshalber auf, um ihn mit Ketchup zu bewerfen. Seinem Umfeld erscheinen seine Taten natürlich bizarr, worauf er nur mit rührender Hilflosigkeit reagiert: Buddy sought out Irene's eyes with a classic Buddy look: mystified and sorrowful, like a cocker spaniel who'd finally eviscerated his great enemy, only to find everyone angry and taking the side of the couch pillow.
Nach herkömmlichen Maßstäben verwirrt und orientierungslos, hält sich Buddy strikt an die Vorgaben seiner future memories. Unbemerkt von den anderen erzeugt er so ein kompliziertes Konstrukt aus vermeintlich sinnlosen Handlungen, deren wahre Bedeutung sich – ähnlich wie im Film "Paycheck" – erst zum entscheidenden Zeitpunkt erweisen wird. Buddy nennt diesen Zeitpunkt "the Zap" – es ist der Tag, an dem seine Erinnerungen an die Zukunft enden und alles ungewiss wird. Und dieser Tag steht kurz bevor.
Am Ende passt alles zusammen
Man fragt sich unwillkürlich, wie lange Daryl Gregory wohl vor dem eigentlichen Schreiben dagesessen hat, um seinen Plot bis ins kleinste Detail zu konstruieren. Denn am Ende fügt sich alles zusammen: Die Lebensgeschichten der Familienmitglieder, Buddys zeitenübergreifendes Handeln, eine Reihe vermeintlich unwichtiger Nebenfiguren und Requisiten, Teddys teilweise erstaunlich langfristig angelegte Betrügereien und zum Drüberstreuen noch ein Programm zur Psi-Kriegsführung aus dem Kalten Krieg und eine tödliche Bedrohung durch die örtliche Mafia: All das ergänzt sich zu einem Showdown, in dem jedes zuvor ausgelegte Puzzlestück seine Rolle spielen wird. Das ist meisterhaft durchgeführt – und ich habe absichtlich nicht "finaler Showdown" geschrieben, denn seinen letzten Twist holt Gregory erst danach aus dem Ärmel.
Die geniale Konstruktion allein wäre schon Grund genug, "Spoonbenders" zu lesen – die Art, in der das Ganze erzählt wird, macht es aber erst perfekt. Auffällig ist zunächst der Witz (und Gregorys blumige Vergleiche sind eine Klasse für sich). Noch wichtiger ist aber die tiefe Menschlichkeit der Erzählung. Gregory verleiht jeder Figur nicht nur einen eigenen Charakter, sondern auch Würde – selbst De-facto-Gaunern wie Teddy und Frankie. Und niemand kann ungerührt bleiben, wenn er liest, wie sich Buddy mit allem, was er hat, in die seit Langem herbeigesehnte Begegnung mit der Liebe seines Lebens stürzt – wissend, dass es die erste und einzige Begegnung sein wird. So manche in diesem Buch beschriebene Fähigkeit mag Schwindel sein. Doch der Roman selbst hat echten Zauber.
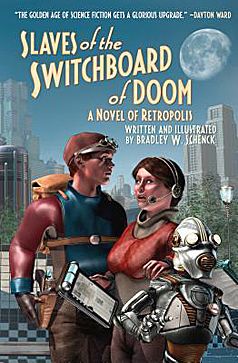
Bradley W. Schenck: "Slaves of the Switchboard of Doom: A Novel of Retropolis"
Gebundene Ausgabe, 384 Seiten, Tor Books 2017, Sprache: Englisch
Was könnten wohl die angemessenen Worte sein, um ein retrofuturistisches Googie-Pulp-Szenario zu eröffnen? The Scarlet Robots of Lemuria ... Treffer. Streng genommen stammen die Anfangsworte von "Slaves of the Switchboard of Doom" zwar aus einem nur kurz zitierten Roman-im-Roman und nicht aus der eigentlichen Handlung. Aber die geht gleich danach in eine sehr ähnliche Richtung, wenn Kelvin "Dash" Kent, freelance adventurer (und Hausmeister) aus Retropolis in den Tempel des Spinnengotts auf dem Mond eindringt, um dort eine entführte Prinzessin zu retten. Die sich als Katze entpuppt. Bizarr? In der Tat. Und auch wenn Katzen und Spinnengottjünger später noch einmal auftauchen werden, bleibt dies nur eine Episode am Rande – in einem Roman, den man am ehesten mit einem Wimmelbild vergleichen könnte.
Utopia mon amour
Retropolis sieht so aus, wie man sich im frühen 20. Jahrhundert die Zukunft vorgestellt hat: Zwischen meilenhohen Wolkenkratzern spannen sich Skyways und Monorail-Schienen, dazwischen flitzen Raketen-Cabrios und die Kapseln eines Hyperloops herum, am Himmel kreisen majestätische Luftschiffe. Und am Boden, in Alleen mit echten Bäumen, flanieren die BewohnerInnen der Millionenstadt: Menschen und Roboter gleichermaßen, Letztere gelten ebenfalls als Personen. Alles ist so blitzsauber und funktional, dass sich Straßenarbeiter die urbane Legende von der Nacht, in der einmal eine Glühbirne ausgefallen sein soll, wie eine Geistergeschichte zuraunen.
Einem allerdings ist das immer noch nicht perfekt genug: Stadtingenieur Howard Pitt, eine Art Walter Gropius mit Mad-Scientist-Einschlag, träumt von optimaler Effizienz. Menschenmassen sollten sich durch "seine" Stadt am besten wie eine Flüssigkeit bewegen, aber leider krabbeln sie mit ihren individuellen Unzulänglichkeiten ständig am Optimum vorbei. Also entwickelt er einen ganz speziellen Plan ... der schiere Wahnsinn, doch im Grunde nur die logische Konsequenz des Szenarios.
Die guten Kräfte sammeln sich
Eines der ersten Opfer Pitts ist Nola Gardner, deren Beruf wir uns – geniale Idee – als die Übertragung einer Telefonvermittlerin auf Internetnutzung vorstellen dürfen. Eines Tages wird Nolas gesamte Abteilung wegrationalisiert. Doch wer kümmert sich jetzt um die ganzen Suchanfragen? Um das herauszufinden, engagiert Nola unseren Abenteurer Dash, der mit einem Rucksack voller Spezialgeräte wie aus dem "Yps"-Heft noch jedes Geheimnis ergründet hat. Hilfreich war auch, dass sein Vater Pulp-Hefte herausgab und darauf bestand, jede noch so abstruse Technik-Idee eines Autors auf dem Dach nachzubauen.
Parallel zu Dash und Nola sind auch andere auf Spuren von Pitts Umtrieben gestoßen. So hat der Roboter Rusty eine "Artgenossin" ohne Beine gefunden – ein Hinweis darauf, dass jemand sie als Sklavin halten wollte: Völlig undenkbar in einer Gesellschaft, in der Roboter eine Organisation gegründet haben, die ihren Mitgliedern Fortbildung – sprich: Upgrades – und ökonomische Unabhängigkeit garantieren will. (Arbeiterrechte sind generell ein zentrales Thema in diesem Roman, der zwar eindeutig auf Vergnügen angelegt ist, dabei aber sein soziales Gewissen nicht vergisst.) Und auch Pitts weitaus weniger charismatischer Ingenieurskollege Abner Perkins ist auf Recherche. Er hat nämlich festgestellt, dass eine riesige Menge Inertrium verschwunden ist – jenes Anti-Schwerkraft-Metall aus dem Asteroidengürtel, dem Retropolis seine technologischen Höhenflüge verdankt.
Überblick bewahren!
Dazu kommt dann noch eine fast unüberschaubare Menge von Nebenfiguren, unter anderem: eine undurchsichtige Wissenschafterin mit erschreckenden Fähigkeiten, ein glückloser Pulp-Autor, zwei Kinder, die von Satan selbst gezeugt worden sein müssen, ein menschlicher und ein robotischer Vorarbeiter, eine ganze Brigade von Telefonfräuleins, ein durch einen Schrumpfstrahl zum Zwerg gewordener Riesenroboter und, und, und.
Man muss den Hut vor dem Autor ziehen, dass er auf keine einzige dieser Figuren vergisst und tatsächlich jeder eine Rolle zukommen lässt, ohne die das komplexe Puzzle nicht gelöst werden könnte. Als Leser allerdings ist man mit der Zeit etwas überfordert, da alle paar Seiten die Perspektive gewechselt wird. Nach einiger Zeit weiß man kaum noch, wer gerade wo ist – nicht zuletzt auch deshalb, da ein erheblicher Teil der Handlung daraus besteht, dass in gesperrte Anlagen eingedrungen wird, die sich als Fallen erweisen, worauf stets wildes Rennen, Retten, Flüchten folgt. Der eigentliche Handlungsfortschritt ist hingegen recht gemächlich, etwas Kürzung hätte dem Roman durchaus gutgetan. Wie gesagt: ein Wimmelbild. Das fordert das Orientierungsvermögen erheblich – aber am Ende fügt sich alles zusammen.
Mit Spaß bei der Sache
Mit Elan Mastais "All Our Wrong Todays" hatten wir zu Beginn des Jahres schon einen großartigen Roman, der retrofuturistische Visionen heraufbeschwor. Während Mastai aber eine ungeahnte Richtung einschlug, bleibt Bradley W. Schenck in "Slaves of the Switchboard of Doom" dem ursprünglichen Worldbuilding treu. Retro rules: Freuen wir uns über beiläufig fallende Ortsbezeichnungen wie Lem, Rur oder Lovelace und fantastische Apparaturen mit entsprechenden Namen wie den Ogmatronic 1400 oder den Diffractonator (einen Personenmultiplikator, der auf ebenso originelle Weise funktioniert wie der zuvor erwähnte Schrumpfstrahl).
Erzählt wird der Roman passenderweise in einem leicht altmodisch wirkenden Ton wohlerzogener Amüsiertheit – Zitate erübrigen sich, weil das Ganze eher über den Gesamteindruck wirkt. Zum Drüberstreuen gibt's dann noch eine ganze Reihe von Running Gags: Von der Schwierigkeit, einen kaputten Raumhelm zu reklamieren bis zum völligen Wahnsinn des Experimental Research District: Das ist der de facto gesetzlose Bezirk von Retropolis, in dem man sämtliche WissenschafterInnen wegen der akuten Explosionsgefahr ihrer Forschungen eingeschlossen hat. Auch die werden übrigens noch ihre Rolle im Showdown des Romans spielen. Kurz: Schenck hatte beim Schreiben offensichtlich jede Menge Spaß.
The real Retropolis
US-Amerikaner Bradley W. Schenck hat sich erst in den vergangenen Jahren verstärkt dem Schreiben zugewandt, zuvor hatte er jahrzehntelang als Illustrator und Computerkünstler gearbeitet. Diesem Beruf verdankt "Slaves of the Switchboard of Doom" auch die liebenswert gestalteten Illustrationen: Siehe Titelbild, im Fließtext gibt's noch jede Menge mehr davon (ein Grund, der gedruckten Ausgabe gegenüber dem E-Book den Vorzug zu geben). Weitere Beispiele finden sich auf Schencks Website Webomator, zusammen mit einer wachsenden Liste kürzerer Erzählungen aus der wundervollen Welt von Retropolis. Ein Besuch lohnt!

Doron Rabinovici: "Die Außerirdischen"
Gebundene Ausgabe, 256 Seiten, € 22,70, Suhrkamp 2017
Immer wenn ein Autor aus der Mainstreamliteratur SF-Motive aufgreift ... nein, stopp. Erst mal eine Vorab-Info, damit die nächsten Absätze keinen falschen Eindruck erwecken: "Die Außerirdischen" ist ein beeindruckender Roman, ich kann ihn guten Gewissens empfehlen. – Zurück zum Beginn: Immer wenn ein Autor aus der Mainstreamliteratur SF-Motive aufgreift, wünscht man sich, er hätte sich vorher eingehender mit dem Genre befasst. Dann würde so manches Schlagwort nicht fallen, allen voran das mit M wie Metapher. Soll heißen: Der Autor fühlt sich beim Bewerben seines Werks bemüßigt zu erklären, dass das ja gar keine Science Fiction sei, sondern natürlich nur eine M-e-t-a-p-h-e-r.
Newsflash: Die ganze Science Fiction ist eine Metapher. Und sie dreht sich – verschlüsselt respektive verlegt in andere Zeiten und Welten – immer um das, was uns hier und heute bewegt. Das kann natürlich auch die Vergangenheit sein. Der in Israel geborene und seit einem halben Jahrhundert in Österreich lebende Historiker und Schriftsteller Doron Rabinovici hat sich sein gesamtes berufliches Leben hindurch intensiv mit jüdischer Geschichte sowie dem Nationalsozialismus und dessen untotem Erbe auseinandergesetzt – schreibend, aber auch außerhalb der Literatur. Das findet sich natürlich auch in seinem jüngsten Roman "Die Außerirdischen" wieder, wenngleich in für viele ungewohntem Gewande.
Hoch und nieder
Speziell im deutschen Sprachraum, wo erstens das Erzählen einer Geschichte nicht wie im englischen als Wert an sich anerkannt und zweitens verbissen am Konzept einer "Hochkultur" festgehalten wird, hat man natürlich Angst, mit den Produkten der Genreliteratur in einen Topf geworfen zu werden. Aber nicht nur hier: Sogar die große Margaret Atwood bleibt ja beispielsweise bei ihrer Meinung, sie schriebe keine Science Fiction. Was SF-Fans aber nicht davon abhält, ihre Romane zu lesen und sie zu verehren, man ist ja nicht nachtragend. Der Verlag, in dem "Die Außerirdischen" erschienen ist, zeigt zudem, wie unnötig Abgrenzungen sind: Suhrkamp bot stets ein Heim für Literatur, die das Feuilleton befriedigt, und war zugleich mit seiner "Phantastischen Bibliothek" vor allem in den 80ern und 90ern ein großer Player in Sachen SF und Horror. Geht doch.
Einen anderen Fettnapf, in den grenzüberschreitende AutorInnen gerne treten, lässt Rabinovici glücklicherweise aus: nämlich das Geschehen komplett zu abstrahieren und am besten den Figuren keine Namen zu geben. Das soll dann transportieren, dass hier Aussagen für die gesamte Menschheit getroffen werden – als wären die LeserInnen nicht selbst dazu in der Lage, aus der Geschichte einer konkreten Figur allgemeingültige Schlüsse zu ziehen. Rabinovicis Antiheld Sol und dessen Freundin Astrid hingegen sind aus Fleisch und Blut, und das ist auch gut so.
Der Tag, an dem die Erde stillstand
Als wir aufwachten, war über uns entschieden. Eines Nachts – anscheinend war grade auf dem ganzen Planeten Nacht – sind die Außerirdischen gelandet, und niemand hat es bemerkt. Erst am nächsten Morgen gellt die Sensationsmeldung aus Radio und Fernsehen. Astrid hält es für einen Orson-Welles-artigen Hoax, und so ganz kann man ihr das nicht verdenken. Zu sehen bekommt man die Besucher nämlich nur ein einziges Mal. Da treten nach Menschen aussehende Wesen vor die Kamera, sondern eine nichtssagende Version von "Ich bin ein Berliner" ab – und als sie anschließend wieder verschwinden, fragen sich alle, ob das tatsächlich die Aliens waren oder nicht doch eine Tanzgruppe aus dem Begrüßungskomitee.
Und dennoch löst die Nicht-Präsenz eine beispiellose Hysterie aus – erst im destruktiven Sinne (globaler Stromausfall, Panik, Plünderungen, Bandenbildung usw., Rabinovici spielt hier mit allen möglichen gängigen Genremotiven), worauf dann eine noch größere Welle der Euphorie folgt. Sol steht dabei an vorderster Front. Er arbeitet für Smack.com, ein Online-Magazin, das eigentlich Bobo-Esskultur gewidmet ist, über die Frage "Kann man Lebensmittel aus fernen Galaxien essen?" aber schnell einen Draht zur neuen Situation findet. In Windeseile wird Smack.com zum quotenstärksten Portal für Alien-Belange, in den täglichen Talkshows geben sich die üblichen Hawkings und Prechts die Klinke in die Hand.
Gesellschaftsbild
In diesem Teil glänzt "Die Außerirdischen" mit satirischen Spitzen und ist an manchen Stellen – man traut sich das Wort angesichts des Schlussteils kaum zu verwenden – saukomisch. Da wappnet sich Sol zu Beginn etwa gegen gewalttätige Plünderer im Supermarkt und nimmt nur am Rande wahr, dass die ihn als ebensolchen betrachten. Ganz zu schweigen von den Blüten, die der mediale Zirkus um den außerirdischen Friedens- und Willkommenskarneval treibt: In Johannesburg war eine Show mit einem Löwen und einem Schaf geplant. Die mächtige Raubkatze war darauf abgerichtet, das Wolltier zu schonen, ein messianisches Sinnbild für die himmlische Eintracht zwischen den Völkern, doch kurz vor dem Auftritt in einer kleinen provisorischen Manege brach der Löwe dem Schaf mit einem eleganten Prankenhieb das Genick.
Die Satire dreht sich um eine scharfe Windung weiter, als bekannt wird, dass die Aliens einen "Hunger Games"-ähnlichen Multi-Disziplinen-Wettbewerb ins Leben rufen wollen: Den Gewinnern winken Reichtum und Müßiggang auf einer paradiesischen Insel ... und die Verlierer sollen geschlachtet werden. Nach anfänglichem Entsetzen bildet sich schnell der Konsens heraus, dass das ein kleiner Preis für all das Gute ist, das die Fremden mit sich bringen; außerdem sollen ja nur Freiwillige an den Spielen teilnehmen.
Wirft man einen genaueren Blick auf dieses "Fremdgut", zeigt sich allerdings, dass all die begeistert kolportierten Heilsversprechen – neue technologische Errungenschaften, Weltfrieden, Ende von Hunger und Krankheit – nirgendwo je konkretisiert wurden. Alles nur Gerüchte, und die ganze Begeisterung (nebst Opferungen) kreist im Grunde um nichts. Zur Illustration entwickelt sich simultan dazu eine bizarre Immobilien- respektive Exomobilien-Blase um Grundstücke auf anderen Welten.
Es wird düsterer (und einfacher)
Bis hierhin befinden wir uns somit in einer Dystopie vom guten alten Typ "Eine Gesellschaft frisst ihre Kinder", wie sie die SF vor allem in den 60er und 70er Jahren hervorgebracht hat. Es fallen einem Autoren wie William F. Nolan, Pierre Pelot, Harry Harrison oder John Brunner ein. Eine solche Geschichte braucht natürlich einen kritischen Geist, der – ob gewollt oder ungeplant – zum Widerstandskämpfer wird. Diese Rolle nimmt Sol ein, der den Spielen zunehmend ablehnend gegenübersteht. Allerdings muss er feststellen, dass er gegen Windmühlen ankämpft: Dasselbe Publikum, das seine kritischen Reportagen sieht, konsumiert auch die Spiele selbst. Und vermeintliche Gegner des Systems, die er interviewt, stören sich nur an Details des Ablaufs – niemand stellt das System selbst in Frage. Die Ordnung der Welt – an dieser Stelle könnte man ganz verschiedene politische und wirtschaftliche Philosophien einsetzen – scheint keine Alternative zu kennen.
Im letzten Drittel ändert der Roman beträchtlich den Ton. Rabinovici bezieht sich in Bildern und Wortwahl dann fast ausschließlich auf den Holocaust und die unzulänglichen Versuche, diesen mittels Literatur zu erfassen. (Nein, dies ist kein weiterer dieser Berichte über die Insel, wie wir sie bereits kennen, kein Buch über den Schlachthof.) Komplett nahtlos wirkt dieser Übergang auf mich nicht, auch wenn der Autor die beabsichtigte Verbindung explizit nennt: nämlich das Konzept, das Glück der Menschheit auf die Verneinung des Menschen, auf die Auslöschung des Menschlichen zu gründen. Dass der anfängliche Humor dem nackten Grauen weicht, ist kein Problem, soviel muss ein Leser verkraften. Schade ist jedoch, dass mit diesem Wechsel auch der Übergang in ein recht einfaches Richtig-Falsch-Schema stattfindet. Klare Antworten nun, wo es zuvor nur offene Fragen gab. Dem komplexeren Szenario von einer Gesellschaft, die ihre Grundlagen nicht hinterfragen kann oder will, wird damit etwas an Kraft genommen.
Trotz dieses Abstrichs ist "Die Außerirdischen" ein starker Roman. Und ja, er fügt sich eindeutig ins Spektrum der Werke von AutorInnen, die sich nicht scheuen, ihre Science-Fiction-Romane als Science-Fiction-Romane zu bezeichnen. Stand by your choices.

Jaroslav Kalfař: "Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt"
Gebundene Ausgabe, 367 Seiten, € 22,70, Tropen 2017 (Original: "Spaceman of Bohemia", 2017)
Erinnert sich noch jemand an den Film "Auch die Kleinen wollen nach oben" mit "Miss Marple" Margaret Rutherford als Großherzogin Gloriana? In der Komödie aus dem Jahr 1963 schickt das Mini-Herzogtum Grand Fenwick zur Verblüffung der Großmächte eine Rakete ins All. Sieht fast so aus, als würde sich die Geschichte im lesenswerten Debütroman des in den USA lebenden tschechischen Autors Jaroslav Kalfař wiederholen.
Der Plot: Eine interstellare Staubwolke ist ins Sonnensystem eingedrungen, und da die klassischen Weltraumnationen mit der Erkundung zaudern, springt voller Ambition die Tschechische Republik ein. Dank zahlreicher Sponsoren, die für ebenso viele vergnügliche Product-Placement-Hinweise im Text sorgen werden, kann die böhmische Raumfahrtgeschichte feierlich beginnen: Frühling 2018. An einem warmen Aprilnachmittag blickte die tschechische Nation vom Petřínhügel hinab, als das Raumschiff JanHus1 von einem staatseigenen Kartoffelacker abhob. (...) Dann stiegen die Menschen plaudernd den Hügel hinab, um ihren Bierdurst zu stillen, und überließen das Schiff am Himmel seinem Schicksal.
Reise ins Innere, Umleitung durchs All
An Bord sitzt Protagonist Jakub Procházka in seiner Astronautenwindel vulgo Maximum Absorbency Garment und träumt davon, eine Figur im Prager Wachsfigurenkabinett zu bekommen. Es ist der Beginn einer skurrilen Reise durch den Weltraum, vor allem aber durch Jakubs Geist: angesiedelt irgendwo zwischen "Solaris" und "Peer Gynt" (wenn auch deutlich leichter verdaulich als beide) und angereichert mit viel Witz und noch mehr Wehmut. Dass die Reise eine eher metaphorische ist, zeigen nicht zuletzt seltsame Zufälle respektive Unmöglichkeiten – einmal schwebt beispielsweise die Mumie der (in Wirklichkeit in der Atmosphäre verbrannten) Hündin Laika am Bullauge vorbei.
Fantasie und Realität lassen sich spätestens dann nicht mehr voneinander unterscheiden, wenn Jakub feststellen muss, dass er nicht allein an Bord ist. Ein außerirdischer Reisender in Gestalt einer nutellasüchtigen Riesenspinne mit Küsserlippen hat sich nämlich eingeschlichen. Der Zentrale erzählt Jakub davon allerdings nichts. Erst glaubt er an Halluzinationen, später akzeptiert er seinen Gast als real, nennt ihn Hanuš und möchte seinen neuen Kumpel nicht in Gefahr bringen. Längst sind ihm die telepathischen Gespräche mit Hanuš, in denen er sein Leben Revue passieren lässt, zu wichtig geworden.
Schatten der Vergangenheit
Was Jaroslav Kalfař in seinem Roman letztlich wirklich erzählt, ist die Geschichte der jüngeren Vergangenheit seiner Heimat. Dementsprechend wurde Jakubs Biographie so konstruiert, dass sie möglichst viel an historischem Wandel in sich vereint: Jakub wurde ein paar Jahre vor der Samtenen Revolution von 1989 geboren und erlebt den Wandel und anschließenden Sprint Richtung Kapitalismus seines Landes mit. Zugleich steht die Familiengeschichte der Procházkas stellvertretend für einen typischen Generationenwandel: Die Großeltern leben noch als Bauern auf dem Land, ihren Sohn – Jakubs Vater – zog es hingegen in die Stadt, um dort Karriere zu machen. "Karriere" bedeutete in diesem Fall Arbeit für die Geheimpolizei.
Es ist kurz gesagt ein schwieriges Erbe, das Jakub da mit sich herumträgt. Und so verwundert es nicht, dass der humorvolle Ton der Erzählung nur notdürftig die Tragik und Brutalität darunter verbirgt. Ungemütlich etwa der Auftritt eines ehemaligen Folteropfers von Jakubs Vater. Und folgenreich: Der Mann wird in seiner Suche nach Gerechtigkeit die ganze Dorfgemeinschaft gegen die Procházkas aufbringen und sie schließlich zur Flucht zwingen. Verlierer sind sie am Ende alle, sowohl Jakubs Familie als auch der Mann, der die Mobbing-Spirale in Gang setzte.
Vor diesem Hintergrund wirkt folgende Ironie noch perfider: Zu Beginn sind die Ferngespräche mit seiner Frau Lenka Jakubs einziger Halt. Doch sie hat sich längst von ihm entfremdet und eines Tages bricht sie den Kontakt endgültig ab. Verzweifelt nimmt Jakub daher das Angebot des Ministeriums an, ein Auge auf Lenkas Aktivitäten zu haben – und willigt damit in eine Überwachung bis in intimste Details ein, wie sie selbst zu ČSSR-Spitzelzeiten nicht invasiver hätte sein können.
Irgendwie geht's schon, muss ja
Halt- und Orientierungslosigkeit machen den thematischen Kern des Romans aus. Jakubs Odyssee durch den Weltraum spiegelt die hektischen Versuche seines Heimatlandes wider, sich in der neuen Zeit zurechtzufinden. "Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt" verpackt komplexe Gefühlslagen, Gesellschaftssatire und philosophische Betrachtungen über Leben(wollen) und den Tod in etwas, das der Form nach als lockere Science-Fiction-Geschichte daherkommt.
Es ist, wenn man so will, ein skeptischer mitteleuropäischer Gegenentwurf zu einer anderen Allein-im-Weltraum-Geschichte, nämlich Andy Weirs "Marsianer" und dessen typisch amerikanischer "Du schaffst es"-Botschaft. Jaroslav Kalfařs Figuren können nur eines zu schaffen hoffen: sich mit dem Unvermeidlichen zu versöhnen. Aber wie sollte man sonst auch weiterleben?

Ray Bradbury: "S is for Space"
Klappenbroschur, 284 Seiten, € 11,30, Knaur 2017 (Original: "S is for Space", 1966)
[Mit der Stimme von Udo Jürgens:] Was ist Zeit, was ist Zeit? – Relativ ist sie, vor allem anderen. Erst recht in der Science Fiction: So manches Virtual-Reality-Szenario aus den 90er Jahren wirkt heute so veraltet wie eine Dampflokomotive, während viele (nicht alle) Erzählungen Cordwainer Smiths aus den 50ern und frühen 60ern immer noch wie Botschaften aus einer unvorstellbar fernen, fremden Zukunft klingen. Erzählkunst macht zeitlos, deshalb ist dieser Kurzgeschichtenband des großen Ray Bradbury auch heute noch ein Genuss (mit den üblichen Abstrichen, mehr dazu später).
Es ist die deutschsprachige Erstveröffentlichung des gleichnamigen Bands, der im Original 1966 erschien. Tatsächlich reicht er aber noch viel weiter zurück: "S is for Space" war seinerzeit eine Sammlung älterer Erzählungen – die früheste, "Der unsichtbare Junge", war im Jahr 1945 erschienen. Oft wurden Bradburys Kurzgeschichten aber in verschiedenen Sammlungen wiederveröffentlicht und mit diesen auch übersetzt. Der vorliegende Band ist als Zusammenstellung tatsächlich eine deutschsprachige Premiere, zumindest ein Großteil der 16 Geschichten war auf Deutsch aber bereits erhältlich. Elf habe ich auf die Schnelle in Sammlungen wie "Der illustrierte Mann" oder "Medizin für Melancholie" gefunden. Ich vermute aber stark, dass alle schon hier oder da auf Deutsch veröffentlicht wurden (bibliografische Angaben wären übrigens hilfreich gewesen). Nichtsdestotrotz ein schönes Wiederlesen mit einem Stück Genrehistorie.
Das Grauen im Wirtschaftswunderidyll
Die Stadt ringsum summte vor Leben. Die Straßen waren von gepflegten Gärten und idyllischen Bäumen gesäumt. Einzig der Wind brachte Unruhe über die Stadt, das Land, den Kontinent. Bäume, Kinder und breite Straßen wie diese fanden sich in tausend Städten, und dort wie hier sprachen Geschäftsleute in leisen Büros ihre Nachrichten auf Band, und Leute saßen vor den Televisoren, und Raumschiffe fuhren wie Stopfnadeln durch den blauen Himmel. Es herrschte der weltumspannende, sorglose Hochmut friedensverwöhnter Menschen, die davon ausgingen, dass es niemals mehr auch nur den kleinsten Ärger gab.
"Stunde null" aus dem Jahr 1947 macht den großartigen Auftakt. Darin haben die Kinder der Welt ein neues Spiel entdeckt, nämlich eine Invasion durch Außerirdische vorzubereiten. Die Fakten liegen von Anfang an auf dem Tisch, werden aber von den saturierten Erwachsenen nicht ernstgenommen – bis es zu spät ist. Der Überschwang der Kinder prägt den Ton der Erzählung und Bradbury versteht es meisterlich, die ausgelassene Stimmung in Windeseile in nacktes Grauen umschlagen zu lassen. 15 Jahre später wiederholte er die Plot-Formel in "Komm in meinen Keller". Wachsender Suspense tritt hier an die Stelle hektischen Tempos.
Kinder, Kinder
"S is for Space" wurde seinerzeit für ein Young-Adult-Publikum zusammengestellt, darum spielen in vielen Geschichten Kinder eine zentrale Rolle. Wie Charlie in "Der unsichtbare Junge", der von einer Hillbilly-Hexe adoptiert wurde. Der wollen ihre Zauber nicht wirklich gelingen, und so gaukelt sie ihm vor, sie habe ihn unsichtbar gemacht, um ihn an sich zu binden. Nach wechselseitigen Streichen nimmt die witzige Geschichte aber noch eine ungeahnte Wendung.
Nach einem Atomkrieg ist "Das Lächeln" angesiedelt. Die Überlebenden zerstören rituell das gesamte Erbe der Vergangenheit – nur ein kleiner Junge rettet ein ganz besonderes Stück der Kunstgeschichte. In "Die Schreiende Frau" hört die kleine Maggie Hilferufe aus dem Boden, doch niemand will ihr glauben. Das Ende der Erzählung riecht etwas nach Deus-ex-machina-Lösung – wie die Erwachsenen (schon wieder!) über das Kind hinweggehen, ist aber formidabel beschrieben.
Die schönste "Kindergeschichte" in diesem Band ist "Hallo und Lebwohl". Ihr Protagonist ist schon über 40, sieht aber immer noch wie ein Zwölfjähriger aus. Darum wandert er von einer Pflegefamilie zur anderen – sobald sein Nichtaltern aufzufallen beginnt, zieht er weiter. Eine sehr schöne Erzählung, deren Stimmung vom Wissen um die Vergänglichkeit getragen wird und die ein Urahn von Harlan Ellisons "Jeffty ist fünf" sein könnte.
Halt doch mal einer die Zeit an!
In "Hallo und Lebwohl" klingt aber auch etwas an, das typisch für Bradbury ist und die Lektüre seiner Geschichten für mich stets zu einem zweischneidigen Schwert gemacht hat. Auf der einen Seite steht die meisterliche Erzählkunst – auf der anderen das ewige Festhalten an der Vergangenheit. Was man als Kritik an der Moderne auffassen kann (ein Umstand, der sicher zu Bradburys Popularität beigetragen hat), das aber oft auf diese Formel hinausläuft: O weh, keiner liest mehr Bücher aus Papier oder glaubt an Gott, jetzt geht alles den Bach runter. Man kann schon vor dem Aufschlagen eine Stricherlliste der erwartbaren Themen anfertigen und sie dann der Reihe nach abhaken.
Zum Beispiel Fernsehen vs. Literatur: In "Der Spaziergänger" wird ein Schriftsteller verhaftet, weil er als Einziger nachts auf der Straße unterwegs ist, während alle anderen daheim vor der Glotze vegetieren. Er hatte seit Jahren nichts mehr geschrieben. Magazine und Bücher verkauften sich nicht mehr. Alles spielte sich nun nachts in den gräbergleichen Häusern ab, spann er sein Fantasiegebilde fort, die Grüfte, fahl von Fernsehlicht erfüllt, in denen die Menschen wie die Toten saßen und das graue und vielfarbene Licht ihre Gesichter berührte, ohne sie jemals wirklich zu berühren.
Oder Religion vs. Wissenschaft: "Der Mann" ist ein selbstherrlicher Raumschiffkapitän, der es nicht fassen kann, dass sich die Eingeborenen eines Planeten nicht für seine Landung interessieren, weil Jesus schon vor ihm angekommen ist. Das hat was von Buffy Sainte-Maries Song "Moonshot", und Bradbury findet ein eindringliches Bild für die Unmöglichkeit, Gott mit den Mitteln der Wissenschaft zu finden. Poetisch überzeugend ist dieses Bild – aber vielleicht ist der Grund dafür, warum die Wissenschaft bislang keine Götter gefunden hat, ja viel einfacher ... Bradbury aber bleibt metaphysisch: Auch in der Geschichte mit dem verheißungsvollen Titel "Der Kokon" scheitern drei Forscher, als sie die spirituelle Metamorphose eines Kollegen mit ihren Methoden erfassen wollen.
Die leidige Technik
Die technologische und gesellschaftliche Weiterentwicklung wird fast durchgängig negativ bewertet (bis hinein in Petitessen: in "Die Straßenbahn" etwa müssen wir halt schlucken, dass der neueingeführte Bus nie so wunderbar sein wird wie die alte Straßenbahn). In "Auf den Schwingen der Zeit" mokieren sich Zeitreisende über ihnen barbarisch erscheinende Phänomene unserer Gegenwart, welche indirekt aber natürlich laut und deutlich als verlorene Werte rüberkommen (Kernfamilie, der 4. Juli, Tierquälerei im Zirkus).
Und in den beiden aus den "Mars-Chroniken" bekannten Erzählungen "Das Millionen-Jahre-Picknick" und "Dunkel waren sie und goldäugig" flüchten zwei Familien vor dem Atomkrieg auf den Mars, wo sie alsbald den wissenschaftlich-technologischen "Irrweg" der irdischen Kultur verlassen und zu Marsianern werden. Denselben "Irrweg" also, der ihnen die Ankunft im neuen Idyll überhaupt erst ermöglicht hat. Da wird die Kritik an der Moderne schon etwas paradox.
Ambivalenz
Glücklicherweise weicht Bradbury seine Linie aber auf und kommt auch zu einigen ambivalenteren Ergebnissen. So lässt in "Die Flugmaschine" der vorausschauende chinesische Kaiser einen Erfinder bestrafen, dessen Apparat auf eine technologische Singularität hinausliefe. Der Kaiser selbst indes ist von einer anderen Erfindung fasziniert: einem ebenso putzigen wie sinnlosen mechanischen Garten mit künstlichen Vögeln – Symbol der Erstarrung.
Und in "Feuersäule" steigt der im Jahr 1933 verstorbene William Lantry 2349 aus dem Grab, um sich in einer Welt wiederzufinden, die den Tod abgeschafft hat. Alle Erinnerungen an Tod und Leid wurden beseitigt – inklusive eines Großteils der klassischen Literatur. Es ist ein unschuldiges Utopia voller netter Menschen, das Lantry derart auf die Palme bringt, dass er zum Massenmörder wird.
Als positive Identifikationsfigur für Bradburys Schwelgen in vergangenen Werten taugt Lantry (Er kam voller Hass aus der Erde) eindeutig nicht und war auch nicht als solche beabsichtigt. Dafür bringt Bradbury in einem Stoßseufzer des Untoten zum Ausdruck, was ihn selbst zum Schreiben vieler seiner wundervollen Geschichten bewegt hat: "Ich bin ein Anachronismus." Paradoxerweise aber ein zeitloser, der Erzählkunst sei's gedankt.
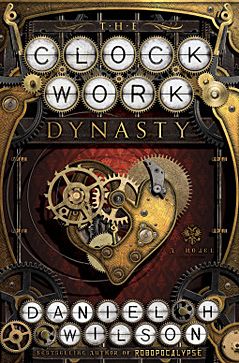
Daniel H. Wilson: "The Clockwork Dynasty"
Gebundene Ausgabe, 320 Seiten, Doubleday 2017, Sprache: Englisch
"There are strange things in the world, June. Things older than we know. Walking with the faces of men ... there are angels among us. Sometimes they will judge. And sometimes they will exact punishment." So orakelt der Großvater von Hauptfigur June Stevanov, als er seiner Enkelin im Prolog des Romans erzählt, wie er einst als kleiner Junge in Stalingrad einen Racheengel sah, der eine ganze deutsche Panzermannschaft auslöschte. Die übermenschliche Gestalt ließ damals ein Metallobjekt mit fraktalen Mustern zurück. June wird es erben und Jahrzehnte später feststellen, dass es eine Schlüsselrolle in einem Konflikt spielt, der seit Jahrtausenden anhält.
Technik-Faible
US-Autor Daniel H. Wilson kennen wir in der Rundschau von seinem unterhaltsamen Roman "Robocalypse" aus dem Jahr 2011, zu dem es auch eine Fortsetzung gab ("Robogenesis"). Dazwischen lag noch der Techno-Thriller "Das Implantat". Zusammen mit Wilsons geekig gehaltenen Sachbüchern ergibt das eine klar technophile Linie, und die setzt sich auch im aktuellen Roman "The Clockwork Dynasty" fort.
Der stammt aus dem Subgenre Secret History und dreht sich um empfindungsfähige, anthropomorphe Maschinen, die seit Anbeginn der Zeit unerkannt durch die menschliche Geschichte geistern. Als Unterfutter lässt Wilson beiläufig ein paar Namen fallen (Heron von Alexandria, Albertus Magnus) und vermischt geschickt Überlieferung und Fiktion – so soll etwa Sokrates die "beweglichen Statuen" des Dädalus kritisiert haben. Im Lauf des Romans wird sich daher immer mehr die Frage aufdrängen, wie weit denn diese geheime Maschinenhistorie zurückreichen mag.
June und die Maschinen
"The Clockwork Dynasty" wird von zwei Ich-Erzählern auf verschiedenen Zeitebenen erzählt, wobei sich die zweite der ersten allmählich annähert. June Stevanov, Erzählerin auf der Gegenwartsebene, ist mittlerweile erwachsen, in mehreren Disziplinen wissenschaftlich ausgebildet und eine Spezialistin in Sachen historische Automaten – also solche wie Wolfgang von Kempelens berühmter Schachtürke. Das rätselhafte Artefakt ihres Großvaters, das sie stets um den Hals trägt, hat ihr Leben ebenso geprägt wie ihre angeborene unstillbare Neugier: Because. It never satisfied me. But how much easier would my life be if "because" were enough?
Das darf sie sich spätestens fragen, wenn sie in Oregon eine weitere Automatenpuppe aufstöbert, damit einen Angreifer anlockt und sich plötzlich in der Rolle von Sarah Connor wiederfindet: also mitten im Gefecht zwischen einem mechanischen Raubein, das sie zu retten versucht, und einer zweiten, etwas slickeren Maschine, die ihr nach dem Leben trachtet. Die Passage, in der Letztere eine Polizeipatrouille niedermetzelt, könnte 1:1 dem "Terminator" entsprungen sein.
Fast ein Mensch
Die zweite Ebene beginnt im Jahr 1709 am Moskauer Zarenhof mit dem Erwachen der zweiten Hauptfigur, Peter. Das ist zumindest der Name, den Meister Geppetto ... pardon: Giacomo Favorini dem Mann aus Metall und Leder gibt. Peter wurde von Favorini aber nicht konstruiert, sondern lediglich wiederhergestellt und mit einer anima erneut zum Leben erweckt. In Wirklichkeit sind Peter und seine porzellanene "Schwester" Elena um vieles älter.
Zahnräder hin oder her: Im Grunde müsste man eher von Golems sprechen – nicht nur wegen ihrer alchemistischen Wiederbelebung, sondern auch weil jede Figur jeweils von einem bestimmten Wort angeleitet wird, das ihre gesamte Existenz bestimmt. Bei Peter ist es pravda als Gesamtheit von Wahrheit und Gerechtigkeit, bei Elena logicka. Elena als Verkörperung kühler Rationalität wird sehr mit dem kindlichen Erscheinungsbild hadern, das ihr über die Jahrhunderte hinweg erhalten bleibt; ganz ähnlich wie Claudia in "Interview mit einem Vampir". Zudem sind Logik und Ehrgefühl zwei Prinzipien, die zwangsläufig auf einen Konflikt hinauslaufen müssen. Womit allerdings nicht der gewalttätige Konflikt gemeint ist, der dem Roman als Plot-Driver dient. Da erwächst nämlich beiden Geschwistern (und später auch June) in der Worm Mother ein gemeinsamer Feind. Die Erklärung dieses Namens wird übrigens nicht annähernd so ekelig sein wie all die Assoziationen, die sich einem dazu im ersten Moment aufdrängen mögen, aber das nur am Rande.
Paradoxerweise erscheint von den beiden Ich-Erzählern Peter als der menschlichere. Wir erleben mit, wie er ausgebildet wird, seine Fähigkeiten erweitert, die Welt und sich selbst kennenlernt und sich mit Fortschreiten der Zeit gezwungen sieht, neue Perspektiven zu entwickeln. Was Wahrheit, Gerechtigkeit und darauf aufbauende Konzepte wie Ehre und Loyalität bedeuten, ist nämlich bei weitem nicht so eindeutig, wie es ihm zu Beginn noch schien. Im Grunde ist "The Clockwork Dynasty" also ein klassischer Bildungsroman – aber keine Angst, Action-Fans: ein Bildungsroman, in dem's ausreichend kracht und knallt.
Geheime Geschichten
In der Science Fiction gibt es so einige Beispiele für Secret Histories, die sich über Jahrtausende erstrecken – denken wir etwa an Joe Haldemans "Camouflage" oder Wesley Chus "Tao"-Reihe. Geradezu ein Eckpfeiler der Handlung ist das Motiv aber in der Contemporary Fantasy, insbesondere im Vampirroman. Da liest es sich wie ein selbstironischer Anflug Wilsons, wenn Peter und Elena am Zarenhof für Vampire gehalten werden. Tatsächlich wimmelt es in "The Clockwork Dynasty" von Mustern aus der Fantasy, von Schwertkämpfen über (hier mechanische) Krähen als Spione, flammende Schriftzüge und Junes alles entscheidendes Artefakt bis hin zum unvermeidlichen Klischeesatz "You were chosen, June."
Im Grunde genommen überträgt Wilson also einfach gängige Fantasymuster und ersetzt die üblichen Clans von Vampiren/Gestaltwandlern/Werwölfen/whatever durch eine annähernd sciencefictioneske Dynastie von Maschinen, die sich über die Jahrhunderte hinweg technisch weiterentwickeln. Aber was soll's. Erstens stellt Wilson hier erneut unter Beweis, dass er unterhaltsam schreiben kann und ein gutes Gefühl für Timing hat (siehe etwa die Schlusspointe, die er unter ein Massaker in einem Bordell setzt). Und zweitens sind Zahnräder und Metallpanzer einfach cooler als spitze Zähne und hohe Krägen.

Frank G. Gerigk (Hrsg.): "Die Welten des Rainer Erler"
Broschiert, 424 Seiten, € 14,30, p.machinery 2017
Vorsicht, Kultfaktor! Dieser Mann darf in der Retro-Rundschau auf keinen Fall fehlen, immerhin spielte der 1933 geborene Rainer Erler für die deutschsprachige Science Fiction eine ähnlich bedeutende Rolle wie Herausgeberlegende Wolfgang Jeschke oder die Gründer der "Perry Rhodan"-Serie. Erlers Leistungen lagen allerdings vor allem im Fernseh- und Filmbereich. Titel wie "Operation Ganymed", "Fleisch", "Plutonium" oder die Serie "Das Blaue Palais" haben heute noch einen magischen Klang: Wehmütige Erinnerungen an die 70er Jahre, als sich die öffentlich-rechtlichen Sender statt Provinzkrimis und aus dem Ausland kopierter Show-Formate noch eigene SF-Produktionen leisteten.
Dass Erler nicht nur Regisseur und Filmproduzent, sondern vor allem seit den 80er Jahren auch Schriftsteller war, wird neben seinen inzwischen auf DVD wieder erhältlichen Kult-Klassikern oft übersehen. Dabei gewann er mit seinen Erzählungen sogar dreimal den Kurd Laßwitz Preis (KLP). Alle drei preisgekrönten Geschichten ("Play Future", "Der Käse" und "An e-Star is born") sind auch in diesem neuen Sammelband enthalten, der Erlers thematische und stilistische Bandbreite gut wiedergibt. Die 21 chronologisch gereihten Erzählungen stammen aus dem Zeitraum von 1981 bis 2014.
Preisgekröntes
Beginnen wir gleich mit den drei Genannten: "Der Käse" (1988) hat mir erst beim zweiten Mal Lesen gefallen, weil ich auf überbordende Verwendung von Rufzeichen etwas allergisch reagiere. Allerdings sind die in dieser launigen Religionssatire unabdingbar: Mit sich aufheizender Emphase wird nämlich erzählt, wie ein notgeiler Senner Vorbereitungen trifft, die Öko-Bäuerin auf der Nachbaralm zu bespringen, während sich aus dem Schimmel auf einem seiner Käselaibe unbemerkt eine Hochkultur entwickelt. Der religiöse Eifer der Pilze gegenüber ihrem Schöpfer schwillt dabei genauso an wie der Sennerschwanz.
Für "Play Future" (1986) wählte Erler originellerweise die Form eines Fragebogens: Und zwar sollen wir LeserInnen Nachrichtenmeldungen einem Datum in der Zukunft zuordnen. Diese Meldungen sind ausschließlich positiv, entfalten in Wirklichkeit aber ein Panorama des Grauens (z.B.: Seit wann darf man wieder durch das verstrahlte Gebiet zwischen Rhein und Oder reisen?). Ein paar Details der 1986 veröffentlichten Geschichte wirken heute fast prophetisch.
Nach längerer Pause setzte es dann 2006 den dritten KLP für "An e-Star is born". Als Erzähler fungiert ein Hollywood-Regisseur, der sich mit seiner zickigen Hauptdarstellerin herumschlagen muss – bis er auf die Idee kommt, einen "digitalen Klon" von ihr zu erstellen. Die Erzählung enthält einige schöne Spitzen gegen das Filmbusiness, lässt jedoch wie auch ein paar andere Geschichten hier den ganz großen Clou am Schluss vermissen. Bis dahin ist die Reise aber höchst vergnüglich.
Weitere Highlights
Und die Sammlung kann noch mit ein paar Gustostückerln mehr aufwarten, etwa "Der Schlangenmensch". In dieser Momentaufnahme verknotet sich ein Artist vor dem Papst: Es ist der Höhepunkt eines Lebens voller verkorkster Sexualität, da man dem armen Protagonisten das Gehirn mit bigotten Vorstellungen von "Keuschheit" ebenfalls verknotet hat. Sehr originell und trotz der bizarren Umstände berührend.
In "Ein Plädoyer" muss sich ein Wissenschafter vor Gericht dafür verantworten, dass er Schimpansen auf menschliches Intelligenzniveau upgeliftet hat – was er auch voller Eifer und Selbstherrlichkeit tut. Die Geschichte läuft darauf hinaus, dass gewisse "Errungenschaften" der Zivilisation wohl unvermeidlich sind ... ich nehme sie allerdings auch als Bestätigung meiner persönlichen Hypothese, dass Schimpansen die einzige Spezies sind, die alles noch schlimmer machen würde als wir.
Da hatte jemand Spaß beim Schreiben
Vergnügen bereitet Erler auch mit "Die Heerschar Gottes", einer weiteren bösen Religionssatire mit vielversprechender Einleitung: Ein Chronist aus der Zukunft berichtet, dass der Umsturz der römisch-katholischen Kirche mit einer angeordneten Masturbation begann. Die muss mit begehrlichem Ekel ein junger Monsignore vollziehen, den man als den idealen Priester identifiziert hat. Und damit auch als den idealen Samenspender, um dem grassierenden Priestermangel entgegenzuwirken. Man weiß natürlich von Anfang an, dass das Ganze furchtbar schiefgehen muss, fragt sich aber mit diebischer Vorfreude, wie.
"Ausgeflippt oder Die Zeugung des Heiligen Joshua von Missouri" entwirft ein für die Kürze des verfügbaren Raums recht komplexes Szenario, das auf einer unfreiwilligen Zeitreise beruht. In "Glaube – Liebe – Risiko" nimmt Erler das absurde System von Schadensersatzklagen und Haftungsausschlüssen in den USA aufs Korn. Und in "Die Unbefleckte Empfängnis der Angelina de Castilla y Cortez" kann sich der Protagonist zwar seine Traumfrau schnappen, muss aber feststellen, dass die schon jemand – oder besser: etwas – anderem versprochen ist. Zum Glück findet "Kryptoplasma" aber für jeden Partner eine passgenaue Form ...
Breite Palette
"Die Welten des Rainer Erler" sind vielfältig – und in den meisten davon hat man Sex. Was von der großen Romantik über Selbstbefriedigung bis zu Tentakelsex reichen kann und zwar immer nur ein kleiner Teil der Handlung, aber eben doch in auffälliger Häufigkeit präsent ist. Erler veröffentlichte seine Erzählungen seinerzeit übrigens auch in Herrenmagazinen, was damals aber keine Besonderheit war: Erlers Beitrag für "Lui" stehen beispielsweise Geschichten von Ray Bradbury, Roald Dahl oder Stephen King gegenüber, die im "Playboy" erschienen.
Ungefähr in der Schnittmenge dieser drei Autoren darf man sich auch Erlers Themenpalette vorstellen. Sie reicht von purer SF respektive "Science-Thrillern" ("Der Commander", "Die Auserwählten", "Recycling", "Eine Liebesheirat") über Magic Realism ("Die Liebenden von Manhattan", "Der Hühnergott"), Grusel- oder Geistergeschichten ("Das unglaublich schöne Tal", "Die Flaschenpost") bis zu Erzählungen ohne Phantastik-Elemente: Die Dreierkonstellation von "Warum klaut Constanze wie ein Rabe?" etwa gäbe typischen Stoff für einen Psychothriller der langsamen Art ab, da kam der Filmemacher im Autor durch.
Kreative Zusammenstellung
Einige Parallelen zu Bradbury sind wirklich unverkennbar: der Hang zu magischem Realismus, die Thematisierung von Religion (die bei Erler allerdings stets ihr Fett wegkriegt) und eine Herangehensweise an SF, die meist so funktioniert: Nehmen wir die vertraute Welt von heute, werfen eine neue Technologie rein und schauen, wie sich die auswirkt. Seien es verführerische Roboterfrauen ("Die Orchidee der Nacht") oder das Gerät, das der Erzählung "Die Traummaschine" den Titel gegeben hat. War eigentlich eine gute Idee: Ein Forscher speichert positive Erinnerungen ab, um diese dann als Feedback in Träume einzuspeisen. Nie mehr schlechte Träume! Allerdings hat er nicht mit der Kreatitivität seines Unterbewusstseins gerechnet, das die Glücksmomente auf ganz neue Weise kombiniert ...
Mit "Die Welten des Rainer Erler" hat der umtriebige Verlag p.machinery schon wieder eine neue Reihe gestartet; diese soll sich pro Band einem wichtigen Vertreter der deutschsprachigen Phantastik widmen. Und Erler war ein gut gewählter Auftakt: Hier ist aufgrund der thematischen und stilistischen Fülle für jeden was dabei.
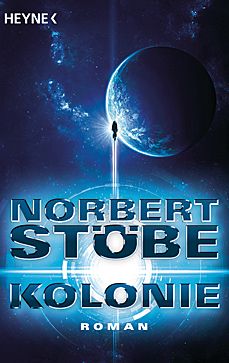
Norbert Stöbe: "Kolonie"
Broschiert, 363 Seiten, € 10,30, Heyne 2017
Menschen kolonisieren einen Planeten, der mit Mutationen zurückschlägt! Außerirdische greifen in die Evolution ein! Undurchsichtige politische Umtriebe auf der Erde! Aufstand der Roboter! Also, aus all den Ideen, die sich hier auf weniger als 400 Seiten drängeln, hätten Daniel Abraham und Ty Franck locker zwei weitere Bände für ihre "Leviathan"-Reihe herausgezuzelt, und jeder davon wäre doppelt so lang wie "Kolonie". Aber der Deutsche Norbert Stöbe, seit den 80ern aktiv und zweifach mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet, ist eben noch ein Autor der alten Schule. Und in der standen keine Streckbänke.
Das Szenario
30 Jahre sind vergangen, seit ein kleines Häuflein KolonistInnen den Planeten Corazon besiedelt hat, und nichts ist so gelaufen wie einst erhofft. Die Roboter, die den Menschen beim Aufbau der Kolonie helfen sollten, haben sich verabschiedet und ihre eigene Kolonie gegründet. Sie bauen nahe der Menschensiedlung an einer nach architektonischem Irrsinn aussehenden Stadt und erwarten darin die Ankunft der "Schöpfer". Der Prolog des Romans ist aus der Sicht der Maschinen geschrieben, und zunächst vermutet man natürlich noch, dass sie mit den Schöpfern die Menschen meinen. Rasch zeichnet sich aber ab, dass Letztere nur das verachtete funktional eingeschränkte Zwergenvolk aus der Nachbarschaft sein können und dass die Hingabe an die Schöpfer etwas metaphysischer angelegt ist.
Auch mit den eigenen Nachkommen gab's unerwartete Probleme: Alle auf Corazon geborenen Menschen sind mutiert – genauso übrigens wie die Pflanzen, die man anbaut. Da klingt Karsten Kruschels "Vilm"-Reihe ebenso an wie Ray Bradburys "Mars-Chroniken". Während bei Bradbury aus den Erdlingen allerdings nur eine Art farbverschobene Alte Römer werden, bilden die Kinder von Corazon ein Sekundärhirn genanntes externes Organ an den Schläfen aus, das sie elektromagnetische Ströme wahrnehmen lässt. Die alte Generation misstraut ihren eigenen Kindern, von denen sie nicht einmal weiß, ob es überhaupt noch Menschen sind, und hält sie deshalb seit Jahrzehnten in Quarantäne gefangen.
Kurz: Es sieht alles ziemlich hoffnungslos aus. Die Gründergeneration ist alt geworden (als passenden Weltraum-Soundtrack à la Stanley Kubricks "2001" nennt Stöbe Opus Nr. 5 aus dem Zyklus "Organverpflanzungen" ...). Man hat allerlei Zipperlein und Marotten entwickelt, versucht mit Denksportaufgaben die Demenz in Schach zu halten und schlägt sich mit zunehmenden Verfallserscheinungen der Technik herum. Resignation und Melancholie prägen die Stimmung, auf den Punkt gebracht in einem Stoßseufzer: "Denkst du auch manchmal, dass das nicht alles gewesen sein kann?" Aber keine Angst, neue Herausforderungen werden den Exo-Seniorenclub wieder mobil machen.
Der Aufbau
39 ursprüngliche KolonistInnen sind es, plus die Kinder und fünf später Hinzukommende – und allesamt werden sie vorgestellt. Der Roman hat keine wirklichen Hauptfiguren, sondern verteilt die Handlung auf viele Köpfe. Etwas stärker als die anderen in Erscheinung treten die Biologin Irina und der Ex-Captain Hank, der Roboter MIAU S3-17 sowie Kefan und Drack, Angehörige einer neuen Besiedlungswelle. Den größten Erzählraum erhält noch Irina, durch die wir das – übrigens originell und glaubhaft konstruierte – Ökosystem des Planeten kennenlernen.
Obwohl Stöbe insgesamt ein sehr straighter Erzähler ist, passt er sich im Ton doch Geschehen und ProtagonistIn des jeweiligen Kapitels an. Für die Abschnitte aus Maschinensicht oder Beschreibungen technischer Prozesse entwickelt er eine Art Hard-SF-Poesie, während Irinas Solo-Ausflug zur Stadt der Roboter zu einem psychedelischen Trip gerät; das hat dann schon wieder Anflüge von New-Wave-SF.
Fast mehr Motive als Seiten
Wie schon gesagt, hier steckt eine Menge drin. Zählen wir mal kurz auf: Zu den Konflikten mit den mutierten Kindern und den autonom gewordenen Robotern kommt später noch der mit Drack und den übrigen Neuankömmlingen von der Erde, die völlig unverhofft über Corazon einschweben und anscheinend ihr eigenes Süppchen kochen. Überhaupt spielt die Erde eine höchst undurchsichtige Rolle – gleichsam ein Sinnbild dafür ist die geheimnisvolle Blackbox im Zentrum der Kolonie, die sie mit Energie versorgt. Wie sie das tut, wollte den KolonistInnen niemand verraten.
Dazu kommt die fremdartige Natur des Planeten, für die Stöbe zwar bessere Einfälle als viele andere AutorInnen hatte, die laut Irina aber trotzdem seltsam "unterkomplex" sein soll. Weiters hätten wir da den ominösen Umstand, dass einige KolonistInnen damit beginnen, seltsame Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und zu allem Überfluss entdeckt einer von ihnen auch noch ein fremdes Objekt künstlichen Ursprungs im Orbit um Corazon. Wie gesagt: Die "Leviathan"-Bände 7 bis 8 oder 9 wären damit gesichert.
Dass Stöbe all das trotzdem in einem Band zum Abschluss bringt, liegt nicht zuletzt daran, dass er so manchen sorgsam aufgebauten Konflikt recht sang- und klanglos enden lässt. Das mag man dann enttäuschend finden – andererseits muss ja auch nicht jeder einzelne Handlungsstrang in einem Feuerwerk enden. Unterm Strich ist "Kolonie" ein auf unspektakuläre Weise schönes Planetenabenteuer mit klassischer Anmutung.

Kendare Blake: "Der schwarze Thron. Die Schwestern"
Klappenbroschur, 448 Seiten, € 15,50, Penhaligon 2017 (Original: "Three Dark Crowns", 2016)
Niemand wünscht sich ernsthaft, eine Königin zu sein: Nur selten lässt sich ein Roman so gut auf einen Satz eindampfen. Was es auf der Insel Fennbirn bedeutet, Anwärterin auf den Königinnentitel zu sein, davon gibt uns gleich der Einstieg einen guten Eindruck: Kurz vor ihrem 16. Geburtstag muss Katharine es über sich ergehen lassen, wie ein Stück Vieh von ihren Erzieherinnen begutachtet zu werden. Sie wird buchstäblich gezwickt, bis das Blut kommt – und das ist noch der angenehmere Teil der Prüfungen.
Das geometrische Szenario
Aber zoomen wir mal kurz aus und werfen einen Blick aufs Gesamtbild. Kendare Blake ist in Südkorea geboren und lebt seit ihrer Kindheit in den USA – was sich unter anderem in der Tierwelt Fennbirns widerspiegelt, die ganz eindeutig nordamerikanisch ist. Dieser zoologischen Verortung zum Trotz dürfen wir uns das Inselkönigreich eher als einen Hybrid aus Großbritannien und Avalon vorstellen: Vom nahen Kontinent aus ist das hinter Nebeln verborgene Inselkönigreich offenbar nur unter besonderen Umständen zu erreichen. Und während auf dem Festland nur noch Spuren niederer Magie zu finden sind, können die Menschen von Fennbirn, dem angeblichen Wohnort der Göttin, unter anderem noch mit Tieren sprechen oder Einfluss auf die Elemente nehmen.
... aber alles feinsäuberlich aufgeteilt. Wie so oft in der Fantasy haben wir es hier mit einer nahezu geometrischen Gesellschaftskonstruktion zu tun, die sich mühelos in ein Strategiespiel umwandeln ließe. Drei Gruppen haben die Macht untereinander aufgeteilt: Die Naturbegabten, die Tiere und Pflanzen manipulieren können; die Elementwandler, die Luft, Feuer, Erde und Wasser bis zu einem gewissen Grad lenken können; und die pharmazeutisch versierten Giftmischer (die eigentlich nicht sonderlich magisch wirken). Jede dieser drei Gruppen – man müsste eigentlich von Lobbyisten sprechen – zieht je eine Tochter der vormaligen Königin auf, denn stets werden Drillinge geboren. Und die armen Mädels müssen dann in einem Celebrity Death Match gegeneinander antreten. Denn am Ende kann es selbstverständlich nur eine geben.
Die Sinnhaftigkeit eines solchen Systems – inspiriert fühlte Blake sich übrigens durch den Konkurrenzkampf von Bienenköniginnen – gibt zwar gelinde gesagt Rätsel auf. Auf krummen Umwegen kommt die Autorin aber zu einer erstaunlich modernen Perspektive. Denn letztlich sind die Drillingsköniginnen nichts anderes als Galionsfiguren ohne wahre Entscheidungsbefugnis. Man begegnet ihnen mit bemerkenswerter Respektlosigkeit, erwartet aber auch, dass sie Macht und Glamour demonstrieren. Plus Entertainment für die Massen bieten, wie eine Passage um Katharines Konkurrentin Mirabella zeigt, die mit einer anstrengenden Blitz-und-Erdbeben-Show das Volk bei Laune halten muss. So abstrus das Szenario von "Der schwarze Thron" insgesamt auch ist – das zwiespältige Verhältnis der modernen Gesellschaft zu Royals gibt der Roman recht treffsicher wieder.
Who does what (and whom)
Kendare Blake setzt auf das seit George R. R. Martin bewährte Soap-System. Sie arbeitet mit einem großen Ensemble an Figuren (Männer spielen darin übrigens eine ähnlich prominente Rolle wie Frauen im "Herrn der Ringe"), über deren Wohl und Wehe wir dann den Überblick bewahren müssen. Was nicht ganz so leicht ist, denn hier haben wir es mit dem Dreifachen der üblichen Personenmenge zu tun: Schließlich steht jede der drei Königinnen in spe im Zentrum eines Beziehungsgeflechts – da würde man sich manchmal ein Personenregister am Ende des Romans wünschen. Ein konsequentere Eindeutschung wäre übrigens auch wünschenswert gewesen: Wenn unter hauptsächlich deutschen Orts- und Personennamen vereinzelte englische oder gar ein "Mr." auftauchen, wirkt das unrund.
Der Plotablauf ergibt sich von selbst. Der Reihe nach lernen wir jede der drei angehenden Königinnen kennen. Die schwächliche Katharine ist das Mündel der seit Generationen vorherrschenden Giftmischer, wird ihrer Rolle bislang aber nicht gerecht. Auf einem Bankett, bei dem sie traditionsgemäß ausschließlich mit vergifteten Speisen gefüttert wird, kotzt sie der Festgesellschaft die Hucke voll. Und auch ihre "naturbegabte" Schwester Arsinoe (Typ Butch) hat ihre magische Gabe noch nicht entwickelt. Nur Elementwandlerin Mirabella, die Favoritin des Tempels der Göttin, wird ihrem Ruf gerecht und lässt buchstäblich die Erde beben. Nachts allerdings wird sie von Albträumen geplagt, und wie ihre Schwestern wird auch sie versuchen davonzulaufen.
Da jede der drei Hauptfiguren durchaus sympathisch geschildert wird, bezieht der Roman seine Spannung hauptsächlich aus der Frage, welche der drei am Ende die Siegerin sein wird – oder ob sie gar einen Weg finden, das System zu umgehen. Der Rest ist – low on action, high on relations – typische Soap-Handlung; die eingebauten Liebesgeschichten haben leider einen Touch von Schulhofromanzen.
Noch nicht abgeschlossen!
Kendare Blake hat mit ihrem Roman einen Bestseller gelandet. Und es ist (siehe etwa Saladin Ahmeds "Das Schwert der Dämmerung") nicht das erste Mal, dass man sich bei einem hoch gehandelten High-Fantasy-Titel fragt, was jetzt ausgerechnet an diesem so besonders sein soll. Das fragt man sich umso mehr, wenn man wirklich herausragende Werke wie Robert Jackson Bennetts "Die Stadt der tausend Treppen" oder Seth Dickinsons "Die Verräterin" heranzieht. Im Vergleich dazu ist "Der schwarze Thron" nur Durchschnittsware.
Wer sich hingegen wie das Volk von Fennbirn für die Idee des Königinnenkampfs begeistert, für den ist jetzt der beste Zeitpunkt. Der Einstiegsband "Die Schwestern" hört nämlich beinhart mittendrin auf. Der Nachfolger "Die Königin" ist aber Anfang dieser Woche erschienen – einem Lesemarathon steht also nichts im Wege. Dann allerdings heißt es warten: Band 3 ist selbst auf Englisch noch nicht erschienen. (Hat doch wohl niemand ernsthaft erwartet, es wäre keine Trilogie, oder?)
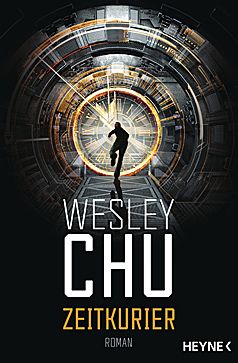
Wesley Chu: "Zeitkurier"
Broschiert, 493 Seiten, € 15,50, Heyne 2017 (Original: "Time Salvager", 2015)
Also der Vorsitzende des Wesley-Chu-Fanclubs werde ich nicht mehr. Die "Tao"-Trilogie, die den taiwanesisch-amerikanischen Autor schlagartig populär gemacht hat, begann mit "Die Leben des Tao" aussichtsreich, wenn auch mit einigen Kinderkrankheiten. Die wurden in Band 2 ("Die Tode des Tao") dann so virulent, dass ich auf Band 3 verzichtet habe. Und die gleichen Symptome treten auch wieder im darauf folgenden und nur bei flüchtiger Betrachtung reiferen Roman "Zeitkurier" auf.
Zur Handlung
Der Einstieg in die Geschichte ist originell: Chu versetzt uns nämlich in eine Zukunft, die Besuch aus einer noch ferneren Zukunft erhält; eine selten praktizierte Schichtung. Nachdem sich zwei Fraktionen der Ressourcenkriege des 23. Jahrhunderts eine Weltraumschlacht geliefert haben, tritt der Zeitreisende respektive Chronaut James Griffin-Mars aus dem 26. Jahrhundert in Erscheinung, um etwas zu stehlen. Der deutsche Titel ist übrigens Unfug – im Original heißt der Roman zur Handlung passend "Time Salvager", geht es doch darum, Objekte aus der Vergangenheit zu bergen. Das kann aus reiner Raffgier geschehen (ach, da ist also das Bernsteinzimmer hinverschwunden!). Wichtiger noch sind aber Chronauten-Missionen, um alte Energiespeicher zu retten – ohne die würde nämlich die Zivilisation des 26. Jahrhunderts zusammenbrechen. Mehr dazu später.
James hat sich an einige strenge Regeln zu halten: Um den Strom der Zeit nicht zu verändern und Paradoxa zu erzeugen, erlaubt die Organisation ChronoCom nur Missionen an Orte, die dem Untergang geweiht waren, also buchstäblich keine Zukunft hatten. Etwa ein sinkendes Schiff ... oder die Forschungsplattform Nutris, die im Jahr 2097 explodiert ist. Selbstverständlich wird James die Regeln brechen. Er begegnet auf Nutris der Wissenschafterin Elise Kim und rettet sie kurzentschlossen in seine Zeit. Von da an sind die beiden auf der Flucht vor den Schergen eines skrupellosen Konzerns und vor James' Vorgesetztem Levin Javier-Oberon. Der ist eigentlich ein ehrenwerter Mann und steht genau deshalb vor einem echten Dilemma: Zum einen ist er überzeugt davon, dass James' Zeitverbrechen geahndet werden muss – zum anderen dämmert ihm aber langsam auch, dass am Regelwerk der ChronoCom etwas ganz gewaltig stinkt. Die Fronten sind abgesteckt, das Katz-und-Maus-Spiel kann beginnen.
Nun noch eine Warnung: "Zeitkurier" ist zwar nicht als Auftakt einer Reihe deklariert, aber auch nicht wirklich abgeschlossen. Eine Fortsetzung ("Time Siege") ist im Original bereits vor einem Jahr erschienen.
Es eiert
Bei seinem allerersten Einsatz nimmt James das Rotationsmoment aus einer Zeit in die andere mit und man denkt: Wow, ist da etwa doch einmal ein Autor das Wagnis eingegangen, bei Zeit- auch die zwangsläufigen Ortsversetzungen mit einzurechnen, die sich aus der Eigenbewegung der Himmelskörper ergeben? Wird oft in Romanen erwähnt, aber dann doch immer mit irgendwelchen Handwaving-Erklärungen umgangen. Wäre für die Handlung ja auch mühsam, wenn Zeitreisende jedesmal im Weltraum aufgelesen werden müssten. Doch die anfängliche Drehung bleibt ein Einzelfall, danach kann James ganz konventionell durch die Zeiten hüpfen (und dabei sogar Funkkontakt mit seinem Lotsen in der Zukunft halten ...). Schade, Chu bleibt mal wieder inkonsequent.
Und wo die Konsequenz ausgezogen ist, hat sie ihre Schwester Plausibilität meist gleich mitgenommen. Werfen wir doch mal einen Blick auf den technischen Stand des 26. Jahrhunderts. Von der (wie alles andere völlig erklärungslos bleibenden) Zeitreisetechnologie einmal abgesehen, hätten wir da unter anderem interplanetare Raumfahrt, künstliche Schwerkraft sowie mysteriöse Subspeicher, in denen man Objekte beliebiger Größe verstauen und mit sich herumtragen kann wie Gamma in der "Micky Maus". Dazu kommt eine ganze Reihe von "Bändern", die sich die Chronauten um die Unterarme wickeln: Das Strahlungsband hält (wie auch immer) Radioaktivität fern, das Atmoband scheint (wie auch immer) den Träger unbegrenzt mit Luft zu versorgen, das Exoband erzeugt (wie auch immer) ein schimmerndes Feld kinetischer Energie, das die Kraft des Trägers erhöht und sogar Doc-Ock-artige Tentakel ausfahren kann.
All diese fantastische, fast schon magische Technologie ... und man muss Batterien aus der Vergangenheit klauen, weil man auf keine andere Idee gekommen ist, wie man die Zivilisation mit Energie versorgen könnte? Tipp: Wie wär's denn mit diesem großen hellen Ding in der Mitte des Sonnensystems? – Schon die "Tao"-Reihe litt darunter, dass die Handlungsprämissen nicht stimmten, und das ist hier leider nicht anders. Bleibt zum Abschluss noch eine Hauptfigur, die völlig inkonsistent gezeichnet wird, unterm Strich als unreifer Teenager im Körper eines erwachsenen Mannes daherkommt und Teenagerträume als Abenteuer auslebt.
Popcorn aus Papier
Der Blurb "Wesley Chu hat das Genre der Zeitreise-Romane neu erfunden" auf der Buchrückseite ist ein Witz und das Gewese um Chu – immerhin Träger des John W. Campbell Best New Writer Award 2015 – mir mittlerweile ein echtes Rätsel. "Zeitkurier" ist einmal mehr juveniles Mittelmaß, angesiedelt ziemlich passgenau auf dem Niveau von Kino-SF. Da fügt es sich doch wunderbar, dass Wesley Chu – so sagte er zumindest – einen Vertrag für eine Verfilmung einsacken konnte. Als Regisseur wurde übrigens Michael Bay kolportiert, der Mann fürs Anspruchsvolle.

André Skora, Armin Rößler & Frank Hebben (Hrsg.): "Gamer"
Broschiert, 300 Seiten, € 17,40, Begedia 2016
Erst knapp ein Jahr nach dem Erscheinen habe ich diese Anthologie zum Thema Computerspiele zu lesen begonnen – dann nämlich, als zwei Beiträge daraus, Niklas Peineckes "Emukalypse" und Michael K. Iwoleits "Das Netz der Geächteten", für den Kurd Laßwitz Preis nominiert wurden (gewonnen hat übrigens keiner von beiden). Für SF-begeisterte Gamer ist die Storysammlung natürlich ein Muss. Für diejenigen, die nur die schreiberischen Aspekte interessieren, ist es eine recht typische Anthologie mit ein paar herausragenden Beiträgen von den üblichen Verdächtigen (Iwoleit, Frank Hebben, Uwe Post, Armin Rößler), dazu einigen, die eher mitlaufen, und glücklicherweise nichts, das komplett abstürzt.
Zwei sehr unterschiedliche Erzählweisen
Kommen wir gleich zum Spitzenquartett: Michael K. Iwoleit liefert das Psychogramm eines Ex-Gamers namens Spark ab, der in einem verschwörungstheoretischen Wortschwall seiner Verachtung für die Welt Luft macht. Wegen Internetkriminalität zum Zwangs-Logout verdonnert, ist er schwer auf Entzug und spitzt daher die Ohren, als ihm das Angebot unterbreitet wird, sich in das geheime Netzwerk der "Schattenstadt" einzuklinken. Das allmähliche Hinüberdriften in diese andere Realität wird faszinierend beschrieben, das Erträglichmachen der unfassbar hässlichen Zukunftswelt durch Augmented Reality erinnert zudem an den Pillen-Einsatz im "Futurologischen Kongress". Nur das Ende hätte ich mir abgründiger erhofft.
Im experimentellsten Beitrag der Anthologie wird Frank Hebben dem Titel "Kaleidoskop" gerecht. Stellen wir uns eine Weltraumkolonie im düsteren Cyberpunk/Biopunk-Ambiente vor, Typ junger Alastair Reynolds. Anstatt es für eine linear erzählte Romanhandlung heranzuziehen, hat Hebben aus seinem durchaus detailreichen Worldbuilding aber gewissermaßen ein 3D-Modell erstellt und zoomt nun in rasend schneller Folge auf einzelne Knotenpunkte in dieser Matrix ein. Die sich so ergebende Handlung kann man entweder mit einigem Zeitaufwand und strenger Analyse rekonstruieren oder man lässt das Ganze genüsslich als Stakkato über sich hinwegbrausen. Es ist Sommer, ich bin faul, ich hab Letzteres gemacht.
Weitere Highlights
Auch Armin Rößler – im Wurdack-Verlag Herausgeber einiger der besten deutschsprachigen SF-Anthologien – hat seine Erzählung in Fragmente aufgelöst, in diesem Fall liegen sie auf unterschiedlichen Zeitebenen. "Katar 2022" ist eine bitterböse Satire über den Niedergang des Fußballs im Karussell von Kommerz und Korruption. Die Anbindung ans Anthologie-Thema Computerspiele ist eher fadenscheiniger Natur, aber who cares. Offen bleibt am Ende nur die Frage, was der phantasmagorischere Einfall ist: Dass Österreich im WM-Finale steht oder dass Leverkusen die deutsche Meisterschaft gewinnt.
Uwe Post schließlich entführt uns mit dem jungen Protagonisten von "Beschluss 4/7/90" in die DDR oder zumindest eine Version derselben. Ähnlich wie bei Iwoleit beeindruckt mich der (wenn auch für die Erzählung notwendige) Schluss noch am wenigsten daran. Hinreißend sind dafür die Beschreibungen des biederen Alltagslebens. Tante Kerstin klatscht mir freudlos Tangermünder Erdbeermarmelade auf den Teller ... da ist Musik drin. Schön zu sehen, dass Post sein Level auch dann hält, wenn er den Fuß mal etwas vom Gag-Pedal nimmt und einen Schritt auf den Boden der Mainstreamliteratur setzt.
Der Rausch des Spiels
Vieles in der Anthologie war natürlich erwartbar: Erzählungen, die formal in "Levels" aufgebaut sind, Virtualität, die plötzlich zur tödlichen Realität wird, der gefeierte Superstar der Gaming-Welt, der im wirklichen Leben eine dicke graue Maus ist (wie der von Peter Hohmanns "Cornstalk wird ewig leben"), nostalgisches Namedropping von Vintage-Spielen oder atemlos schnelles Erzählen, das den Adrenalinkick des Zockens wiederzugeben versucht – siehe etwa Melanie Ulrike Junges "Start New Game?".
Zum Thema Rausch des Spielens kann ich allerdings nur freundlich nicken und muss das Wiedererkennen anderen überlassen. Ich spiele nicht. Im Sinne von: nie. Die 80er und 90er standen bei mir ganz im Zeichen der Musik, da ist die Games-(R)Evolution komplett an mir vorbeigerauscht, und nachträglich wollte der Funke auch nicht mehr überspringen. Computerspiele erhöhen meinen Puls daher ungefähr so sehr wie ein Reit-und-Spring-Turnier oder Enie van de Meiklokjes Tortenbackstunde im TV. Sorry, Gamer!
Aus Spiel wird Ernst
Gleich mehrere der oben genannten Elemente vereint Niklas Peineckes "Emukalypse" in sich. Der Erzähler erinnert sich an seinen Lebensweg als Nerd, was jede Menge Raum bietet, die Geschichte der Computerspiele Revue passieren zu lassen (das schon im Vorwort der Anthologie angekündigte Referenzfeuerwerk). Parallel dazu rückt er zusammen mit einer alten Freundin Ebene für Ebene durch alte Videospiel-Szenarien vor – die nun aber beinharte Realität sind, weil der Code des Universums selbst umgeschrieben wurde. Von allen Erzählungen, die um das Aus-Spiel-wird-Ernst-Motiv kreisen, ist Peineckes damit eindeutig die originellste.
Konventioneller, aber dennoch spannend ist der an die TV-Serie "Chosen" erinnernde Ansatz Thorsten Küpers in seinem 30-seitigen Psychothriller "MetaGamer". Protagonist Simon wird darin wie eine Spielfigur von der Stimme eines Unbekannten ferngesteuert – bei Zuwiderhandeln setzt es tödliche Konsequenzen für die Angehörigen. Christian Lange schlägt mit "War Games" in die gleiche Kerbe: Ein Paar bewährt sich in einem Computerspiel so gut, dass die beiden zu weiteren "Tests" in eine militärisch wirkende Anlage gebeten werden. Leider wartet man vergeblich auf eine überraschende Schlusspointe. Echtes Blut fließt auch in "50% Shootout: jeder Zweite wird gelöscht" von Sven Klöpping, für das der Autor einen wilden Sprachstrom kreierte. Die inkonsistente Verwendung von bayrischem Dialekt überzeugt mich allerdings nicht.
Apropos Provinz: Dort ist auch "Galactic Tentacles" von Andreas Winterer angesiedelt, in dem zwei Jungen im Arcade-Spiel eines Landgasthauses wetteifern. Eine trotz Wendung ins Lovecraft'sche vergnügte Geschichte – nicht weltbewegend, aber eine angenehme Abwechslung, nachdem die drei vor ihr im Band gereihten Erzählungen allesamt trostlose Zukünfte gezeichnet hatten: Erst die von Junge, dann "Butterfly" von Christian Günther, das sich um Datamining im zerstörten alten Internet dreht, und schließlich Jan-Tobias Kitzels "Friedensleere" mit einer Referenz an "Soylent Green" (nein, nicht das Essen von Menschenfleisch).
Ausfahrt Retroland
Muss man die Achtziger oder Neunziger erlebt haben, um das gut zu finden? Sicher nicht. Aber es hilft, schreibt Constantin Gillies im Vorwort der Anthologie. Den höchsten Retro-Grad erreicht wohl "Die dritte Stadt" von Mike Krzywik-Groß, in dem ein Polizeiforensiker in einen liebenswert altmodischen Cyberspace gesogen wird, wie er anno '83 mit den damaligen technologischen Mitteln machbar schien: "Tron" lässt grüßen. Gillies indes, den man seit Romanen wie "Extraleben" oder "Retroland" als eine Art deutschen Ernest Cline betrachten kann, ist in "Gamer" nur mit dem Vorwort und einer Vignette ohne eigentliche Handlung vertreten ("Evergreen/Nevergreen"). Schon die paar Seiten reichen allerdings aus, seine Stärke zu zeigen: nämlich seine Begeisterung fürs Thema mitreißend zu vermitteln.
Und einen Extrapunkt gibt's von mir dafür, dass mir Gillies am Ende seiner Geschichte die passgenaueste Identifikationsfigur der ganzen Anthologie beschert hat: nämlich eine junge Mutter mit Wäschekorb, die dem Treiben der Jungs im Hobbykeller mit freundlichem Nichtbegreifen zusieht, einen für die Gamer rührend jenseitigen Kommentar absetzt und wieder entschwindet. Stranger in a strange land.
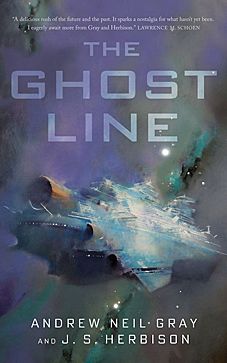
Andrew Neil Gray & J. S. Herbison: "The Ghost Line: The Titanic of the Stars"
Broschiert, 144 Seiten, Tor Books 2017, Sprache: Englisch
Wer dieses Buch bestellen will: Aufpassen, dass der Finger nicht auf den falschen Titel klickt! Außer James Youngs "The Unfortunate Starwreck of the Spaceliner Titanic" gibt es da natürlich noch Douglas Adams' Computerspiel "Starship Titanic", auf Deutsch "Raumschiff Titanic" ... was wiederum gleichzeitig der Titel eines Romans aus den 1950ern ist (hinter dem die deutsche SF-Autorin Gudrun Voigt steckt, die für verschiedene Heft- und Taschenbuchserien arbeitete und zusammen mit ihrem Mann Karl als "George P. Gray" auftrat). Und vermutlich gibt es sogar noch mehr – immerhin liegt der Gedanke, die Tragödie des Luxusliners ins Weltall zu transferieren, ja recht nah.
"The Ghost Line" von Andrew Neil Gray und Jennifer Herbison aus Kanada ist jedenfalls brandneu und im Zuge der Novellen-Offensive des Tor-Verlags erschienen. Für Gray & Herbison ist es zugleich ein erster vorsichtiger Versuch, die Zehen in die Tiefen des Langformats zu dippen.
Ist da jemand?
Eines gleich vorneweg: Auch wenn das "Titanic"-Pendant "Martian Queen" mit riesigem Speisesaal, Holzvertäfelungen, Kristalllustern und einarmigen Banditen ausgestattet ist, halten sich die Ähnlichkeiten zu seinem historischen Vorbild in Grenzen. Ein Katastrophe hat es nie gegeben – das Schiff, das einst zwischen Erde und Mars pendelte, um zahlungskräftige Passagiere zu bespaßen, wurde vor 20 Jahren ganz schlicht im Zuge einer Wirtschaftskrise eingemottet. Wie Gray & Herbison die bis in die Romangegenwart anhaltenden Folgen der Krise in ein paar verstreuten Nebensätzen dezent andeuten, gehört übrigens zu den Stärken der Erzählung.
Still und stumm kreist die "Martian Queen" immer noch auf ihrer Bahn – bis die beiden professionellen Plünderer Saga und Michel mit dem Raumschiff "Sigurd" einschweben. Ein langjähriges Paar wie die AutorInnen selbst übrigens; sowas hat man als Hauptfiguren einer Abenteuergeschichte gar nicht so oft. Mit an Bord ist außer dem natürlich wodkasaufenden und mit tiefgründigem Humor ausgestatteten russischen Piloten Gregor auch die Auftraggeberin der Mission, Wei. Wei lässt sich nicht in die Karten blicken, scheint aber mehr über die "Martian Queen" zu wissen, als sie ihrem Team anvertraut. So beharrt sie beispielsweise darauf, dass innerhalb des Geisterschiffs stets geschlossene Raumanzüge zu tragen seien. Wetten, dass sich nicht alle daran halten werden?
Rasch macht das Erkundungsteam jedenfalls einige seltsame Beobachtungen, die darauf hinweisen, dass die "Martian Queen" nicht so leblos ist wie gedacht. Und mehr sei an dieser Stelle auch nicht verraten, schließlich ist "The Ghost Line" nicht allzu lang. Man merkt der insbesondere gegen Ende etwas skizzenhaften Erzählung an, dass es sich um einen ersten Gehversuch im Langformat handelt. Als Nächstes wollen die beiden AutorInnen dann einen Roman folgen lassen.
Orpheus im Orbit
"The Ghost Line" fügt sich in die lange Reihe von Geisterschiff-Erzählungen ein, die die SF bereits hervorgebracht hat. Denken wir etwa an "Event Horizon", wenn auch mit leichter Spannung anstelle von Grauen und Gore. James Coreys "Leviathan erwacht" dürfte ebenfalls eine Inspirationsquelle gewesen sein – und last but definitely not least lässt sich hier auch der antike Orpheus-Mythos wiederfinden.
Was Plot und Ausarbeitung anbelangt, könnte die Novelle der klassischen SF der Jahrhundertmitte entsprungen sein; aufbereitet freilich für eine Leserschaft, die an Internet und Smartphones gewöhnt ist und sich wundern würde, wenn die Menschen der Zukunft nicht über vergleichbare vernetzte Informationstechnologien verfügten. Zieht man solche Details ab, erleben Hauptfigur Saga und ihr Ehemann aber im Grunde das, was Pulp-Helden schon immer erlebt haben. Gut, die Umstände des ersten Todesfalls an Bord hätte sich ein Pulp-Autor der 50er nicht zu schreiben getraut. Aber wie gesagt: Details.
Gesamtbewertung: ein netter Happen zwischendurch, aber nichts Weltbewegendes.
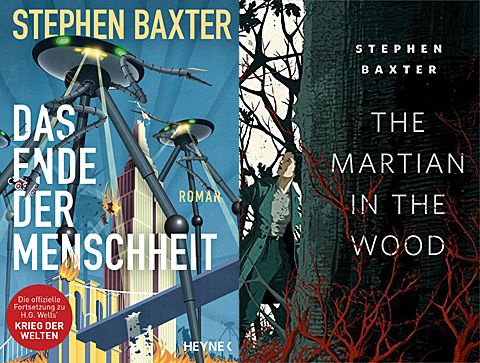
Stephen Baxter: "Das Ende der Menschheit"
Klappenbroschur, 588 Seiten, € 17,50, Heyne 2017 (Original: "The Massacre of Mankind", 2017)
Stephen Baxter: "The Martian in the Wood"
E-Book, 64 Seiten, Tor 2017, Sprache: Englisch
Erst heuer im Original veröffentlicht, klopft auch schon die Übersetzung an unsere Türen: Am 9. Oktober erscheint die deutschsprachige Version von Stephen Baxters "The Massacre of Mankind" (hier bereits besprochen). Zur Erinnerung: Es ist die Fortsetzung von H. G. Wells' Klassiker "Krieg der Welten". Die Marsianer kehren darin zurück – und diesmal bleiben sie etwas länger.
Baxter hat sich in seinem Sequel sehr viel Mühe gemacht, dem Original gerecht zu werden und Wells sowohl sprachlich als auch hinsichtlich dessen nüchterner Sichtweise auf die Welt zu emulieren (Letzteres fällt ihm bekanntlich nicht schwer). Da Baxter zahlreiche Details aus dem Kultklassiker aufgreift und nur kurz auftretende Nebenfiguren flugs zu HandlungsträgerInnen seiner Fortsetzung ausarbeitet, empfehle ich dringend, vor "Das Ende der Menschheit" noch einmal "Krieg der Welten" zu lesen. Das wird das Vergnügen verdoppeln!
Intermezzo im Wald
Zur Einstimmung ist derweil auf Englisch und nur als E-Book ein peculiar appendix to the greater tale of the War erschienen, ein Intermezzo in Novellettenlänge. Wie schon in "The Massacre of Mankind" spricht auch hier Julie Elphinstone zu uns, die Schwägerin des Erzählers von "Krieg der Welten" (der ja erst von Baxter den glamourösen Namen Walter Jenkins erhalten hat). Die eine oder andere Spitze gegen den notoriously unreliable narrator des Originals darf man sich also getrost erwarten: Wie gehabt erzählt Julie im Tonfall trockener Ironie – treffsicher böse, aber stets höflich, bestens geeignet für ein Tischgespräch.
Julie ist als Walters Archivarin auf ein paar übersehene Dokumente in dessen Nachlass gestoßen. Sie betreffen einen Vorfall aus dem Jahr 1907, kurz nach der ersten marsianischen Invasion, und werden von Julie nun, Jahrzehnte später, als imaginative reconstruction wiedergegeben. Mit anderen Worten: Baxter legt auch in dieser kurzen Erzählung wieder großen Wert auf die metafiktionale Ebene.
Zur Handlung
Und das ist es, was Julie rekonstruiert: In den gefundenen Dokumenten sind drei Monate seit dem Ende der ersten Invasion vergangen, alle Marsianer sind tot ... oder etwa doch nicht? Die junge Zena Gardner, die während der Invasion im Ausland war, kehrt auf den familiären Landsitz in Sussex zurück und muss feststellen, dass sich ihr Bruder Nathan gar seltsam verhält. Immer wieder verschwindet er in den nahen Wald von Holmburgh Wood, wo er einen Marsianer mitsamt Tripod gesehen haben will. Anfangs glaubt Zena ihm nicht, doch lässt sich nicht leugnen, dass die Gegend unter einem seltsamen Bann liegt: Das Wetter wirkt unnatürlich kalt und will sich nicht verbessern. Schafe verschwinden, und bald auch der Sohn eines Bauern. Es baut sich die Stimmung einer viktorianischen Schauermär auf.
Das kann Zena natürlich nicht auf sich beruhen lassen. Schließlich ist sie eine patente Person – ebenso klug wie tatkräftig, aus gutem Hause kommend und dennoch aufgrund ihres sozialen Gewissens revolutionären Gedanken nicht abgeneigt: Kurz, sie ist ein bisschen so wie Julie selbst. Was natürlich auch daran liegen kann, dass Julie sich die Hauptfigur ihrer Erzählung entsprechend zurechtgeschneidert hat (Stichwort unreliable narrator ...). Also entschließt sich Zena, im Wald nach dem Rechten zu sehen.
Was sie dort erwartet ... nun, sagen wir so: Baxter hat sich zwar nie genötigt gefühlt, analog zu Stephen Kings "Dunklem Turm" einen Mythos auszuarbeiten, der sein gesamtes schriftstellerisches Werk auf Biegen und Brechen verknüpfen soll. Aber eine gewisse Durchlässigkeit, was Ideen und Motive anbelangt, findet man auch in Baxters Erzählungen. Und sollte jemand die vorgefundene Überraschung für keine gelungene halten, erklimmt der Autor ein letztes Mal die Meta-Ebene und entschuldigt sich augenzwinkernd fürs gesamte Projekt eines Wells-Sequels: As is the way with all things Martian, it seems to me, the story was never wrapped up to everybody's satisfaction.
Fortsetzung folgt
Die nächste Rundschau wird dann wieder stärker nach vorne orientiert sein. Es gibt ja unter anderem Neues von John Scalzi und Alastair Reynolds. (Falls ich mich dazu durchringen kann, den zu lesen: Zum Abschluss einer Trilogie ein 900-Seiten-Monster auf die Ladentheke zu knallen, war kein netter Zug von ihm ...) Vor allem aber dürfen wir uns darüber freuen, dass der geniale David Marusek aus seiner langen schöpferischen Pause zurückgekehrt ist, hurra! (Josefson, 30. 9. 2017)