"Das steht gar nicht zur Diskussion", sagt Ina Michel-Behnke. Die Kardiologin leitet das Kinderherzzentrum am AKH Wien und stellt klar: "Herzkranke Kinder müssen an einem Zentrum behandelt werden, anders geht es nicht." Plakativ gesagt: Dass eine Herztransplantation nicht überall, sondern nur in spezialisierten Abteilungen durchgeführt werden kann, bestätigt auch Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, "das ist jedem klar".
Krebserkrankungen sind ähnlich komplex wie Herzerkrankungen. Österreichweit werden etwa 40 Prozent aller Krebspatienten an onkologischen Zentren behandelt. "Für eine Operation fahren die Menschen mitunter auch sehr weit", sagt Michael Gnant, Leiter der Universitätsklinik für Chirurgie am AKH Wien. Dennoch gebe es immer wieder Patienten, so Sevelda, die sich in Wohnortnähe behandeln lassen wollen, weil ihre Familien sie dann jeden Tag besuchen können.
Andere, so Richard Greil, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin III der Salzburger Landeskliniken, hätten auch Angst, in die "große Stadt" zur medizinischen, unpersönlichen Behandlung zu fahren. Ihnen sei gesagt, so der Mediziner: "Am Schluss steht man immer einem Menschen gegenüber, auch in der großen Stadt, nur dass dieser anders qualifiziert ist." Sevelda ergänzt: "Was sind schon hundert Kilometer, wenn die Chance, gesund zu überleben, dann um zehn bis 20 Prozent höher ist?"
Erfahren im Umgang
Die wissenschaftliche Evidenz für die Behandlung bestimmter Erkrankungen an spezialisierten Zentren ist eindeutig: Eine OECD-Untersuchung hat die Unterschiede im Fünf-Jahres-Überleben für vier Tumorerkrankungen in 38 Ländern untersucht und festgestellt, dass 45 Prozent der Unterschiede auf die Verfügbarkeit der neuesten Medikamente und das Vorhandensein onkologischer Zentren zurückzuführen sind.
Die bessere Versorgung an Zentren hat vor allem mit der Erfahrung zu tun. Bei bestimmten Erkrankungen, so Sevelda, korreliere eine Mindestfrequenz von Patienten an einer Einrichtung mit einem verbesserten Überleben. "Vor wenigen Jahren hat eine Publikation gezeigt, dass es einen Unterschied macht, ob Eierstockkrebs in einem Spital operiert wird, in dem mehr oder weniger als zwölf Fälle pro Jahr behandelt werden."
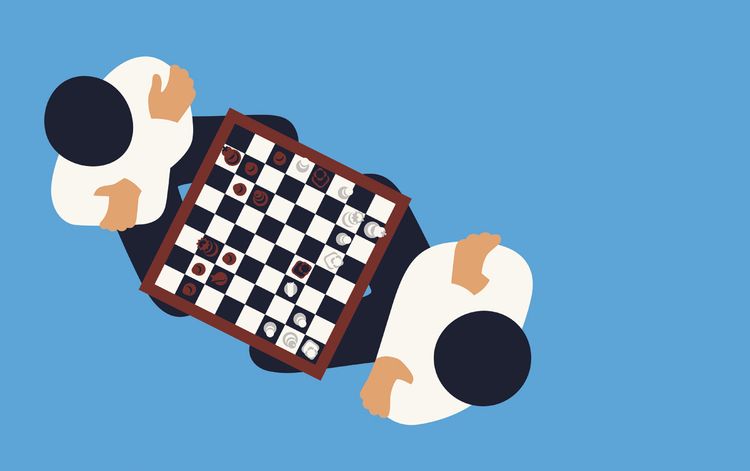
"Wenn es 150 Bauchspeicheldrüsen-OPs pro Jahr in Österreich gibt, von denen der Großteil in Wien, Linz und Graz durchgeführt wird, ist es wenig sinnvoll, eine davon beispielsweise in Reutte in Tirol vornehmen zu lassen", sagt Michael Gnant. Dort, wo komplexe Krankheitsbilder häufig behandelt werden, sind Ärzte, Pfleger, Techniker und Psychologen erfahrener im Umgang mit Patient und möglichen Symptomen, so Gnant. Es gehe dabei aber nicht um eine Frage der Wertigkeit, stellt Gnant klar, sondern um sinnvolle Aufgabenteilung.
"Getankt wird an der Tankstelle, zur Reparatur fährt man in die Werkstatt. So ist es auch in der Medizin – es gibt unterschiedliche Settings für unterschiedliche medizinische Bedürfnisse. Kleine Spitäler könnten dafür besser einen Leistenbruch versorgen oder einen Schnupfen behandeln, so Gnant.
Wirtschaftlich sinnvoll
Onkologe Greil weiß, dass ein hohes Patientenvolumen auch ökonomisch effizient ist: "An Zentren ist die Behandlungsqualität hoch, dadurch sinken Komplikationen und damit auch die Kosten." Zudem stehen Patienten in den Zentren auch viele moderne Medikamente zur Verfügung. "Wir haben Therapien oft schon vier bis fünf Jahre vor ihrer Zulassung", so Greil.
Auch die Teilnahme an klinischen Studien ist für Patienten dadurch eine Option. "Selbst wenn Patienten nur im Kontrollarm einer klinischen Studie sind, also dieselbe Behandlung wie außerhalb der Studie erhalten, sind ihre Überlebenschancen höher", berichtet Greil. Das sei vor allem auf die hohe Disziplin, Vorbereitung, Meldefrequenz, die Qualitätskontrolle und die exakte Vorgehensweise in klinischen Studien zurückzuführen.
Je komplexer eine Erkrankung ist, desto wichtiger wird vor allem auch die Zusammenarbeit von Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen. "An unserer Klinik diskutieren sechs bis acht Spezialisten in Tumorboards jährlich um die 20.000 Fälle. An mehrstündigen Operationen sind oft bis zu zehn Mediziner aus unterschiedlichen Fächern beteiligt – so etwas kann nur an Zentren geleistet werden", berichtet Gnant.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Welche Vorteile die interdisziplinäre Zusammenarbeit für Patienten hat, zeigt sich am Zentrum für Altersmedizin des Kepler-Universitätsklinikums in Linz. "Wenn Erkrankungen komplex sind oder zwischen zwei Fächern liegen, werden Patienten gleichzeitig von Ärzten verschiedener Fachrichtungen betreut", sagt Tim J. von Oertzen, Neurologe und Zentrumsleiter.
Für einen weiteren wichtigen Vorteil medizinischer Zentren hält Internist Greil auch den Zugang für Patienten: "Bei Komplikationen nehmen wir sie nicht über die Notfallaufnahme, sondern grundsätzlich sofort an unserer Klinik auf. Notärzte in allgemeinen Notfallaufnahmen haben weniger Erfahrung bei spezifischen Komplikationen und der Einschätzung ihrer Gefährlichkeit bei onkologischen Patienten. Verzögerungen können unter Umständen Leben kosten." Selbst an onkologischen Schwerpunktkrankenhäusern sei man nicht 365 Tage im Jahr, also auch am Wochenende und nachts für die Patienten da, im Zentrum sei das anders, so Greil.
Bei bestimmten Diagnosen, etwa Eierstock-, Pankreas-, Leber- oder Speiseröhrenkrebs, ist ein Zentrum die einzig richtige Anlaufstelle – darin sind sich Experten einig. Geht es über diese Erkrankungen hinaus, gehen die Meinungen auseinander. Paul Sevelda: "Es gibt auch Krebserkrankungen und -stadien, die überall behandelt werden können. Es ist heute auch nicht notwendig, ein unproblematisches Mammakarzinom an einer Uniklinik operieren zu lassen."
Spezialisierte Spitäler
Michael Gnant nennt das Krankenhaus Güssing als positives Beispiel. Dieses sei kein Zentrumsspital, dort habe man sich aber schon vor Jahren auf die Behandlung von Brustkrebs spezialisiert und stehe in engem Austausch mit der Uniklinik in Wien. "In diesem Fall kann die Behandlung auch im Burgenland stattfinden", so Gnant.
Ähnliches erzählt von Oertzen aus Oberösterreich: "Unser Epilepsiezentrum arbeitet mit Krankenhäusern im ganzen Bundesland zusammen, mehrmals pro Jahr finden Epilepsieboards statt, bei denen schwierige Patienten besprochen werden. Ist ein solcher Austausch gegeben, können Patienten mit weniger komplizierten Krankheitsbildern auch in kleineren Spitälern versorgt werden."
Gänzlich anderer Meinung ist Richard Greil, er spricht für seinen Fachbereich, die Onkologie: "Ich rate definitiv jedem Krebspatienten, zur Behandlung in ein Zentrum zu gehen." Der Internist glaubt aus mehreren Gründen, dass Krebspatienten in kleineren Spitälern schlechter aufgehoben sind. "Kleine Krankenhäuser stehen oft unter einem Existenzdruck und haben das Gefühl, ihre Betten auslasten zu müssen. Sie wollen Patienten nur in einem geringen Ausmaß abgeben, das ist gefährlich für die Versorgung. Auch Imagegründe spielen oft eine Rolle."
Wie Patienten in der Praxis den richtigen Ort für die Behandlung finden, sei derzeit noch ein ungeklärter Punkt, sagt Krebshilfe-Präsident Sevelda: "Patienten wissen zu Beginn einer Erkrankung grundsätzlich nicht, wohin sie sich wenden sollen. Es gibt derzeit keine offizielle Auskunftsstelle, die eine Art Lotsenfunktion hätte."
Späte Überweisungen
Die meisten Patienten sind daher auf die Empfehlung ihrer Vertrauensärzte angewiesen. "Diese wissen es oft, aber eben auch nicht immer", sagt Sevelda. Obwohl Haus- und Fachärzte sich um eine optimale Behandlung für ihre Patienten bemühen, spiele oft auch Regionalstolz eine Rolle, sagt Gnant. Eine Überweisung an die richtige Stelle funktioniere dann nicht immer.
Von Oertzen bestätigt, dass Patienten in den meisten Fällen oft erst über die Wege im Gesundheitssystem selbst kommen. Dass oft aber viel zu spät überwiesen wird, zeigt der Neurologe mit folgendem Beispiel: "Laut Richtlinien steht nach zwei bis drei Jahren fest, ob einem Epilepsiepatienten medikamentös geholfen werden kann. Ist das nicht der Fall, ist eine Operation eine Option. Doch die mittlere Überweisungszeit in epilepsiechirurgische Zentren in Österreich beträgt 18 Jahre. Das ist viel Zeit im Leben eines Patienten. Warum wird hier nicht früher überwiesen?"
Wie viele andere Experten empfiehlt von Oertzen: "Patienten sollten wissen, welche Therapieoptionen es gibt, und darüber mit ihren Ärzten sprechen." Greil bestätigt: "Der Patient sollte darauf drängen, überwiesen zu werden, oder er soll selbst am Zentrum vorstellig werden."
Ideale Versorgungsstruktur
Um den organisatorischen Aufwand für Patienten zu verringern, vor allem, was weite Anfahrtswege anbelangt, sprechen sich Sevelda, von Oertzen und Gnant für eine Auslagerung bestimmter Behandlungen in wohnortnahe Krankenhäuser aus. "Das Zentrum gibt Empfehlungen, die dann von Ärzten in der Peripherie durchgeführt werden, das ist die ideale Versorgungsstruktur", sagt Neurologe von Oertzen.
Ein Patient aus Litschau im Waldviertel müsse nicht jeden zweiten Tag für eine Infusion nach Wien fahren, sagt auch Gnant. Anderer Meinung ist sein Kollege Richard Greil: "Die Vorstellung, dass an einem Ort entschieden wird, und dann kann man die Anweisungen nach einem Kochrezept überall umsetzen, ist illusorisch. Ein kleines Spital, das nie damit zu tun hat, hat nicht genug Erfahrung mit neuen Medikamenten und Methoden."
Erkenntnisse besser auswerten
Gehen in dieser Frage die Meinungen weit auseinander, sind sich die Experten jedoch einig: Zentrumsmedizin bringt Vorteile für den wissenschaftlichen Fortschritt. Durch die interdisziplinäre Struktur in Zentren sei es möglich, Daten über Patienten aus verschiedenen Bereichen zu erfassen, erklärt von Oertzen. "So erfahren wir viel mehr über Epilepsie, weil auch Daten über Medikamente, Komorbiditäten, Depressionen oder Daten aus der Neurochirurgie vorhanden sind. Erkenntnisse können so weit besser ausgewertet werden."
Patienten selbst müssen sich nicht nach Expertise und Therapien im Ausland umsehen. "Alle notwendigen Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten sind in Österreich verfügbar", sagt von Oertzen. Medizinische Zentren müssen hingegen mit Partnern auf der ganzen Welt kooperieren. Greil: "Als Zentrum muss man maximal vernetzt sein und auf hohem Niveau arbeiten. Konkurrenzfähigkeit ist sehr wichtig, wir messen uns jeden Tag mit der ganzen Welt. Und das ist wiederum eine Sicherheitsgarantie für Patienten." (Bernadette Redl, CURE, 16.10.2017)