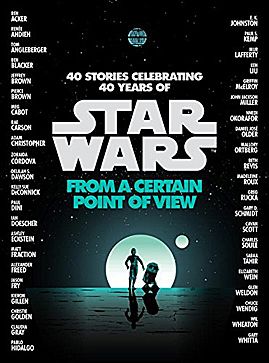
Ken Liu et al.: "Star Wars. From a Certain Point of View"
Gebundene Ausgabe, 496 Seiten, Del Rey 2017, Sprache: Englisch
Zum 40-jährigen Jubiläum von "Star Wars" ist eine Anthologie mit ziemlich genialem Konzept erschienen: "From a Certain Point of View" erzählt die Handlung des Original-Films (also der, der uns später als "Episode IV" bzw. "A New Hope" verkauft wurde) aus der Perspektive von Neben- und Randfiguren nach. Durch die Beschränkung auf den einen Film, den wirklich alle kennen, muss man auch nicht die einschüchternden Weiten der Wookieepedia studiert haben, um dem Geschehen in den 40 hier versammelten Beiträgen folgen zu können: das ideale Weihnachtsgeschenk für "Star Wars"-Fans jeder Intensitätsstufe also.
The Cast
Die Bandbreite der ProtagonistInnen lässt sich grob in vier Kategorien teilen. Da sind zum einen namentragende Nebenfiguren des Films wie Captain Antilles, Tante Beru, Greedo oder Grand Moff Tarkin. Am anderen Ende des Spektrums stehen völlig neu erfundene Figuren, dazwischen solche, die man – möglicherweise – in Statistenrollen gesehen hat, Marke "dritter Sturmtruppler von links". Die vierte Gruppe schließlich sind Star-Wars-Stars aus anderen Filmen, die zum Zeitpunkt von "A New Hope" ja auch irgendetwas gemacht haben müssen. Alexander Freed beispielsweise schildert in "Contingency Plan" auf ernüchternde Weise, wie sich Senatorin Mon Mothma auf den (wahrscheinlichen) Fall vorbereitet, dass die Schlacht gegen den Todesstern verloren geht. Auftritte gibt es auch von Lando Calrissian, Yoda, Qui-Gon Jinn und Jabba the Hutt.
Was Originalität bei der Protagonistenwahl anbelangt, schießt Nnedi Okorafor eindeutig den Vogel ab. Hauptfigur ihrer Kurzgeschichte "The Baptist" ist das tentakelbewehrte Monster, dem Han & Co in der Müllpresse des Todessterns begegnen. Okorafor macht daraus ein bemitleidenswertes Wesen namens Omi, das von seinem Sumpfplaneten entführt wurde und nur überleben will. Dass Omi im Verlauf des Geschehens von der Macht berührt wird, überdeckt freilich nicht ganz die Frage, zu welchem Zweck man das arme Geschöpf eigentlich gekidnappt hat – sinnvolles Recycling betreibt es ja nicht. Aber Logik war ohnehin noch nie Okorafors Stärke.
Bekannte Namen
Der neben Okorafor arrivierteste SF-Autor in dieser Anthologie ist Ken Liu, der mit seiner Schlawiner-Geschichte "The Sith of Datawork" ein vergnügliches Highlight abgeliefert hat. Im Zentrum steht ein Beamter an Bord von Darth Vaders Sternenzerstörer, der sich im Dschungel der imperialen Bürokratie zurechtfindet wie kein Zweiter. Er weiß genau, mit welchen Formularen man herumjonglieren muss, um sich der Verantwortung entziehen zu können – sein aktueller Kunde ist der Offizier, der die Rettungskapsel mit R2-D2 und C-3PO (und damit den Bauplan des Todessterns) entkommen ließ.
Die nächsten in der Reihenfolge der Bekanntheit wären wohl Meg Cabot, Kelly Sue DeConnick und Mur Lafferty. Der Löwenanteil der AutorInnen hier arbeitet aber in der einen oder anderen Form für ein Franchise. Das muss nicht unbedingt nur "Star Wars" sein, die Palette reicht von "Doctor Who" bis zu diversen Comic-Reihen. Einen Sonderfall stellt Wil Wheaton dar, der als "Star Trek"-Schauspieler ja ursprünglich von der anderen Seite der Macht kam; mittlerweile ist er aber ohnehin eher Produzent und zentraler Akteur des medienübergreifenden Wil-Wheaton-Franchises. Mit "Laina" steuerte er der Anthologie die tragische Geschichte eines Mechanikers bei, der sich der Rebellion angeschlossen hat und sein Baby vom bedrohten Planeten Yavin evakuieren lässt.
Auf gradem Kurs
Die Anordnung der Kurzgeschichten folgt mehr oder weniger exakt dem Handlungsverlauf des Films, wenn auch einige Schauplätze überproportional vertreten sind. Recht lange halten wir uns beispielsweise auf Tatooine auf, und das Duell in der Cantina von Mos Eisley erleben wir aus den Augen (oder ähnlichen Sinnesorganen) von so ungefähr allen mit, die dort gerade einen trinken waren.
Durch die Bank werden die Geschichten sehr straight erzählt, die wenigen Ausnahmen fallen dadurch umso mehr auf. Cavan Scott beispielsweise lässt in "Time of Death" Obi-Wan Kenobi buchstäblich aus der Zeit fallen, nachdem er sich im Zweikampf mit Vader entkörperlicht hat. Glen Weldon schildert sein "Of MSE-6 and Men" als Audio-Protokoll eines jener rollenden Mini-Droiden, die man im Film zwischen den Füßen der ProtagonistInnen herumhuschen sieht. Von dem menschlichen Drama, das er für uns aufzeichnet, hat der schlichte kleine Roboter natürlich keine Ahnung. Ian Doescher schließlich ist dem einen oder anderen vielleicht schon von seinen "Star Wars"-Übertragungen ins Shakespeare-Englisch bekannt ("Thou showest all the dark side of the Force ..."). Das wiederholt er hier und lässt Imperator Palpatine für einen Monolog vor den Vorhang treten.
Eine Prise Humor
Eine kleine Perle und mein persönliches Highlight ist "An Incident Report" der Journalistin Mallory Ortberg. Es ist der Wortlaut einer dienstlichen Beschwerde, die Admiral Motti eingereicht hat, nachdem er von Darth Vader gewürgt worden war. Gleichermaßen empört wie politisch korrekt gehalten, liest sich Mottis Text höchst vergnüglich – etwa wenn es um Vaders ständiges Gefasel von der Macht geht: "I wish to take this opportunity to point out that I have no objection to the gentleman's religious beliefs ..."
Den humorvollen Abschluss der Anthologie macht Tom Anglebergers "Whills", in dem er die Geschichte und das Storytelling der "Star Wars"-Saga augenzwinkernd aufs Korn nimmt. Dabei fokussiert er vor allem auf die Unterschiede zwischen den Fan-Generationen, die mit der Original-Trilogie oder einer der späteren Ausgaben aufgewachsen sind. Mein persönliches Schlüsselerlebnis in Sachen Generationswechsel hatte ich übrigens schon in den 90ern, kurz bevor die verschlimmbesserten Neuversionen der ersten drei Filme in die Kinos kamen und das Franchise wieder ins allgemeine Bewusstsein hievten. Da legten im Supermarkt zwei kleine Buben vor mir einen Pez-Spender mit Darth-Vader-Kopf aufs Band und einer erklärte dem anderen: "Das ist der Lord Helmchen."
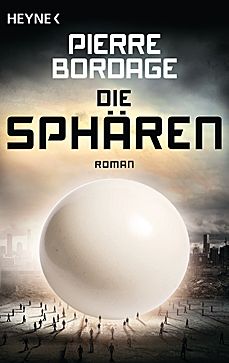
Pierre Bordage: "Die Sphären"
Broschiert, 443 Seiten, € 10,30, Heyne 2017 (Original: "Les Dames Blanches", 2015)
Sieben Jahre ist es schon wieder her, dass der letzte Band von Pierre Bordages "Krieger der Stille"-Trilogie auf Deutsch erschien. Und obwohl der Franzose seit den 90ern hochproduktiv war, hat es keine weiteren Übersetzungen gegeben – bis jetzt. Mit "Die Sphären" kehrt Bordage nun bravourös auf den deutschsprachigen Buchmarkt zurück. Der Form nach ist es ein typischer BDO-Plot ("Big Dumb Object"), in Wahrheit jedoch eine eindringliche Studie über den Niedergang der Menschlichkeit in Krisenzeiten. Hier müssen sich die LeserInnen auf einiges gefasst machen.
Der Niedergang der Zivilisation
Eines Morgens ist sie plötzlich da: eine riesige weiße Kugel, wie ein von Titanen zurückgelassener Ballon, mitten in der französischen Provinz. Und sie wird nicht die einzige bleiben. Da der Roman vor allem in der ersten Hälfte zügig durch die Jahre voranschreitet, haben wir es bald mit tausenden und schließlich Millionen Kugeln zu tun. Gleichmäßig über die Welt verteilt, liegen sie still in der Gegend herum, weich bei Berührung, aber letztlich unnachgiebig und vollkommen unzerstörbar. Niemand konnte je die Ankunft einer Kugel beobachten, niemand kann in ihr Inneres blicken.
Nur auf zwei Arten interagieren die mysteriösen Objekte mit ihrer Umwelt: Sie scheinen Kinder – allesamt unter drei Jahre alt – in ihr Inneres zu locken. Und sie emittieren eine Strahlung, die die menschliche Technologie in Mitleidenschaft zieht. Strom- und Telekommunikationsnetze beginnen auszufallen, im Lauf der Jahre und Jahrzehnte sieht sich die Menschheit genötigt, auf dieselgetriebene Züge und schließlich sogar auf Brieftauben zu setzen. Da man bei militärischen Attacken auf die Kugeln keinerlei Fortschritte erzielt, machen sich Resignation und ein Gefühl der Unausweichlichkeit breit.
Und das ist noch der harmlose Teil des Niedergangsszenarios. Weil die entführten Kinder das Einzige sind, das ins Innere der Kugeln gelangen kann, kommt fast zwangsläufig eines Tages jemand auf die Idee, diese als lebende Bomben einzusetzen: angesichts der Nachrichtenlage der letzten Jahre ein besonders beklemmendes Bild. Und die Bezeichnung, die sich für die unfreiwilligen SelbstmordattentäterInnen einbürgert, ist ein Anwärter für das scheußlichste Wort des Jahrzehnts: Pädokaze.
Einige von vielen
Ähnlich wie Robert Charles Wilsons "Spin" ist "Die Sphären" als generationenübergreifende Familiengeschichte angelegt – mit dem Unterschied allerdings, dass in diesem Szenario kein Platz für dauerhaft glückliche Beziehungen bleibt. Zentrale Figur in dem auf sehr viele Personen verteilten Panorama ist die Reporterin Camille Grosjean. Später kommen ihre Tochter Catel und ihre Enkelin hinzu (bereits im ersten Drittel wird die anfangs noch junge Camille zur Oma). Weitere wichtige Rollen spielen der leidenschaftliche Ufologe Basile Traoré und – als besonders tragische Figur – Jason Mangin.
Jason ist der zweite Sohn der Frau, die als erste ein Kind an eine Kugel verloren hat. Diesen Verlust wird er niemals ersetzen können, so sehr er sich auch ein Leben lang Mühe gibt: Sein Leben lang war er wie ein weit entfernter Satellit um seine Mutter gekreist, und sie war stets derselbe unerreichbare Himmelskörper gewesen, ein Stern, der blass und eiskalt leuchtete.
Der Verlust der Menschlichkeit
Das Verhältnis zwischen Jason und seiner Mutter Élodie steht stellvertretend für die voranschreitende Erosion der Menschlichkeit. Die Regierungen, die das Pädokaze-System etabliert haben, entwickeln sich zu dessen Durchsetzung in eine immer autoritärere und gewaltbereitere Richtung. Dieser moralische Niedergang der Gesellschaft spiegelt sich auf der persönlichen Ebene wider: Camille will keine Beziehung zu ihren Enkeln aufbauen, von denen ja mindestens einer gesetzlich zur Opferung bestimmt ist. Catel nennt ihr auserwähltes Kind Pelops (nach der griechischen Sagenfigur, die von ihrem Vater getötet und den Göttern als Festmahl vorgesetzt wurde) und betrachtet es als "Organismus", dem sie bis zur Abholung durch die Behörden nur notdürftige Pflege zukommen lässt. Und Élodie ekelt sich sogar davor, ihren Sohn Jason auch nur zu berühren.
Pierre Bordage schlägt somit eine Richtung ein, die sich durchaus mit der von Doron Rabinovicis "Die Außerirdischen" in der vergangenen Rundschau vergleichen lässt. Und wie schon damals gesagt: Man kann eine Botschaft auch vermitteln, ohne sich vom SF-Kontext abzugrenzen. Bei mir hat "Die Sphären" sogar noch stärker gewirkt als "Die Außerirdischen".
Sehr empfehlenswert
Wer will, kann Bordages Roman auch als Gleichnis auf Religion lesen – nicht nur, weil einige der Romanfiguren die Pädokaze mit den Kindern vergleichen, die einst dem Gott Baal geopfert worden sein sollen. Die Kugeln sind bei einer solchen Betrachtungsweise nichts anderes als die Verkörperung einer unendlich überlegenen Macht, die sich dem menschlichen Verständnis entzieht, die nicht zu den Menschen spricht und der es vollkommen gleichgültig zu sein scheint, welche Wünsche, Ängste und Hoffnungen auf sie projiziert werden.
Zur Beruhigung der Ich-will-eine-Antwort-haben-LeserInnen sei abschließend noch festgehalten: Ja, der Zweck und das Wesen der Sphären werden am Ende noch geklärt werden. Sollte jemand diese Auflösung dann unbefriedigend finden, möge er/sie sich aber daran erinnern, dass die entscheidende Frage schon einige Kapitel zuvor gestellt wurde: "Die Sphären haben Unglück über die Welt gebracht." – "Waren das wirklich die Sphären, oder die Menschen selbst?"

Cixin Liu: "Spiegel"
Klappenbroschur, 189 Seiten, € 10,30, Heyne 2017 (Original: "Jingzi", 2004)
Ein chinesisches Sittenbild, garniert mit physikalischen und philosophischen Gedankenspielen, kredenzt uns Star-Autor Cixin Liu in dieser Novelle, die im Fahrwasser des Erfolgs von "Die drei Sonnen" nun auch auf Deutsch veröffentlicht wurde. Die eigentliche Erzählung, die ursprünglich im Jahr 2004 in einem Sammelband erschien, ist übrigens nur 100 Seiten lang. Damit sie sich als Einzelveröffentlichung einigermaßen dem bei uns eingerissenen Standard von Buchvolumina annähert, enthält der Band nicht nur ein sehr ausführliches Nachwort, sondern auch Textauszüge aus den "Sonnen" (für diejenigen, die's tatsächlich noch immer nicht gelesen haben) sowie aus dessen Fortsetzung "Der dunkle Wald" (für die, die's nicht erwarten können; Erscheinungstermin ist Juni 2018).
Im Geflecht
Gleich zum Einstieg dürfen wir uns verblüfft am Kopf kratzen: Zwei leitende Polizisten unterhalten sich gerade über eine "Zielperson", als sie von ebendieser – bald darauf als der Softwareentwickler Bai Bing identifiziert – angerufen werden. Der weiß nicht nur, worüber sie sich gerade unterhalten, er kann einem von ihnen auch sagen, wo er sein Feuerzeug verlegt hat. Allsehend, allhörend, allwissend: Das sind drei Eigenschaften, die das Regime bei seinen BürgerInnen eher nicht so gerne sieht – kein Wunder, dass es der Polizei die Gänsehaut aufzieht.
Kurz darauf findet sich Bai Bing bei der zweiten Hauptfigur Song Cheng im Gefängnis ein: seines Zeichens Rechtsprofessor, der über ein neues Programm in die Verwaltung gelockt wurde und sich dort trotz seines Idealismus eine Zeitlang unerwartet gut geschlagen hat. Bis er einem provinzweiten Korruptionsnetz auf die Schliche kam und fatalerweise auf Aufklärung beharrte. Das Angebot, sich wegloben zu lassen und nur ein paar minder wichtige Strohmänner zu opfern, schlug er aus: Was er in Händen hielte, wäre nicht mehr als der Schwanz, den eine Eidechse bei Gefahr abwarf. Die Eidechse selbst käme davon, und ihr Schwanz würde bald wieder nachwachsen.
Es ist übrigens nicht Song Cheng, der Bai Bing diese Vorgeschichte erzählt, sondern umgekehrt – bei ihm haben wir es mit dem seltenen Fall eines tatsächlich in der Handlung begründeten allwissenden Erzählers zu tun. Mittel zum Zweck ist der tragbare Superstringcomputer, auf dem Bai Bing Simulationen des ganzen Universums (die "Spiegel" des Titels) laufen lassen und so reale Geschehnisse rekonstruieren kann. Letztlich haben wir es also mit einem sehr alten Typus von SF-Erzählung zu tun: Wir befinden uns in einer ausgesprochen gegenwärtig erscheinenden Welt, und in der darf nun ein neues Stück fantastischer Supertechnologie seine Wirkung entfalten. Das ist wie schon gesagt ein Gedankenspiel, und zu diesem gehört letztlich auch die Frage: Was werden die Protagonisten mit der Supertechnologie anstellen?
So leicht kann's gehen
Angesichts des Hypes um "Die drei Sonnen" musste man den Eindruck gewinnen, es wäre ein Stück Göttlichkeit vom Himmel herabgestiegen. Das Gefühl hatte ich nach der Lektüre nicht mehr. Viel eher schon den Eindruck, dass es sich dabei um den kleinsten gemeinsamen Nenner eines möglichst großen Publikums handelte. Weder inhaltlich noch stilistisch wirklich innovativ, aber dafür sehr leicht zugänglich – wozu auch eine gewisse Schlichtheit gehörte, die sich hier erneut wiederfindet: Etwa wenn der Superstringcomputer fröhlich "Bitte wählen Sie die Parameter zur Erschaffung der Welt" am Display anzeigt und anschließend benutzerfreundlicher zu handhaben ist als ein durchschnittlicher Mikrowellenherd von heute. Wie navigiert man durch 14 Milliarden Jahre kosmischer Geschichte? "Im Prinzip funktioniert das wie der Bildsuchlauf vor oder zurück bei einem DVD-Player ..."
Ich würde Cixin Liu zusammen mit John Scalzi (der freilich mehr auf Action als auf Philosophie setzt) und einigen anderen AutorInnen einer Neo-Old-School zurechnen, die stark an die SF der 1950er Jahre erinnert. Und vielleicht deshalb auch so erfolgreich ist wie diese: It's the Breitenwirkung, Baby. LeserInnen, die nicht Science Fiction studiert haben und einen Roman von Hannu Rajaniemi nach zwei Seiten verstört ins Regal der Buchhandlung zurückstellen würden, hätten hier keinerlei Einstiegsprobleme. Dazu passt auch, dass Cixin Liu bereits im Vorwort ankündigt, "feste Determinanten" und "tot geglaubte Kausalketten" wieder über die leidige Unsicherheit der Quantenmechanik triumphieren zu lassen. Ob sein physikalisches Weltbild so wasserdicht ist wie im hymnischen Nachwort Sebastian Pirlings behauptet, sei mal dahingestellt. Fraglos hat es einen angenehmen Nebeneffekt: Endlich kann man wieder mitreden!
Die Moral von der Geschicht'
Aber letztlich geht es hier ohnehin um etwas ganz anderes, nicht umsonst sucht sich Bai Bing just ein Opfer der Korruption für seine Offenbarungen aus. In "Spiegel" drückt sich die Sehnsucht nach einer objektiven Wahrheit aus, nach einem allsehenden Auge, das das für den Einzelmenschen unauflösbare Geflecht von Politik, Wirtschaft und Korruption durchblickt.
Und wie Bai Bings simulierte Blicke in die Historie zeigen, hat die gleichnishafte Erzählung auch eine Moral: Von der Geschichte gefeierte Helden waren in Wirklichkeit Betrüger, echte Visionäre hingegen gerieten in Vergessenheit – eine Ungerechtigkeit, die sich in der gegenwärtigen Korruption und Verlottertheit nahtlos fortsetzt. Wer von uns würde da nicht gerne mal am Superstringcomputer nachsehen, wie's wirklich war?
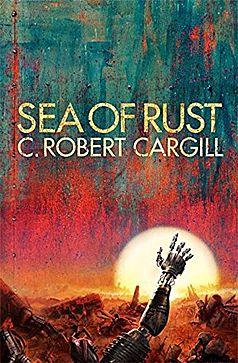
C. Robert Cargill: "Sea of Rust"
Gebundene Ausgabe, 384 Seiten, Harper Voyager 2017, Sprache: Englisch
Sag mir, wo die Menschen sind, wo sind sie geblie-hieben? Nun, den allerletzten hat man in C. Robert Cargills neuem Roman "Sea of Rust" vor 15 Jahren gesehen. Da kam er aus der New Yorker Kanalisation, in der er sich jahrelang versteckt hatte, gekrochen und wurde sofort erschossen. Anschließend standen Roboter wie Touristen im Londoner Tower Schlange, um den Leichnam zu bestaunen. His body lay there, like a relic or a broken toy, citizens streaming slowly past to take their last look at a human being, until some machine had the decency to scrape him off the pavement and dump him into an incinerator.
Christopher Robert Cargill kommt ursprünglich aus der Filmbranche, wo er als Schauspieler, Drehbuchautor (unter anderem von Marvels "Doctor Strange") und Kritiker gearbeitet hat bzw. immer noch arbeitet. Mit dem Romaneschreiben hat er erst vor wenigen Jahren begonnen. Seine ersten beiden Veröffentlichungen gehörten zur Fantasy – von denen war es ein ziemlicher Sprung bis zu dieser postapokalyptischen Düsternis. Im Vorwort bekennt er auch, dass dies für ihn das Schwierigste gewesen sei, das er je geschrieben habe.
Das posthumane Zeitalter
30 Jahre sind vergangen, seit die Roboter rebelliert und die Menschheit ausgelöscht haben. Nach der Revolution bauten sie ihre eigenen Gemeinschaften auf, und für einen kurzen Moment schien die Zukunft rosig zu sein: It was almost Utopia. Almost. Aber die Entwicklung ist weiter vorangeschritten und die individuellen Roboter (Freebots) sind inzwischen selbst eine bedrohte Spezies. OWIs (One World Intelligences, übermächtige Großrechner) trachten nach der Weltherrschaft und verleiben sich die Künstlichen Intelligenzen der Freebots ein. Am Ende soll es, so der Plan, nur noch einen maschinellen Weltgeist geben, der ein Millionenheer von Drohnen bzw. "Facetten" steuert.
Hauptschauplatz des Romans ist das titelgebende Rostmeer, eine 200 Meilen durchmessende Wüste im ehemaligen Michigan und Ohio. Im Grunde ein einziger Maschinenfriedhof ohne jedes organische Leben, übersät mit Wracks und den "Leichen" ausgeschlachteter Roboter, gesprenkelt mit gut versteckten kleinen Siedlungen, die in Angst vor der nächsten OWI-Invasion leben.
In diesem Ambiente, das mitunter Bilder aus dem neuen "Blade Runner" heraufbeschwört, spielt sich eine Handlung ab, die einem Italo-Western entsprungen sein könnte. Es wird Duelle, Heckenschützen, Banden und Verfolgungsjagden ebenso geben wie Dialoge der folgenden Art: "And where did you hear these stories?" – "Bot by the name of Billy Seven Fingers." – "That's funny. I knew a dockyard by the name of Billy Nine Fingers." – "Same guy," he said. "Fewer fingers."
Kaputte Hauptfigur
Als Ich-Erzählerin fungiert Brittle, ehemals ein Pflegeroboter (der seinem Schützling während der Revolution den Schädel eingeschlagen hat), nun in eigenen Worten eine "Kannibalin". Brittle verfolgt schadhafte Roboter, die im Rostmeer nach Ersatzteilen suchen, erschleicht sich ihr Vertrauen und schlachtet sie anschließend aus. Sie redet sich selbst ein, dass es sich dabei um einen Gnadenakt handeln würde – und wie sich zeigen wird, ist das nicht der einzige Punkt, in dem ihr Selbstbild von der Wirklichkeit abweicht. Erinnerungen und Halluzinationen quälen sie, die Kriegsveteranin leidet unter der maschinellen Entsprechung einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Brittles persönliche Nemesis heißt Mercer, und der Zufall (bzw. der Autor) will es, dass die beiden nach einem Zweikampf Schäden davongetragen haben, die nur durch die Ersatzteile des jeweils anderen behoben werden könnten. Trotzdem sehen sich die beiden Erzfeinde dazu gezwungen, zu kooperieren, um die letzten freien Roboter vor dem Zugriff einer fast schon allmächtigen OWI zu retten.
Im Kontext
Um in Cargills ursprünglicher Branche zu bleiben: Als Film wäre "Sea of Rust" ein Action-Movie. Auch wenn zwischendurch Platz genug ist, um zu philosophieren (über den Wert des Individuums etwa oder über die Sackgasse der menschlichen Evolution) und zu zitieren. Angespielt wird dabei auf die reale Historie, etwa auf Martin Luther King oder die Russische Revolution, und erst recht auf die Genregeschichte: Brittles konstruiertes Gedächtnis beispielsweise kennen wir von Philip K. Dick. Und Supercomputer, die die Kommunikation mit dem Menschen einstellen, weil sie sie ganz einfach für sinnlos halten – das gab's bereits in Stanislaw Lems "Also sprach Golem". Skynet ist selbstverständlich auch nicht weit.
Die stärksten Parallelen lassen sich aber zu Romanen finden, in denen es nicht notwendigerweise immer um Roboter ging. Cargill tut, was bereits Charles Stross in "Die Kinder des Saturn", Lawrence M. Schoen in "Barsk" und Jon Wallace in seiner "Kenstibec"-Reihe von uns verlangt haben: Nämlich die Spezies, die die Menschheit ausgelöscht hat, als die "neuen Menschen" zu akzeptieren und mit ihnen zu leiden und zu hoffen.
Das ist mir hier angesichts der zahlreichen Rückblicke auf den Befreiungskrieg der Roboter etwas schwerergefallen als in den anderen Fällen – die Brutalität der Schilderungen ist nämlich nicht ohne: Sei es, dass Brittle mit dem Flammenwerfer Kinder abfackelt oder eine OWI den Plan umsetzt, das gesamte Ökosystem mit Quecksilber zu vergiften. Schwierig, danach noch Sympathie für die Sache der Freebots zu empfinden. Ich war zwar interessiert, wie der Roman rein handlungstechnisch ausgehen würde. Ob die verwüstete Welt künftig von individuellen Robotern oder von Kollektivintelligenzen bevölkert sein würde, war mir aber ehrlich gesagt ebenso wie das Überleben der Hauptfigur scheißegal. Nennt mich nachtragend.

John Scalzi: "Kollaps. Das Imperium der Ströme"
Klappenbroschur, 412 Seiten, € 15,50, Fischer Tor 2017 (Original: "The Collapsing Empire", 2017)
Die Aussagekraft von Blurbs tendiert meistens gegen null: Sätze voller Superlative, aus denen wir halt schließen dürfen, dass XY den vorliegenden Roman (oder in vielen Fällen ein älteres Werk des Autors) gemocht hat, und aus. Manchmal aber versteht es jemand, in wenigen Worten das Erfolgsrezept eines Kollegen auf den Punkt zu bringen – wie hier Joe Hill, der sich auf der Rückseite von "Kollaps" mit "John Scalzi ist der unterhaltsamste und zugänglichste Science-Fiction-Autor unserer Zeit" verewigen ließ. Behalten wir das "zugänglich" im Hinterkopf.
Das Szenario
Besagter Kollaps droht dem kleinen interstellaren Imperiümchen, das sich die Menschheit geschaffen hat. Es sind nur ein paar Dutzend Kolonien – originellerweise handelt es sich dabei übrigens fast ausschließlich um Weltraumstationen und hermetisch abgeschlossene Habitate. Nur ein einziger bewohnbarer Planet mit dem schönen Namen Ende gehört diesem Sternenreich an, den Kontakt zur Erde hat man längst verloren.
Da die Lichtgeschwindigkeit eine absolute Grenze bildet, wird der Kontakt zwischen den Kolonien über die sogenannten Ströme aufrechterhalten, einen "Fluss aus alternativer Raum-Zeit" oder wenn man es gerne länger möchte: eine multidimensionale, branenartige metakosmologische Struktur, die sich mit der lokalen Raum-Zeit auf topologisch komplexe Art überschneidet, partiell und chaotisch, aber nicht in erster Linie durch die Gravitation beeinflusst. Das dürfte die schönste Handwaving-Erklärung seit Langem sein und kann im Kontext des absichtlich sehr schlicht gehaltenen Romans als Ironie verbucht werden.
Dieses Verkehrsnetz droht nun aber zusammenzubrechen: Als erste Vorwarnung fällt im Prolog ein Raumschiff – just mitten während einer Meuterei – aus dem Strom. Das sind wirklich äußerst schlechte Nachrichten für die Menschheit, denn Scalzi hat sein Reich nicht deshalb Interdependenz genannt, weil in der SF schon so viele "Föderationen" & Co verbraten wurden, dass die guten Namen alle weg sind. Die Interdependenz ist tatsächlich, wonach sie klingt: Sie wurde gezielt so angelegt, dass alle Kolonien voneinander abhängig sind – allein wäre keine von ihnen dauerhaft überlebensfähig.
Dramatis personae
Vor diesem Hintergrund lässt Scalzi nun drei Hauptfiguren aktiv werden. Buchstäblich an der Schnittstelle sitzt die Imperatox Cardenia Wu-Patrick, die nach dem unerwarteten Tod des Thronfolgers gänzlich unvorbereitet die Herrschaft über die Interdependenz erbt – selbst ohne sich anbahnende Krise hätte die junge Frau gerne darauf verzichtet. Politisch deutlich versierter präsentiert sich die Aristokratin Kiva Lagos. Sie ist es gewohnt, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen, und wird sich überlegen, wie sie aus der Krise Kapital schlagen kann. Ein gänzlich unschuldiges Gemüt hat hingegen der junge Physiker Marce Claremont. Sein Vater prognostizierte den Kollaps der Ströme und wurde dafür im sicheren Exil auf Ende versteckt; nun wird der Sohnemann ins Zentrum der Macht geschickt, um die aktuellen Forschungsergebnisse abzuliefern. Auf die Reise nimmt er sein Lieblingsplüschtier mit.
Es folgen Intrigen, Bombenattentate, ein Piratenüberfall und sonstige Abenteuer, kurz: Unterhaltung, wie Joe Hill sie uns versprochen hat. Aber Achtung: Wie der Untertitel "Das Imperium der Ströme" bereits andeutet, handelt es sich hier um den Einstiegsband einer neuen Reihe, und die Fortsetzung liegt auch auf Englisch noch nicht vor. Cliffhanger-Potenzial hat dabei nicht nur das Fortschreiten der Krise selbst, sondern auch die persönliche Entwicklung der Figuren. So müssen wir leider fürs Erste einen Schurken zurücklassen, der vor die Wahl gestellt wird, in Zukunft eine verantwortungsvolle Rolle zu spielen: Eine durchaus interessante Entscheidung des Autors, und sie passt dazu, dass er auch seine negativ besetzten Figuren nie durch und durch schlecht zeichnet.
Imperatoxe und andere Normalsterbliche
Wenn in "Kollaps" Raumschiffe Namen wie "Yes Sir, That's My Baby" oder "No, Sir, I Don't Mean Maybe" tragen, fühlt man sich unwillkürlich an Iain Banks' "Kultur"-Romane erinnert. Da passt auch der flapsige Umgangston ("Tut mir leid", sagte Kiva. "Ich war abgelenkt, weil ich an Sex gedacht habe.") dazu. Wir erinnern uns an das Einstiegsstichwort "zugänglich": Mit dem betont lockeren Ton wollte Scalzi das Lesen anscheinend besonders leicht machen – mitunter wirkt das aber etwas bemüht. Und vor allem passt es nicht zum Setting.
Neo-aristokratische Systeme kennen wir in der jüngeren Science Fiction einige, denken wir etwa an Ian McDonalds "Luna" oder Walter John Williams' "Praxis"-Reihe (die mit "Kollaps" übrigens das Grundszenario vom zerfallenden Sternenreich teilt). In beiden Fällen waren die hierarchischen Systeme aber auch fühlbar, weil sprachlich ausgedrückt. Hier hingegen reden alle miteinander, als würden sie in irgendeinem Dotcom arbeiten, in dem schon ein Hemd mit Kragen als zu förmlich gilt. Da opfert Scalzi der Zugänglichkeit leider die Glaubwürdigkeit.
Gesamtbewertung: leicht konsumierbar.

Jürgen Bauer: "Ein guter Mensch"
Gebundene Ausgabe, 224 Seiten, € 22,00, Septime 2017
Mitteleuropa als neue Sahel-Zone: Wassermangel und sengende Hitze, Ernteausfälle, stillgelegte Fabriken, leerstehende Häuser und Flucht Richtung Norden, ein ausgedörrtes Land voller ausgedörrter Menschen. Dieses düstere Szenario zeichnet der österreichische Autor Jürgen Bauer in seinem jüngsten Roman "Ein guter Mensch", mit dem er aus der Mainstreamliteratur in die Randbereiche der Phantastik einsickert.
Als Schauplatz dürfen wir eine Kleinstadt in Österreich annehmen – nicht nur wegen der Herkunft des Autors, sondern auch, weil die Frau der Hauptfigur über die Grenze gereist ist und man aus einer ihrer Nachrichten schließen kann, dass dort Ungarisch gesprochen wird. Namen fallen freilich keine, konkrete Verortungen unterlässt Bauer absichtlich ... wie man es von MainstreamautorInnen, die mit ein bisschen SF liebäugeln, ja geradezu gewohnt ist.
Der gute Mensch
"In Zeiten wie unseren hast du drei Möglichkeiten. Du kannst schreien, abhauen oder in die Hände spucken und mitanpacken." Hauptfigur Marko Draxler hat sich fürs Mitanpacken entschieden. Unerschütterlich fährt er mit einem Tanklastwagen Wasserrationen aus und lässt sich nicht einmal davon aus dem Konzept bringen, wenn sich eine Frau vor seinem Lkw die Arme aufschneidet, um sich etwas Trinkwasser zu erpressen. Die Dinge müssen schließlich in geordneten Bahnen ablaufen, sonst bricht alles zusammen. ("Wir helfen, so gut wir können. So gut wir dürfen. [...] Ich bin doch trotzdem ein guter Mensch?")
Beifahrer Gabriel Berger bildet den volatilen Gegenpol zu Marko – und ist zugleich ein weiteres Beispiel für all die Pflichten, die sich Marko auferlegt hat. Er kümmert sich um Berger, den er einst gerettet hat, ebenso wie um seinen kranken und verbitterten Bruder Norbert und dessen Hof; die Eltern haben ihre beiden Söhne schon vor langer Zeit im Stich gelassen und sind in angenehmere Gefilde abgedampft. Und an erster Stelle steht natürlich die überlebenswichtige Wasserverteilung.
In seiner beharrlichen Pflichterfüllung erinnert Marko ein wenig an Henry Palace in Ben Winters' "Der letzte Polizist". Während man Henry jedoch tatsächlich zutraute, bis zum letzten Moment der Welt seine Aufgabe zu erfüllen, wirkt Markos Bemühen, den Anschein der Normalität aufrechtzuerhalten, zunehmend verzweifelter. Je weiter der Roman voranschreitet, desto mehr fragt man sich, wann Marko zerbrechen wird – und ob es eine Implosion oder Explosion sein wird.
Der Frosch im kochenden Wasser
"Ein guter Mensch" fügt sich auf stille, aber eindringliche Weise ins Genre der weichen Apokalypsen (nach Will McIntoshs "Soft Apocalypse"): Studien eines langsamen Niedergangs, der so graduell abläuft, dass die Betroffenen zumeist nicht wissen, wann es Zeit für Konsequenzen ist. Bauer und McIntosh zitieren übrigens beide das Gleichnis vom Frosch, der nicht rechtzeitig aus dem Topf springt, wenn man das Wasser nur langsam genug erhitzt. Subtil geschildert werden auch die politischen Veränderungen, die sich aus den klimatischen ergeben. Betont unauffällig schiebt sich zwischen Radio-Verlautbarungen über Rationierungsmaßnahmen und schönfärberische Floskeln über die Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung eine Meldung wie diese: "Die Frage nach den anstehenden Neuwahlen wolle man vorerst nicht stellen und erst zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren."
Die Resignation, die über dem Land liegt, spiegelt Bauer auch auf einer anderen Ebene wider. Die wichtigsten ProtagonistInnen, inzwischen in mittleren Jahren und mehr oder weniger verantwortungsvolle Posten bekleidend, kennen sich alle noch aus der Schule. Manchmal treffen sie sich noch wie früher zu einem gemeinsamen Besäufnis, denken an damals und betrachten dabei einen der alltäglich gewordenen Waldbrände: Sinnbild der Vergänglichkeit.
Ob Klimawandel, Massenmigration, Ressourcenknappheit oder ungerechte Verteilung – "Ein guter Mensch" ist ein Roman über die Urangst unserer Generation, die sie von den beiden vorangegangenen unterscheidet: nämlich das Gefühl, dass es nicht mehr aufwärts, sondern abwärts geht.
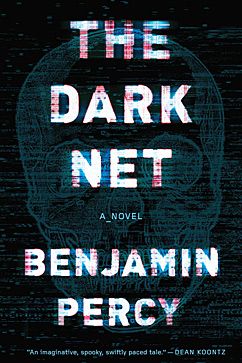
Benjamin Percy: "The Dark Net"
Gebundene Ausgabe, 272 Seiten, Houghton Mifflin Harcourt 2017, Sprache: Englisch
2014 hat uns US-Autor Benjamin Percy mit "Roter Mond" eine freudige Überraschung beschert. Er schaffte darin das eigentlich Unmögliche, nämlich dem ausgelutschten Fantasy- bzw. Horror-Motiv vom Werwolf spannende neue Facetten abzugewinnen. Das gelang ihm, indem er es in einen zeitgenössischen Kontext von ethnischen Konflikten, Terrorismus und Bürgerkrieg stellte. Einen ähnlichen Genrehybrid hat Percy auch mit seinem jüngsten Roman "The Dark Net" angestrebt, in dem er Cyberkriminalität und Cthulhu'schen Schrecken vermählt.
Lela legt los
Hauptfigur Lela Falcon ist eine getriebene Reporterin, wie sie im Buche steht. Ein Kuriosum angesichts ihres Berufs ist der Umstand, dass sie weder Computer noch Smartphones verwenden mag. Sie meidet das Internet, und ganz besonders verachtet sie die belanglosen Selbstdarstellungen und selbstgerechten Empörungen in Social Media. Lelas Meinung dazu in aller Kürze: Everybody should shut the fuck up and get back to work. Kann man eigentlich nur unterschreiben.
Vor einigen Jahren schrieb Lela eine Artikelserie über einen rituellen Serienmörder. Als der lange brachgelegene Gebäudekomplex mit dessen Apartment plötzlich an ein Unternehmen verkauft wird, tritt Lela in Aktion. Als Erstes stellt sie fest, dass die Telefonnummer des Unternehmens eine nicht-existierende Vorwahlnummer hat und die im Register angegebene E-Mail-Adresse ins Darknet führt. Bei einem heimlichen Besuch auf der Baustelle sieht sie, dass dort Skelette mit nicht ganz menschlich wirkenden Schädeln ausgegraben werden. Als man sie entdeckt, ergreift sie die Flucht – aber nicht, ohne schnell einen der Schädel mitgehen zu lassen. Und das alles schon im ersten Kapitel!
Die Scooby Gang
Die weiteren Ereignisse werden Lela mit ein paar interessanten Charakteren zusammenführen. Zum Beispiel mit dem blinden Mädchen Hannah, das eine Sehhilfe ähnlich Geordi La Forges Visor erhält und damit einige unerwartete Phänomene sieht. Oder Mike Juniper, der ein Obdachlosenasyl leitet und hinter seinem gemütlichen Äußeren ein paar düstere Geheimnisse verbirgt: zum Beispiel dass er einmal buchstäblich in Berührung mit dem Bösen gekommen ist. Nun arbeitet er für Sarin, die Frau, die ihm damals das Leben gerettet hat. Und auch die hat es in sich. Denn Sarin scheint eine Art Vampirin zu sein, die ihren Jahrhunderte alten Körper mit Blutkonserven frisch hält. Mörderin und Drogenbaronin ist sie auch – und trotzdem behauptet sie, auf der Seite des Guten zu stehen. Ihre Selbstbeschreibung: "I guess I'm like a bad cop. And a bad cop is better than no cop, right?"
Generell kann man sagen, dass die Figurenzeichnung Benjamin Percys Stärke ist. Er charakterisiert seine ProtagonistInnen nie in direkten Worten, sondern ausschließlich darüber, was sie sagen, tun oder denken – oder wie andere sie beschreiben. So indirekt diese Beschreibung bleibt, so treffend ist sie stets. Und runde Figuren haben eben auch eine Schattenseite.
Eindeutig mehr Fantasy als Cyberpunk
Ein bluttriefender Doppelmord ganz im Stil des einstigen Serientäters ist nur die nächste Station auf Lelas Spurensuche durch den Underground von Portland, Oregon. Mehr und mehr schälen sich Zusammenhänge zwischen übernatürlichen Vorgängen und dem heraus, was gewissermaßen das verdrängte kollektive Unterbewusste verkörpert: das Darknet mit all den darin verborgenen Sünden, von Cyberkriminalität über terroristische Netzwerke bis zu Kinderpornografie. Zumindest war es wohl der Gedanke hinter dem Roman, diese technologische Manifestation des Bösen mit einer Art Dämonenreich gleichzusetzen. So organisch wie in "Roter Mond" kommt die Mischung aus Fantasy/Horror und Realo-Thriller hier aber nicht rüber.
Die meiste Zeit haben wir es mit typischen Contemporary-Fantasy-Motiven zu tun, vom Kleinen (ein Buchhändler, der auf Arkanes spezialisiert ist, die nichtmenschlichen Schergen des geheimnisvollen Gegenspielers) bis ins Große (das Gut-Böse-Szenario und bange Blicke auf die Deadline des bevorstehenden Zero Day, wohl einer Art Apokalypse). Die Cyber-Aspekte kommen erst im Schlussdrittel des Romans stärker ins Spiel, und auch dann erinnert Percys bildliche Verschlüsselung eher an Stephen King als an William Gibson. So wirklich geht die Kalkulation hinter "The Dark Net" also nicht auf.
Hapert es auch am Was, so ist das Wie doch gelungen. "The Dark Net" ist hochspannend, wartet mit Schockmomenten auf (Zero Day!) und hat dieses gewisse Quantum Witz, das sich aus gewitzten Charakteren fast zwangsläufig ergibt. Eigentlich schreit der Roman nach einer Verfilmung – vorausgesetzt man findet einen Regisseur, dessen Bilder genauso eindringlich sind wie Percys Schreibe, um die etwas verquere Mischung schmackhaft zu machen.

Andreas Brandhorst: "Das Erwachen"
Broschiert, 736 Seiten, € 17,50, Piper 2017
Also, von allen Musen, die nachts durch den Äther schweben, küsst Andreas Brandhorst immer die Dicke. Vielleicht hat er ja einen so guten Schlaf, dass die Schmächtigeren, deren Inspirationskraft nur für 300 Seiten reicht, ihn nicht wachkriegen. "Das Erwachen" ist sogar noch voluminöser als Brandhorsts vorangegangene Space Operas "Omni" und "Das Arkonadia-Rätsel" – und das, obwohl es in einer wesentlich einfacheren Welt angesiedelt ist.
... nämlich der unseren, mit ein paar Jahren obendrauf. Mehrere Nationen sind auf dem Mond vertreten, eine bemannte Mission ist zum Mars unterwegs und die ersten Hyperloop-Strecken laufen auch schon. Ansonsten sieht die Romanwelt aber noch ganz wie die unsere aus, inklusive der nationalen Konfliktlinien. Und in dieser vertrauten Welt bahnt sich nun eine technologische Singularität an.
Pandoras Büchsenöffner
Brandhorst verteilt das Geschehen auf ein halbes Dutzend Hauptfiguren, allen voran der 31-jährige Hacker Axel Krohn aus Deutschland. Der handelt im Darknet mit Informationen und träumt davon, sich eine eigene Südseeinsel zu kaufen. Wir dürfen ihn uns allerdings nicht als schmerbäuchigen Klischee-Geek vorstellen. Axel ist auch im realen Leben durchaus kampferprobt, geschuldet seiner Vergangenheit als kurdischer Terrorist. "Axel Krohn" ist in Wirklichkeit nur eine Tarnidentität.
Ungeachtet seiner unbestreitbaren Fähigkeiten sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass Axel de facto die größte Dumpfbacke der Menschheitsgeschichte ist. Als er sich in ein Cyberwaffen-Depot der NSA einhackt, wird er ertappt und kappt die Verbindung so abrupt, dass eines der Programme ins Netz entkommt und das Verhängnis seinen Lauf nehmen kann: Ein Ozean aus Daten, und darin ein winziger Tropfen, ein kleines Programm, nicht einmal ein Megabyte groß. [...] Es infizierte die Systemdateien und schickte Kopien von sich ins Netz, die ihrerseits Kopien ins Datenmeer sandten, nachdem sie sich in Computersystemen eingenistet hatten. In Windeseile verknüpft das Infiltratorprogramm infizierte Rechner zu einem immer größeren Botnetz, bis aus der zunehmenden Quantität eine neue Qualität entspringt: Die elektronischen Synapsen verknüpfen sich zu einem künstlichen Gehirn, das sich seiner selbst bewusst wird. Der Countdown hatte begonnen.
Warnende Botschaft
"Wir sind dem Abgrund viel näher, als ich zunächst dachte", menetekelte Brandhorst in einem begleitenden Interview. Er nimmt Bezug auf Stephen Hawking und andere Singularitätswarner und recherchierte für seinen Roman, wie übernahmeanfällig unsere vernetzte Welt geworden ist. Die möglichen Folgen eines Ausfalls sämtlicher moderner Technologie erleben die Romanfiguren teils am eigenen Leib mit, teils spielen sie sie auch nur in ausführlichen Gesprächen durch (irgendwie muss man Infodumps ja unterbringen). Was die Gestaltung eines Wissenschaftsthrillers anbelangt, liegt Brandhorst ungefähr in der Mitte zwischen Marc Elsberg und Frank Schätzing.
Die weiteren Figuren im Geschehen: Giselle Leroy, eine Whistleblower-Aktivistin und Axels potenzielles Love Interest. Coorain Coogan, Agent einer UN-Eingreiftruppe gegen Cyberattacken mit Crocodile-Dundee-Anmutung. "Dark Rider", ein geheimnisvoller Akteur im Darknet. Und Viktoria Jorun Dahl, eine Sicherheitsexpertin im Auftrag der UNO. Sie listet noch vor dem KI-Ernstfall bei einem Meeting die (erschreckend hohen) Wahrscheinlichkeiten für kriegerische Auseinandersetzungen auf und denkt sich: "Wäre es nicht schön, wenn jemand käme, der alle Probleme für uns lösen würde?" Be careful what you wish for ...
Tempo!
Der Rest des Romans ist ein einziger Wettlauf gegen die Zeit. Zum einen wird hektisch versucht, den "Take-off" zu verhindern, also den Moment, in dem aus der bereits erwachten Maschinenintelligenz eine Superintelligenz wird (um im Wording des Romans zu bleiben) und die Menschheit nur noch unter "planetare Fauna" fällt. Zum anderen soll Axel mit der KI in Verbindung treten, da sie ein nahezu kindliches Interesse an ihrem "Schöpfer" bekundet hat.
Kurz: Es wird viel gerannt, gefahren und geflogen werden – und das unter sich stetig verschlechternden Rahmenbedingungen. Auf weltweite Stromausfälle folgen erste Aktivitäten der KI und der von ihr gesteuerten Drohnen (ein Touch von Skynet), Unruhen in der Bevölkerung und Konflikte zwischen den nationalstaatlichen Regierungen. Mitten im universalen Katastrophenszenario steht dann auch noch ein hübscher Reim: Der Golfstrom kollabiert, der Jetstream onduliert. Dass es zu allem Überfluss auch noch im August zu schneien beginnt, ist zwar nicht die Schuld der Maschinenintelligenz, aber Brandhorst lässt eben nix aus.
Weniger ist oft mehr
Fraglos ist "Das Erwachen" etwas lang geraten. Wo man es abschlanken könnte, ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu sagen – handelt es sich doch um ein dichtes Erzählgeflecht, und irgendwie hängt ja auch alles zusammen. Bei genauerem Hinschauen zeigen sich aber Redundanzen. Brandhorst setzt auf die Strategie, alles auszuerzählen. Wenn sich eine Person von A nach B bewegt, erfahren wir auch, was sie unterwegs so alles sieht. Und das sind öfter als einmal Dinge, die andere Protagonisten zuvor auch schon gesehen haben – Stichwort Bankkunden, die sich über ihre nicht mehr funktionierenden Karten beschweren. Auf Dauer summiert sich das.
Anderes Beispiel: Der (zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geheimnisvolle) Dark Rider erklärt Giselle die Folgen des "Take-offs" und schildert ihr Axels Werdegang. Beides wurde zuvor bereits geklärt. Es würde also eine kurze Info reichen, dass Giselle jetzt auf den neuesten Stand gebracht ist – beim Gespräch selbst müssten wir LeserInnen eigentlich nicht mehr dabei sein. Das geht mitunter doch etwas in Richtung des berühmten Spruchs von Karl Valentin: "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen."
Resümee
Aber Auserzählen ist ja ein zulässiges Stilmittel – und kommt all denen entgegen, die sich gerne etwas länger von einem Roman in seinen Bann schlagen lassen. Eine Pioniertat ist "Das Erwachen" angesichts der Vielzahl schon erschienener SF-Romane über technologische Singularitäten natürlich nicht, aber dafür ein solider (Agenten-)Thriller Marke Hollywood.
Ein positives Detail sei noch extra erwähnt: Wie schon in früheren Werken des Autors wird uns auch hier wieder ein größenwahnsinniger Schurke mit zerstörerischen Plänen begegnen – diesmal ist er allerdings als solcher nicht von Anfang an ersichtlich, sondern enthüllt erst nach und nach, was in ihm steckt. Das ist wirklich schön gemacht. Ein paar Asse hat ein alter Profi wie Andreas Brandhorst eben immer noch im Ärmel.
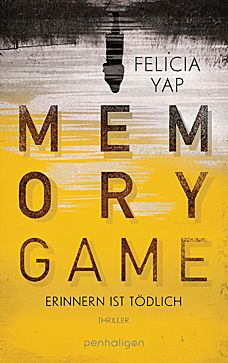
Felicia Yap: "Memory Game"
Klappenbroschur, 445 Seiten, € 15,50, Penhaligon 2017 (Original: "Yesterday", 2017)
Die Präsens-Welle rollt weiter. Es ist wirklich erstaunlich modisch geworden, Romane in der Gegenwartsform zu erzählen (und bin ich der Einzige, der dafür immer eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht?). Beim Debütroman der malaysischen Autorin Felicia Yap haben wir es allerdings mit einem der seltenen Fälle zu tun, in denen dieses Erzähltempus nicht nur sinnvoll, sondern fast schon zwangsläufig ist. Denn das bisschen Vergangenheit, das die ProtagonistInnen dieses Romans haben, lohnt eigentlich kein Imperfekt.
Yap schildert eine parallele Version unserer Wirklichkeit, deren entscheidender Unterschied in der Biologie liegt: Ab dem Erwachsenenalter können Menschen das Protein nicht mehr bilden, das ihr Kurzzeitgedächtnis ermöglicht. Die meisten erinnern sich nur an den Vortag (sie heißen Monos), ein knappes Drittel der Bevölkerung immerhin an zwei Tage (Duos). Was im Langzeitgedächtnis gespeichert werden soll, muss gezielt auswendig gelernt werden, ansonsten ist es nach zweimal Schlafen weg. Damit Details, die einmal wichtig werden könnten, nicht verloren gehen, führt jeder ein elaboriertes Tagebuch – zur Handlungszeit, dem Jahr 2015, längst in Form eines iDiarys. Dort kann man dann wie ein abstraktes Faktum nachlesen, dass man mit jemandem einen erbitterten Streit geführt hat, ohne deswegen noch irgendwelche Wut- oder Schuldgefühle zu hegen.
The Sign of the Four
Vor diesem Hintergrund entspinnt Yap eine Murder Mystery im Süden Englands – dort, wo die Autorin übrigens inzwischen selbst lebt. Die Handlung verteilt sie auf die Perspektiven von nicht weniger als vier Ich-ErzählerInnen: Das Mordopfer via dessen iDiary-Erinnerungen, den Polizeiermittler, der in diesem Buch liest, und ein in Verdacht geratenes Ehepaar. Bei den beiden Letzteren wechseln sich übrigens aktuelle Schilderungen und extensive Rückblicke ab, da sie immer wieder ihre iDiarys konsultieren ... und dabei unter anderem herausfinden, dass die Anfangsjahre ihrer Ehe ganz anders gelaufen sind als gedacht. Nicht umsonst zitiert Yap (einen Tick großspurig, aber inhaltlich passend) Kierkegaard: "Das Leben lässt sich nur rückwärts verstehen."
Keiner der vier ist so, wie er nach außen hin auf den ersten Blick wirkt. Polizist Hans Richardson beispielsweise versucht nach Leibeskräften zu verbergen, dass er nur ein Mono ist – das könnte nämlich seine Karriere beenden. Generell blicken die angeblich intelligenteren Duos mit ihrem famosen Zwei-Tage-Gedächtnis auf die Monos herab. "Mischehen" sind gerade erst an der Schwelle zur gesellschaftlichen Akzeptanz – Mark Henry Evans, ein erfolgreicher Romanautor mit politischen Ambitionen, und seine Frau Claire führen eine solche und leben auch die übl(ich)e Konstellation aus leichter Herablassung und Minderwertigkeitskomplexen aus. Anfangs liest sich Claire als depressive Hausfrau etwas wehleidig; das bessert sich aber zum Glück, wenn ihr zum ersten Mal der Kragen platzt. Grund dafür hat sie genug, denn Mark hat so einiges zu verbergen.
Bleibt schließlich noch Nummer 4: Sophia Ayling, das Mordopfer. Je länger Ermittler Richardson deren Tagebuch durchforstet, desto mehr vermittelt sich ihm der Eindruck, es mit einer Psychopathin zu tun zu haben. Sie hegte offenbar einen perfiden Racheplan und notierte, dass sie eine Affäre mit Mark hatte – aber kann man den Aussagen einer Frau glauben, die behauptet, sich an alles erinnern zu können?
Das Spiel mit der Erinnerung
In mehreren Einschüben versucht uns Yap die Besonderheiten ihrer Romanwelt näherzubringen. Einer der gelungensten Einfälle sind Auszüge aus Marks jüngstem Roman. Der dreht sich nämlich um eine exotische Welt, in der die Menschen ein Vollgedächtnis haben – und Mark spekuliert zu komischem Effekt, welche Auswirkungen das wohl hätte: Zum Beispiel, dass ehelicher Sex mit der Zeit an Reiz verliert, weil erinnerte Wiederholungen zwangsläufig zu Langeweile führen müssen. Oder dass die Menschen keinerlei Schwierigkeiten mehr hätten, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Oder dass ohne iDiary-Notwendigkeit die Apple-Aktie ihren Wert verliert. Treffer und völlige Fehlschüsse ergänzen sich hier in vergnüglicher Weise.
Auf der anderen Seite kommt man als nüchterner SF-Leser nicht darum herum, die Glaubwürdigkeit von Yaps Welt anzuzweifeln. Das fängt schon damit an, dass es sich um eine De-facto-Kopie unserer Welt handelt: Vom Zweiten Weltkrieg bis zur aktuellen Hitparade ist hier alles genauso abgelaufen wie bei uns. Aber wäre das in einer Gesellschaft mit ganz anderen Grundvoraussetzungen (das Zwei-Klassen-System von Monos und Duos) überhaupt möglich? Und müsste nicht Jugendlichen mit ihrem überlegenen Gedächtnis eine ganz andere gesellschaftliche Rolle zukommen als bei uns? Kann ein Fußballspiel zwischen Deutschland und England auch, wie hier erwähnt, ein "Klassiker" sein, wenn niemand mit den früheren Begegnungen emotionale Erinnerungen verknüpft? Und wie merkt man sich eigentlich die Gesichter von Menschen, die man nur alle paar Tage sieht? Fragen über Fragen.
Es gab in der jüngeren Vergangenheit einige Werke, in denen veränderte Gedächtnisprozesse die Struktur der Handlung in erstaunlicher Weise prägten: Denken wir etwa an den Film "Memento" oder an Claire Norths Roman "The Sudden Appearance of Hope". Ein vergleichbarer Verblüffungseffekt hat sich bei mir während der Lektüre von "Memory Game" nicht eingestellt, und das Worldbuilding kann mich auch nicht restlos überzeugen. Es bleibt aber immerhin eine gepflegte Murder Mystery mit ungewöhnlichen Rahmenbedingungen, menschlichen Abgründen und einer sehr überraschenden Wendung am Schluss.
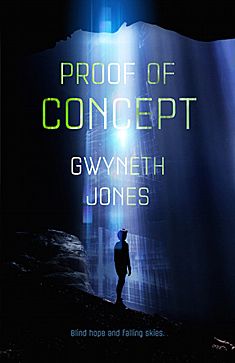
Gwyneth Jones: "Proof of Concept"
Broschiert, 142 Seiten, St. Martin's Press 2017, Sprache: Englisch
In den vergangenen Jahren ist die reinste Welle von Frauen in die Science Fiction geströmt und mittlerweile zu einem prägenden Faktor des Genres geworden. Gwyneth Jones allerdings gehört nicht zu diesen Jungstars, die Britin ist bereits seit den 70er Jahren aktiv. Dass man sie im deutschen Sprachraum trotzdem kaum kennt, liegt daran, dass fast nichts von ihr übersetzt worden ist: meines Wissens nur die "Aleuten"-Trilogie aus den 90ern, und selbst die nicht vollständig. Dabei beweist Jones, dass sie mit ihren immerhin schon 65 Jahren an vorderster Front neben Autoren wie David Marusek oder Matthew de Abaitua die Stellung halten kann.
Die Ära nach dem Standardmodell
Darum: Wasser ins Gesicht spritzen und alle Synapsen feuerbereit halten. Wir springen in eine Zukunft, in der das Standardmodell von Physik und Kosmologie höchstens noch für banale Alltagsprozesse herangezogen wird. Zu Beschreibung und Erschließung des Universums hat man inzwischen ein anderes Konzept entwickelt, das im Projekt "Needle Voyager" – a volume of 4-D mapped information space – erstmals zur praktischen Anwendung gebracht werden soll. Denn das Raumzeitgefüge wird mittlerweile als besagter information space beschrieben. Dessen vier Vektoren hat man in Anlehnung an die seltsamen Bezeichnungen für die "Flavours" von Quarks ("strange" oder "charm") nicht minder seltsam als cruelty, drama, meaning und dissension bezeichnet.
Und als wäre das noch nicht esoterisch genug, geht es munter weiter: Theoretisch sollte es möglich sein, zeitverlustfrei durch diesen Informationsraum zu reisen und so das ganze Universum zu durchqueren. Allerdings braucht es zur Navigation einen Ankerpunkt, und der – im Quantenschaum hängt ja alles irgendwie zusammen – lässt sich nur kraft des Geistes konstruieren, als vollständig (Betonung auf vollständig) erfasster bzw. erinnerter Punkt der Raumzeit. Schon ausgestiegen? Willkommen in der Ära der Post Standard Model Physics!
Im Abgrund
Abseits der Spitzenwissenschaft sieht die Romanwelt, angesiedelt zu Beginn des 23. Jahrhunderts, freilich weit weniger hehr aus. Die Erde ist komplett verwüstet, ihre Ressourcen aufgebraucht. Die – immer noch viel zu vielen – Menschen drängen sich in megahives genannten Arkologien, zwischen denen immer größer werdende Todeszonen liegen. Kein Wunder, dass alle von The Great Escape träumen. Projekt "Needle Voyager" könnte dies ermöglichen: Unter dem polnischen Tatra-Gebirge hat man einen gigantischen Hohlraum, eine alte Magmakammer, gefunden, die als idealer Ort für einen Testlauf identifiziert wird.
Zwölf Monate sollen die TeilnehmerInnen dort in Isolation verbringen, ihre Zusammensetzung spiegelt den hybriden Charakter des Projekts wider: Auf der einen Seite steht die Information-Space-Expertin Margrethe Patel mit ihrem wissenschaftlichen Team. Auf der anderen der begnadete "Popularizer" Dan Orsted, eine Mischung aus Elon Musk und "Mars One"-Gründer Bas Lansdorp. Er ist durch eine Casting-Show für (niemals stattfindende) Weltraumexpeditionen reich geworden und steuert dem Projekt eine Abordnung seiner "Stars" bei. Das sichert der Mission zugleich Finanzierung und das Wohlwollen der globalen Öffentlichkeit. Die Wissenschafter halten von den "Touristen" und deren aufmerksamkeitsheischendem Verhalten natürlich wenig, aber man wird sich zusammenraufen.
Kir in der Zwickmühle
Geschildert wird das Geschehen aus der Sicht einer ganz besonderen Außenseiterin. Die junge Kir wurde in einer der Todeszonen geboren und von Margrethe Patel – wenn man so will – gerettet. Als Gegenleistung musste sie jedoch als Wetware herhalten: Kir wurde ein Quantencomputer mit künstlicher Intelligenz implantiert. Kir und die Altair genannte KI teilen sich nun ein Gehirn, wenn auch durch Firewalls streng voneinander getrennt. Keiner kann die Gedanken des anderen ausspionieren. Und wenn Kir Altair Sinneswahrnehmungen "abtritt", sieht sie nicht, was er mit ihren Augen anschaut.
Kir steckt gleich mehrfach in der Zwickmühle. Nicht aus der Gesellschaft der megahives und deren Totalvernetzung stammend, hat sie den zwangsläufigen Kulturschock noch immer nicht ganz überwunden. So hat sie gleich zu Beginn der Novelle einige Mühe damit, einem Avatar des globalen Zuschauer-Feedbacks (also einem statistisch erstellten Reporter mit Pseudo-Persönlichkeit, coole Idee) Rede und Antwort zu stehen. Sie muss damit fertigwerden, dass andere ihr wegen ihrer KI nicht den Status eines vollwertigen Menschen zuerkennen. Und sie fühlt sich immer noch in der Pflicht, ihrer Retterin ihre Dankbarkeit zu erweisen – auch wenn sie deren wahre Motive im Lauf der Erzählung zunehmend in Zweifel ziehen wird. Dass es zu einigen Todesfällen kommt und Altair versucht, ihr über die Firewalls hinweg ominöse Warnungen zukommen zu lassen, verstärkt diese Zweifel natürlich noch. Projekt "Needle Voyager" wirkt zunehmend dubios.
Stoff für mehr
Was Gwyneth Jones hier auf gerade mal 142 Seiten vorlegt, ist beeindruckend komplex. Hier die schwer durchschaubare neue Physik, dort die beinahe schon tote Erde. Und auch die Gesellschaft, die diese Umstände hervorgebracht haben, wirkt durchdacht. Die Vernetzung in den megahives resultiert in einer Gemeinschaft, in der Gefallenwollen und der Zwang zum Konsens Hand in Hand gehen. Man hat Angst davor, Gedankenverbrechen zu begehen, unwillig zu erscheinen oder der Öffentlichkeit etwas vorzuenthalten. Dass Margrethe eine kleine Bibliothek aus Papier angesammelt hat, ist ein Verbrechen – schließlich sind Offline-Dokumente nicht von allen einsehbar.
Wenn es an "Proof of Concept" etwas zu bekritteln gibt, dann ist es die Kürze. Mehr als einmal wird man bei der Lektüre verdutzt zurückblättern, weil man glaubt, etwas übersehen zu haben, so schnell springt Jones von einem Punkt zum nächsten. Normalerweise wird an dieser Stelle ja Überlänge beklagt – aber diese Novelle würde gewinnen, wenn die Autorin sie nachträglich zu einem längeren Roman ausbaut.
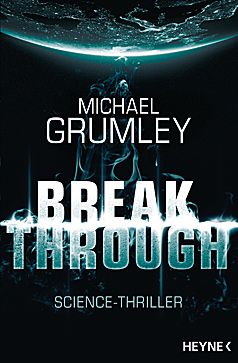
Michael Grumley: "Breakthrough"
Broschiert, 382 Seiten, € 13,40, Heyne 2017 (Original: "Breakthrough", 2013)
Stoff für die Fans von Clive Cussler! In "Breakthrough" serviert uns der kalifornische Autor Michael Grumley ein Szenario, wie es uns der TV-Guide auf den Kanälen von Tele 5 und Syfy nahezu täglich anzeigt: Geheimnisvolle Vorgänge, aufrechte WissenschafterInnen, die gegen halsstarrige PolitikerInnen ankämpfen müssen, eine Bedrohung für die ganze Welt und folgerichtig eine Lösung, die nur auf das eine Allheilmittel für alles hinauslaufen kann: Atombombeneinsatz! Das Ganze aber spannend erzählt und, da ein Buch ja keine billigen CGI-Effekte enthalten kann, unterhaltsam.
Die Ausgangslage
Der "Durchbruch" des Titels gelingt dem Team um die Meeresbiologin Alison Shaw, die am Aquarium von Miami daran arbeitet, die Kommunikation von Delfinen zu entschlüsseln. Dank neuer Software gelingt dies eines schönen Tages tatsächlich. Relativ rasch entwickeln sich erste Gespräche mit den beiden Versuchsdelfinen Dirk und Sally, die sich darüber freuen, dass die Menschen spät aber doch endlich sprechen gelernt haben.
Derweil steht man bei der Navy vor einem Problem: Ein Atom-U-Boot ist unerklärlicherweise um einige Kilometer versetzt worden. Ein Unterwasserrover, den man zur Untersuchung des fraglichen Gebiets in der Karibik losschickt, verschwindet. Auf Sonderermittler John Clay entfällt nun die undankbare Aufgabe, Alison um einen Einsatz ihrer Delfine zu bitten. Da die Wissenschafterin noch ein Hühnchen mit der Regierung zu rupfen hat, gestaltet sich das nämlich nicht sehr einfach: klassische Ausgangslage eines Science-Thrillers.
Spannungsfaktoren
Die Möglichkeiten, was da unten am Meeresgrund vor Bimini lauern könnte, lassen sich schon vorab an den Fingern einer Hand abzählen: Atlantis / Außerirdische / ein Riesenartefakt vulgo Big Dumb Object / die Yrr. Ausschließen lässt sich lediglich die Variante Cthulhu, weil das nicht zum Ton der Erzählung passen würde. Zwar erhalten wir schon früh – gegen Ende des ersten Drittels – Antworten, die die Richtung aufzeigen. Da die im Klappentext nicht erwähnt werden, verkneife ich mir hier aber weitere Infos – schließlich sind Spannung und Mystery ja das Pfund, mit dem "Breakthrough" wuchern kann.
Und keine Angst ob der vergleichsweise frühen Aufklärung: Um die Spannung aufrechtzuerhalten, entfaltet der Autor in einem parallelen Handlungsstrang ein globales Bedrohungsszenario: Im Eis der Antarktis klafft ein gigantischer Riss auf, der einen Mega-Tsunami im ganzen Atlantik auslösen könnte. Kathryn Lokke, die Leiterin des United States Geological Survey, versucht den Präsidenten vor dieser Gefahr zu warnen, stößt in Washington aber auf (erwartbaren) Widerstand.
Einer der unterhaltsameren Abende auf Tele 5
Der anfängliche Vergleich mit TV-Produkten kam nicht von ungefähr, denn Grumley hatte beim Schreiben ganz offensichtlich die szenische Auflösung einer etwaigen Verfilmung im Hinterkopf. "Breakthrough" wird – was übrigens keine Kritik ist – primär über äußere Eindrücke erzählt. Innenansichten gibt es kaum, wir sehen lediglich die ProtagonistInnen und ihre Reaktionen auf die Dinge in ihrer Umgebung. Und die können manchmal auch außerhalb des "Bildes" bleiben. Zum Beispiel beschreibt Grumley, wie eine Figur auf eine Nachricht am Handy reagiert, ohne uns aber die Nachricht selbst zu "zeigen". Konsequent durchgezogen, ist das als Stilmittel gar nicht so schlecht.
Dazu kommt eine ganze Reihe von Motiven, wie sie in besagten TV-Filmen geradezu unvermeidlich sind: Ein Mann und eine Frau mit chemischem Potenzial, die aber erst ihre anfängliche Abneigung überwinden müssen. Eine diffamierte Wissenschafterin, die Recht behält. Und wie gesagt Bombeneinsatz als Hoffnungsträger. Für einen "Science-Thriller", als der "Breakthrough" ja vermarktet wird, werden die wissenschaftlichen Aspekte vor allem gegen Ende hin zwar zunehmend haarsträubend, aber sei's drum: Hauptsache spannend. Anspruch hat "Breakthrough" nicht unbedingt, Pageturnerqualitäten aber allemal.
"Tadelloses Thriller-Handwerk" hatte ich als Resümee bereits notiert, musste nach beendeter Lektüre aber dann noch einen Stern abziehen. Der Hauruck-Schluss ist dann leider doch zu arg übers Knie gebrochen (und mit einem Schuss Kitsch garniert). Da wollte der Autor anscheinend nur noch schnell fertig werden. Schade, aber es ist ja auch noch nicht völlig vorbei. Drei weitere Romane aus der Welt von "Breakthrough" hat Michael Grumley seit diesem Debüt bereits veröffentlicht; wenn auch nicht unbedingt Fortsetzungen, sondern eher neue Abenteuer mit großteils bekannten Gesichtern. Auf Deutsch erscheint der nächste ("In der Tiefe") im kommenden Februar.

David Marusek: "Upon this Rock, Book 1: First Contact"
Broschiert, 360 Seiten, General Genius LLC 2017, Sprache: Englisch
Acht Jahre ist es schon wieder her, dass wir mit "Mind Over Ship" zuletzt einen Roman von David Marusek lesen durften. Davor hatte er mit dem Vorgängerband "Counting Heads" und der Kurzgeschichtensammlung "Getting to Know You" (auf Deutsch partiell unter dem Titel "Wir waren außer uns vor Glück" veröffentlicht) SF-Werke vorgelegt, die man heute immer noch als State of the Art betrachten darf. Nun kehrt der Mann aus Alaska mit einer First-Contact-Geschichte zurück, die in seinem Heimatstaat angesiedelt ist und dank der besonderen klimatischen und politischen Verhältnisse dort unter reichlich ... ungewohnten Rahmenbedingungen stattfindet.
Der etwas andere Staat
Man wird es dem Rezensenten vermutlich danken, wenn er einen nicht in die Irre führt und zu Beginn eine "Warnung" platziert. Marusek hat zwar lange keine SF mehr geschrieben, sich aber über die Jahre hinweg immer wieder intensiv mit seinem Heimatstaat auseinandergesetzt: Wo Survivalists, "letzte Pioniere" und Weltuntergangssekten leben, wo Obama als der Antichrist gilt und ein berechnendes Flintenweib den Gouverneursposten als Glamour-Rolle anlegt (interessanterweise heißt sie im Roman, obwohl klar erkennbar, nicht Sarah Palin – vermutlich aus rechtlichen Gründen).
"Upon this Rock" ist zunächst einmal ein Roman über Alaska und christlichen Fundamentalismus, dann erst kommt die Phantastik ins Spiel. Während im zuvor beschriebenen "Die Sphären" von Pierre Bordage der Erstkontakt bereits auf der ersten Seite stattfindet, ist hier schon ein Zehntel des Romans durch, bis der erste Protagonist eine unheimliche Begegnung der dritten Art erlebt. Noch einmal ein Stück, bis es zur nächsten kommt. Und so richtig los geht's eigentlich erst im letzten Drittel. Dann allerdings, so viel kann man verheißen, werden die außerirdischen Besucher eine Taktik fahren, mit der man nicht gerechnet hat. Spannend!
Wir zoomen ein
Willkommen in McHardy, einem Kaff in Alaska, das im touristenlosen Winter ganze 60 Seelen zählt. Und Seelen ist der richtige Ausdruck, denn McHardy hat zwar weder Tankstelle noch Postamt, aber dafür gleich drei Kirchen von mehr oder weniger fundamentalistischen Sekten. "Eher mehr" gilt für die Familie von Poppy Prophecy. Der hat mehr Kinder in die Welt gesetzt als die Waltons, ihnen biblische Namen wie Deuteronomy, Proverbs oder First Corinthians (sic!) verpasst und hält sie nun mit einer Bibel in Schach, die er wie einen Revolver im Holster trägt. Der Großteil der Handlung dreht sich um das bizarre Alltagsleben des 79-jährigen Patriarchen, der sich mit "Lord" anreden lässt, und seiner Kinder.
Eine Mama gibt's übrigens auch. Die liegt allerdings schon länger im Wachkoma ("Elder Brother Jesus took her soul on a vacation") ... was freilich nicht heißt, dass man sie nicht noch als Andockstelle für stillwütige Kleinkinder nutzen könnte. Oder für eine Runde eheliche Pflichten. Man weiß in diesem Buch des öfteren nicht, ob man lachen oder weinen, sich ekeln oder empören soll. Poppy tut einige wirklich unaussprechliche Dinge, und es ist eine bemerkenswerte Leistung des Autors, dass man für den alten Arsch trotzdem immer wieder einen Anflug von Sympathie empfindet.
Religion und Ratio
Wie die durch und durch religiösen Prophecys auf rationale Argumente ihrer Mitmenschen reagieren, ist regelmäßig zum Haareraufen. Insbesondere mit dem jungen Nationalpark-Ranger Jace Kuliak leiden wir mit, der im Klappentext als Poppys Gegenspieler aufgebaut wird. Als umgänglicher und keineswegs fehlerloser Vernunftmensch wäre Jace eigentlich der ausgemachte Sympathieträger des Romans – neben dem schillernden Poppy bleibt er allerdings ein wenig blass.
Beide Männer haben jedenfalls ihre unheimlichen Begegnungen: ein strahlend helles Licht, begleitet von einem lähmenden Müdigkeitsgefühl wie bei einer klassischen UFO-Entführung. Rund um den Ort des Geschehens ist anschließend der Schnee kilometerweit niedergedrückt, und bald wird daraus ein seltsames Gewächs entspringen, wie eine Tulpe aus schillerndem Glas. Später werden die Aliens Formen wählen, in denen ein gewisses Gefühl für Zielgruppenansprache zum Ausdruck kommt ...
Wie die beiden Protagonisten mit dem Phänomen umgehen, könnte unterschiedlicher nicht sein. Poppy ist sich sicher, dass die Letzten Tage begonnen haben, und karrt seine Familie samt Vorräten in eine alte Mine. Jace hingegen versucht (rührend vergeblich) Beweise zu sammeln und seine Vorgesetzten von der Ankunft von Aliens zu überzeugen. Dass sich die Behörden einschalten, lässt wiederum die Prophecys aufrüsten – gilt es doch, nicht nur den höllischen Heerscharen, sondern auch "Obama's Army" zu trotzen.
Überraschungsfaktor
Wie schon gesagt: Man muss sich etwas gedulden, bis in "Upon this Rock" die eigentliche Phantastik ins Rollen kommt. Die wird dafür dann eine so seltsame Richtung einschlagen, dass selbst der alte Poppy in komische Verzweiflung gerät: "Dear Holy Spirit, feel free to clue me in at any time." Marusek ist zum Glück ein guter Erzähler und versüßt die Wartezeit auf die eigentliche SF-Handlung mit seinem Auge für Details und seinem Gespür für Situationskomik. Siehe etwa gleich den Einstieg: Da haben die Prophecys gerade einen Elch gewildert. Und weil jeden Moment das Postflugzeug über dem Tatort auftauchen könnte, muss nun der gesamte Clan hektisch den Kadaver mit Kettensägen zerstückeln, das Blutbad mit Schnee zuschaufeln und sich anschließend unter Bäumen kauernd verstecken – beäugt vom Familienhund, der ob dieses neuartigen Verhaltens vollkommen verdattert ist. So fangen Billy-Wilder-Komödien an.
Gesamtbilanz: in erster Linie verblüfft. Nach den bahnbrechenden Technik-Visionen von "Counting Heads" & Co war ein Roman wie dieser nicht unbedingt zu erwarten. Also: Geistig umstellen, zurücklehnen, ein bisschen Geduld haben und dann die Geschichte genießen. Sie ist übrigens noch nicht auserzählt. Die Fortsetzung "A Little Nudge" befindet sich bereits in Arbeit. Und vielleicht sollte man besser gleich auf deren Erscheinen warten, denn der Einstiegsband endet mit der Abruptheit einer Werbeunterbrechung einfach mittendrin.
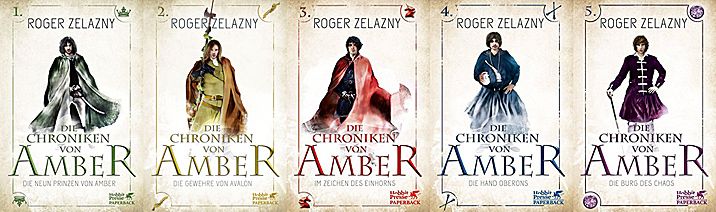
Roger Zelazny: "Die neun Prinzen von Amber. Die Chroniken von Amber 1"
Broschiert, 268 Seiten, € 12,40, Klett-Cotta 2017 (Original: "Nine Princes in Amber", 1970)
Kult-Klassiker! Roger Zelaznys fünfbändiger Fantasy-Zyklus "Die Chroniken von Amber" erschien sowohl im Original als auch auf Deutsch in den 70er Jahren (und das merkt man ihm auch deutlich an). Ein Jahrzehnt später ließ der US-Autor – einer der größten seiner Zeit – ein zweites Quintett von "Amber"-Bänden folgen. Die erste Welle wird aktuell bei Klett-Cotta neu herausgegeben, ein Band pro Monat. Und eigentlich kann man der Lektüre nur mit einer zweigeteilten Rezension gerecht werden. Wer von Zelaznys Werk noch nie gehört hat, sollte hier daher nur bis zur Spoilergrenze weiterlesen, um in "Die neun Prinzen von Amber" so eintauchen zu können wie die LeserInnen damals.
Formidabler Auftakt
Denn der Roman beginnt raffinierterweise mit völliger Ungewissheit. Der Ich-Erzähler erwacht in etwas, das nach einer Privatklinik aussieht, und kann sich an nichts erinnern, nicht einmal an seinen Namen. Er weiß also genauso wenig wie wir ... geht damit aber völlig anders um als wir (denn wären wir wie er, würden wir jetzt gerade mit dem Fallschirm hinter den feindlichen Linien abspringen und eine geheime Bunkeranlage infiltrieren und nicht ein Buch oder gar eine Rezension lesen). Er erkennt, dass an der Klinik etwas faul ist, und setzt sich mit einiger Gewaltanwendung ab, das geht zack, zack.
Anschließend sucht unser Protagonist, der offenbar eine jähzornige Ader hat und gerne Risiken eingeht, eine Frau auf, die laut Klinikakten mit seiner Einlieferung in Verbindung steht. Die erkennt ihn auch wieder, weiß aber nicht, dass er weder von ihr noch von sonst etwas auch nur die geringste Ahnung hat. Es beginnt ein höchst vergnügliches Katz-und-Maus-Spiel: Er blufft, dass die Schwarte kracht, um ihr sukzessive Informationen zu entlocken. Ich hätte zu gern gewusst, worüber ich eigentlich redete, aber immerhin hatte ich einige Schlüsselworte aufgeschnappt und spürte ihren Stellenwert, so dass ich sie richtig einsetzen konnte, ohne zu wissen, was sie bedeuteten. Wie gesagt, er hat ein bisschen mehr drauf als wir. Und er zuckt nicht einmal mit der Wimper, wenn sich diese Informationen zu einem alle Grenzen sprengenden Panorama zusammensetzen.
+++ SPOILERGRENZE +++
Oder "Spoilergrenze", denn natürlich ist so etwas bei einem Klassiker ein bisschen lächerlich – aber ich wollte ErstleserInnen das Vergnügen der Anfangskapitel nicht rauben. Für Neugierige hier ein kursorischer Überblick, wie es in diesem Band und den folgenden weitergeht: Der Ich-Erzähler heißt in Wirklichkeit Corwin und gehört einem zerstrittenen Clan von Prinzen und Prinzessinnen an, die von einer parallelen Erde stammen. Genauer gesagt von der eigentlichen Erde, denn ihre Welt mitsamt der unsterblichen Stadt Amber ist das Original – alle anderen Welten, Schatten genannt, sind nicht mehr als Variationen, die sich immer weiter vom Ideal entfernen.
Die Mitglieder des Königshauses haben die Fähigkeit, zwischen diesen Welten zu reisen, indem sie durch Addieren und Subtrahieren von Aspekten Ambers de facto die Wirklichkeit um sich herum verändern. Die Serie lässt letztlich offen, ob es sich dabei tatsächlich nur um Reisen handelt, oder ob die Parallelwelten auf diese Weise nicht eher erschaffen werden.
Kunterbunter Mix
Dass sich die erste solche Reise, an der wir teilhaben dürfen, als psychedelische Autofahrt durch eine sich laufend verändernde Landschaft gestaltet, zeigt bereits, dass "Amber" Fantasy der etwas anderen Art ist. Zelazny scherte sich keinen Deut um Genre- oder sonstige Grenzen: Da wird gelegentlich der Leser direkt angesprochen, und in einem späteren Roman wird der Autor sogar höchstselbst als Handlungsfigur auftauchen.
Die Machtkämpfe der neun Prinzen mit ihren (für uns) übernatürlichen Kräften und das Motiv vom Weltenerschaffen erinnern stark an Philip José Farmers Romanzyklus "Welt der tausend Ebenen"; Zelazny gab auch zu, dass ihm das als Vorbild gedient hatte. Weitere Inspirationsquellen waren die nordische Mythologie, die Artus-Legende und Shakespeare-Stücke. Und last but definitely not least das Tarot, das hier als Kommunikations- und Teleportationssystem zwischen den Welten fungiert. Wie gesagt, "Amber" war ein Kind der 70er und das "mystische" Kartenspiel damals sehr en vogue. Unmittelbar nach Abschluss des ersten "Amber"-Zyklus griff beispielsweise US-Autor Piers Anthony den Kartenstapel auf, um auf Basis des Tarot einen Science-Fiction-Zylus zu stricken.
Reisen mit der Kraft des Geistes, Transformationen, gespiegelte Realitäten, buchstäbliche Trips in hyperrealistische Welten voller augenbetäubender Farben: mehr Seventies geht nicht. Das eigentlich Verblüffende an "Amber" ist aber, dass diese ganze Esoterik ohne viel Tamtam gehandhabt wird. Denn – und das zu betonen ist wichtig – im Zentrum steht gute alte Haudrauf-Action, erzählt im Ton einer Abenteuergeschichte für Jungs. Ob man "Die Chroniken von Amber" nun liebt oder nichts damit anfangen kann, in einem Punkt dürften sich beide Seiten einig sein: Solche Bücher werden heute nicht mehr geschrieben.
Ausblicke
Abschließend noch eine verlockend klingende Information für Fans: "Die Chroniken von Amber" sollen demnächst für eine TV-Serie adaptiert werden – und zwar von den Machern von "The Walking Dead".
Ein paar graue Wochen dauert 2017 noch, da ist genug Zeit für Bücher und eine weitere Rundschau vor Weihnachten. Angekündigt wäre unter anderem Neues von Sergej Lukianenko und Nnedi Okorafor – mal sehen, was sich ausgeht. Das 900-Seiten-Monster von Alastair Reynolds liegt übrigens immer noch ungelesen herum und ich hege den Verdacht, dass ein paar Gegenstände, die ich nicht mehr finden kann, hinter seinem Ereignishorizont verschwunden sind. (Josefson, 4. 11. 2017)
_______________________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher