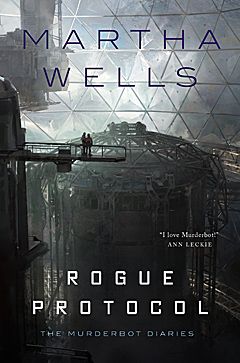
Martha Wells: "The Murderbot Diaries 3: Rogue Protocol"
Broschiert, 160 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
Was wünscht sich ein für den Kampf gezüchteter Cyborg, wenn er mal wieder im kindischen Hickhack von Menschen um Beistand gebeten wird? Natürlich eine "Ignorieren"-Funktion wie bei uns im Forum: There needs to be an error code that means "I received your request but decided to ignore you". Aber leider, die Programmierung (oder das gute Kunstherz) verhindert, dass sich Murderbot raushalten kann.
Martha Wells' höchst populäre Schöpfung Murderbot können sich diejenigen, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, wie ein seltsames Kind der Liebe von Sheldon Cooper und Jason Statham vorstellen: Hier der Serien-Fan, der menschliche Interaktionen zwar aufmerksam und höchst analytisch am Bildschirm mitverfolgt, aber bloß nicht selbst damit behelligt werden will. Und dort der Action-Star mit stoischer Miene, der jedes Mal wieder von den Drehbuchautoren in die Rolle des widerwilligen Beschützers gedrängt wird.
Dritter Durchlauf
Zwei Abenteuer hat Murderbot bereits absolviert ("All Systems Red" und "Artificial Condition"), und nach kurzer Pause ist die selige human-free vacation auch schon wieder vorbei. Diesmal zieht es Murderbot auf den abgelegenen Planeten Milu. Dort soll das Unternehmen GrayCris, mit dem Murderbot seit Band 1 eine Rechnung offen hat, ein angebliches Terraforming-Projekt als Deckmantel für den Abbau von Alien-Relikten genutzt haben. Was streng verboten wäre – ein öffentlich gemachter Nachweis könnte den skrupellosen Konzern also endlich aus dem Verkehr ziehen.
Wenn Murderbot als waffenstarrender Begleitschutz einer Gruppe von Menschen die eingemottete Terraforming-Station betritt, finden wir uns in einem recht klassischen Plotmuster wieder: Kaum ahnt man, dass in den leeren Räumlichkeiten etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, liegt auch schon wieder jede Menge Metall in der Luft. Und Murderbot steckt wie immer dort, wo das Gewühl am dicksten ist: I know in the telling it sounds like I was on top of this situation but really, I was still just thinking "Oh shit oh shit oh shit".
Die Sarkasmusmaschine gerät an ihre Grenzen
Im Alleingang hätte Action – und davon gibt es jede Menge – die "Murderbot Diaries" nicht so populär gemacht, wie sie sind. Es ist der fortlaufende Kommentar, den unser Ich-Erzähler – gewissermaßen der personifizierte Sarkasmus – zu seinen Handlungen und erst recht zu denen der beklagenswert unvernünftigen Menschen abgibt.
Der Sarkasmus als Schutz vor der Welt bröckelt allerdings, als Murderbot auf sein schieres Gegenteil trifft: Miki ist der Name eines Roboters, der den menschlichen Erkundungstrupp begleitet. Und der ist ein derartiges Unschuldslamm, dass Murderbot daraus nur einen Schluss ziehen kann: Miki ist noch niemals in seiner Existenz von Menschen angelogen oder missbraucht werden – was ein so gewaltiger Kontrast zu Murderbots eigener Geschichte wäre, dass sich unsere normalerweise nicht um Kommentare verlegene Hauptfigur in einigen wirklich rührenden Momenten in sich zurückziehen muss, weil ihr die Worte stocken.
Überhaupt mehren sich in "Rogue Protocol" die Anzeichen, dass Murderbot nicht mehr ganz der/die/das Alte ist. Bedeutete es früher das höchste Glück, fernab von Menschen in einem Frachtcontainer verstaut zu sein und in aller Ruhe Serien streamen zu können, so fühlt sich das mittlerweile nicht mehr ganz so prickelnd an. Wird hier etwa jemand ganz gegen seinen Willen menschlich? Der nächste und voraussichtlich letzte Teil der "Murderbot Diaries" wird es zeigen: "Exit Strategy" erscheint im Oktober.
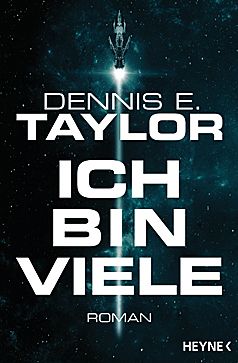
Dennis E. Taylor: "Ich bin viele"
Broschiert, 461 Seiten, € 15,50, Heyne 2018 (Original: "We Are Legion", 2016)
Was man halt so tut auf einer SF-Convention zwischen zwei Panels: Ein Sandwich essen, die E-Mails checken ... oder wie Bob Johansson mal eben zum benachbarten Kryonik-Center rüberspazieren und einen Vertrag unterzeichnen, dass man ihm nach seinem Tod den Kopf abschneidet und einfriert. Schließlich ist der Software-Ingenieur und begeisterte "Star Trek"-Fan gerade zu einem Batzen Geld gekommen, das will ja auch irgendwie ausgegeben werden.
Der Vertrag tritt dann allerdings schneller in Kraft, als Ich-Erzähler Bob sich's erhofft hätte. Ein aus der Spur gekommenes Auto rast auf ihn zu und mit den famous last words "Das kann doch nicht dein beschissener Ernst sein!" beendet unser Held seine natürliche Existenz. Wir sind erst auf Seite 25.
Bob 2.0
Als Bob im Jahr 2133 wiedererweckt wird, ist selbst der Kopf weg – Bob 2.0 ist lediglich eine digitalisierte Kopie seines ursprünglichen Bewusstseinsinhalts, aber im Grunde doch ganz der Alte geblieben. Ganz im Gegensatz zu seiner Heimat: Die USA haben sich inzwischen in eine Theokratie verwandelt, und transhumane Wesen gelten als Abscheulichkeit vor dem Herrn. Was freilich nicht bedeutet, dass man keine Verwendung für sie hätte: Sie lassen sich nämlich prima zur Steuerung diverser Gerätschaften einsetzen. Autor Dennis E. Taylor verwendet für seine Software-Existenzen übrigens das eigentlich schon besetzte Wort Replikanten.
So erhält Bob, der keinerlei Eingewöhnungsprobleme hat, gewissermaßen die Körperlichkeit zurück. Als besonderes Zuckerl lässt man ihn nicht irgendeinen x-beliebigen Alltagsapparat steuern, sondern die erste Von-Neumann-Sonde der Welt. Bob soll als Bord-KI zu anderen Sternen fliegen, sich dort vervielfältigen und eine spätere Kolonisierung durch Menschen vorbereiten. Klingt nach dem einsamsten Schicksal aller Zeiten und Welten, doch unser Bob tickt da eben anders: "Mannomann, das hier ist wirklich der Traumjob eines jeden Nerds." Begeistert startet Bob in die Weiten der Galaxis, und erst jetzt beginnt das Abenteuer wirklich. Wäre man ein alteingesessenes Alien, müsste man übrigens mit Grusel betrachten, wie sich hier ein interstellares Netzwerk aus Bobs auszubreiten beginnt.
One for the nerds
Der kanadische Autor Dennis E. Taylor ist noch nicht allzu lange im Geschäft und hat mit diesem Roman, dem Auftakt der "Bobiverse"-Reihe, schon früh Popularität erlangt. Der Schlüssel zum Erfolg dürfte im Ton der Erzählung liegen: Bob ist vom Typ optimistischer Einzelgänger und stellt sich jeder Herausforderung mit Zielstrebigkeit, aber auch einer hilfreichen Portion Lockerheit. Vom Grundszenario her müsste man eigentlich an John Scalzis "Old Man's War"-Reihe, Anne McCaffreys "Gehirnschiff"-Zyklus und andere Werke über wiederverwertete Existenzen denken. Bobs Sicht auf die Welt lässt "Ich bin viele" aber eher Fans von Ernest Cline ("Ready Player One") anvisieren.
Die Unzahl an Verweisen auf erstens "Star Trek" und zweitens alle möglichen anderen SF-Klassiker unterstreicht diesen Eindruck noch einmal stark. Während bei Cline der Nerdismus allerdings auf oft recht unplausible Weise in die Bücher gequetscht wird, ist Taylor klug genug, ihn auf seine Hauptfigur zu beschränken – und das ist nun mal ein Nerd. Bob verleiht einem seiner Hilfsprogramme einen Admiral-Ackbar-Avatar und steuert den Stern an, um den im "Star Trek"-Universum Vulkan kreist: Zu seinem Charakter passt's, die Leser (so sie denn vergleichbar ticken) freut's, der Rest des Universums kümmert sich nicht drum und reagiert auf Bobs Zitate aus der SF-Geschichte mit leeren Gesichtern.
Keine Identitätsstudie
Eigentlich wären Identitätsfragen ein aufg'legtes Thema für diesen Roman: erst der Wechsel in eine digitale Existenz, dann die Vervielfältigung des Ichs. Philosophische Abgründe darf man sich von "Ich bin viele" aber keine erwarten, die blockt alleine schon Bobs gesunder Pragmatismus ab (und sie wären von Taylor auch eindeutig nicht beabsichtigt). Einmal gibt es für einen kurzen Moment einen fliegenden Ich-Wechsel im Stil von Ann Leckie – für den Rest des Romans werden all die Bobs aber ganz konventionell auf ihre jeweiligen Kapitel verteilt.
Sich dem Wesen einer Software-Existenz anzunähern, gelingt Taylor nur bedingt. Gut die Idee, dass Bob nun über ein variables Zeitempfinden verfügt. Nicht schlüssig hingegen, wenn Taylor von "Hormonsteuerung" schreibt und mit seiner Wortwahl eine Körperlichkeit suggeriert, die nicht mehr gegeben ist. Aber das sind Kleinigkeiten. Die größte Implausibilität ist wohl, wie sich die neuen Bobs in die Hierarchie fügen, die das Original etabliert hat. Tragen seine ersten Kopien noch Allerweltsnamen wie Bill oder Milo, so sind es bei den nächsten Generationen fast nur noch Bezeichnungen von Serien- und Cartoonfiguren, ob Homer, Garfield oder Linus. Nachdem sich jeder einzelne von ihnen eigentlich als Bob fühlen muss, wirkt derartige Selbstverleugnung doch etwas unwahrscheinlich. (Obwohl mir gerade einfällt, dass ich hier ja selbst unter Pseudonym auftrete ...)
Etwas für jeden
"Ich bin viele" könnte das Buch auch über sich selbst sagen. Nachdem sich Bob zum ersten Mal vermehrt hat und die Kopien ihrerseits neue "Bobs" hervorgebracht haben, teilt sich der Plot in entsprechend viele Seitenäste auf. Weltraumgefechte, die Evakuierung der verwüsteten Erde, Civilization Building bei einer bedrohten Spezies und wüste Kloppereien mit Gorilloiden seien als wichtigste Themen genannt. Es ist mehr eine Art ausufernde SF-Soap, die für jeden was bietet, denn ein Roman.
Dementsprechend hat das Buch auch – trotz eines gelungenen Schlusssatzes – keinen eigentlichen Abschluss. Man steigt aus "Ich bin viele" wie aus der Staffel einer TV-Serie aus, vielleicht sogar nur wie aus DVD 1 des 3-DVD-Pakets einer Staffel. Aber macht ja nix, Nachschub kommt bereits im Dezember unter dem Titel "Wir sind Götter", dem zweiten Teil der "Bobiverse"-Trilogie. Und weil Teil 1 zwar nicht gerade tiefschürfend, aber doch sehr unterhaltsam war, wird der Bestell-Button voraussichtlich wieder fleißig gedrückt werden.
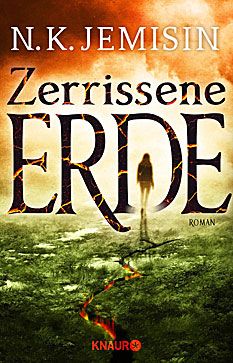
N. K. Jemisin: "Zerrissene Erde"
Klappenbroschur, 494 Seiten, € 15,50, Knaur 2018 (Original: "The Fifth Season", 2015)
Die US-Amerikanerin N. K. Jemisin, bekannt geworden mit der Fantasy-Trilogie "Inheritance" ("Das Erbe der Götter"), gehört zu jener Gruppe von Autoren, die in den vergangenen Jahren die großen Genrepreise gleichsam abonniert haben. Glücklicherweise aber auch zu einer Untergruppe, die Romane schreiben kann, die tatsächlich Hand und Fuß haben.
Ihre aktuelle Reihe "Broken Earth" hat gerade den dritten Hugo Award in Folge gewonnen – noch nie zuvor sind alle drei Teile einer Trilogie jeweils als bester Roman des Jahres ausgezeichnet worden. Man kann die Frage aufwerfen, ob dieser Siegeszug auch ohne die Polarisierung des Genres durch "Puppygate" stattgefunden hätte (Jemisin war eine der profiliertesten Gegnerinnen der konservativen bis reaktionären Gruppen, die als Sad bzw. Rabid Puppies auftraten und letztlich scheiterten). Zumindest ein Preis ist aber auf jeden Fall verdient – in den kommenden Jahren werden die Awards dann vielleicht wieder etwas abwechslungsreicher.
Eine Welt im Daueraufruhr
"Zerrissene Erde" könnte das "Darkover" der 2010er Jahre sein. Es läuft unter der Genrezuordnung Science Fantasy; Technologie und Magie verbinden sich hier zu einem ungewöhnlichen, aber stimmigen Ganzen. Schauplatz der Trilogie ist ein schlicht als die Stille bezeichneter Superkontinent auf einer Welt, die die Erde der fernen Zukunft oder auch ein anderer von Menschen besiedelter Planet sein könnte. Und es ist keine ruhige Welt: Regelmäßig regt sich Vater Erde in Form von gewaltigen tektonischen oder vulkanischen Ereignissen, die als Fünftzeiten bezeichnet werden. Diese können ähnlich schwerwiegende Folgen nach sich ziehen wie die diversen Massenaussterbeereignisse der Erdgeschichte, doch liegen zwischen ihnen nicht Millionen, sondern im Schnitt nur einige hundert Jahre.
Eine so spezielle Welt bringt auch spezielle Mutationen hervor: Orogenen genannte Menschen können die Seismik beeinflussen, indem sie ihrer Umgebung Energie entziehen und diese in die Erde lenken. Verständlicherweise werden sie vom Rest der Bevölkerung zwiespältig gesehen: Zum einen können sie Katastrophen verhindern, zum anderen sind sie schlicht und einfach lebende Massenvernichtungswaffen – je nachdem, wie sie ihre Gabe einsetzen. Die Romanheldinnen, die uns Jemisin hier präsentiert, werden wir als beides kennenlernen: als Helferinnen in der Not und als Massenmörderinnen (keine leichte Entscheidung der Autorin, Sympathieträgern eine derartige Last auf die Schultern zu legen).
Technologisch befinden wir uns auf einem Stand, der Telegraphie, Elektrizität und Antibiotika kennt. Trotzdem fühlt sich das Setting nicht nach frühem Industriezeitalter an: Es gibt keine Anzeichen für Massenproduktion oder -mobilität, stattdessen leben die Menschen überwiegend in voneinander getrennten Gemeinschaften (kurz: Gems), die Subsistenzwirtschaft betreiben – eine Konsequenz daraus, dass man im Fall einer Fünftzeit auch ohne Kontakt zum Rest des Reichs überleben können muss. Es gibt aber Relikte aus anderen Zeitaltern mit ganz anderen technologischen Errungenschaften; das sichtbarste von allen sind riesige Obelisken aus Kristall, die am Himmel schweben. Und als Extrawürze gibt es noch die geheimnisvollen Steinesser: Wesen, die unter der Erdkruste leben und manchmal auf der Oberfläche als "lebende Statuen" in Erscheinung treten. Es ist eine fremde, seltsame Welt.
Sich darauf einlassen lohnt sich
Der Prolog von "Zerrissene Erde" kommt als rasantes Zapping durch den Kontext der folgenden Handlung daher und ist daher zunächst noch völlig unverständlich (es zahlt sich aus, ihn nach Beendigung der Lektüre noch mal zu lesen, erst dann versteht man alles). Dabei wird aber nicht nur zwischen Personen und Schauplätzen herumgesprungen, sondern auch zwischen Präsens, Imperfekt und Futur sowie zwischen Erzählen in zweiter und dritter Person. Das ist eine ordentliche Packung, und ich dachte zunächst noch: "Oweh, dieses Buch wird mir auf die Nerven gehen", aber nicht immer ist der erste Eindruck der richtige. Jemisin wird den Wechsel zwar beibehalten – dann aber im Rhythmus längerer Kapitel und Abschnitte, was die Sinne wieder entwirrt.
Die Handlung läuft in drei Erzählsträngen mit ebenso vielen Protagonistinnen ab. Die prominenteste Rolle kommt dabei der Orogene Essun zu, die in einer kleinen Gem eine Familie gegründet hat und ihre Gabe vor ihrer Umwelt geheim hält. Doch leider hat sie diese an ihre Kinder weitervererbt – als ihr Mann dies bemerkt, erschlägt er den Sohn und entführt die Tochter. Als der Roman beginnt, ist dies bereits geschehen. Dass Essuns Kapitel in zweiter Person erzählt werden, scheint daher zunächst den Schockzustand einer Figur widerzuspiegeln, die neben sich steht. Im weiteren Verlauf des Romans werden wir sehen, dass es dafür auch eine andere Erklärung geben kann.
Die beiden anderen Stränge wirken etwas konventioneller. Damaya ist ein junges Mädchen mit Orogenen-Gabe, das von seiner Familie verstoßen und vom Fulcrum-Orden aufgenommen wird, um seine Kräfte kontrollieren zu lernen. Es folgt das gewohnte Handlungsmuster aus Selbstfindung zwischen strenger Disziplin und schulischem Mobbing. Dritte im Bunde ist die junge Orogene Syenit, die zusammen mit einem versierteren Ordenskollegen in eine Stadt entsandt wird, die von einem geologischen Problem geplagt wird. In welchem zeitlichen und kausalen Zusammenhang diese drei Erzählstränge stehen, bleibt lange Zeit offen, wird aber noch in diesem Band der Trilogie geklärt werden. Dialoge, Innenschau und Action in teils kataklysmischem Ausmaß halten sich dabei die Waage.
Das nächste "Game of Thrones"?
Unsere drei Heldinnen bewegen sich zu Fuß über den Kontinent, und dieses Tempo spiegelt die Erzählung wider. Das ist kein Roman, über den man einfach mal so schnell drüberlesen kann – was ohnehin schade wäre, denn dafür hat Jemisin sprachlich zu viel auf dem Kasten. Der langsame Aufbau und die Komplexität der Handlung würden sich aber hervorragend dafür eignen, daraus eine Serie zu machen. Und tatsächlich ist "Broken Earth" bereits von TNT für eine TV-Serie optiert worden. Die Suche nach einem Nachfolger für das bald auslaufende "Game of Thrones" läuft – nach dem Flop der "Shannara Chronicles" und dem wer-weiß-wie-langen Warten auf die Tolkien-Serie besteht da eindeutig Bedarf, und Jemisins Szenario hat großes Potenzial.

Karl Schroeder: "The Million"
Broschiert, 192 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
Der Kanadier Karl Schroeder ist so etwas wie Mr. Big Idea in der gegenwärtigen Science Fiction. In seiner "Virga"-Reihe entwarf er eine gigantische luftgefüllte Sphäre, deren Bewohner mit Steampunk-artiger Technologie durch die Schwerelosigkeit zwischen Kunstsonnen und Mini-Habitaten knattern.
Lockstep revisited
Noch faszinierender war der Roman "Lockstep", der eine Lösung für die Unüberwindlichkeit der Lichtgeschwindigkeit präsentierte, an die vor Schroeder wirklich noch niemand gedacht hat: Die Welten des interstellaren Reichs der Menschheit wechseln zwischen kurzen Wach- und langen Winterschlafphasen. Dadurch bleiben sie im Takt mit den Raumschiffen, die mit relativistischer Geschwindigkeit zwischen diesen Welten unterwegs sind. Ein Trip, der eigentlich Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte dauert, scheint damit so überlichtschnell abzulaufen, als hüpfte man durchs "Star Trek"-Universum.
Genau genommen ist es nicht ein einziger gemeinsamer Takt, sondern eine ganze Reihe – je nachdem, welchem Verbund sich eine Welt angeschlossen hat. Die Vorstellung eines Geflechts von Gesellschaften mit extrem unterschiedlichem Tempo, die dieselbe Raumregion gänzlich unabhängig voneinander bewohnen, ist endlos faszinierend. Und weil sich natürlich nicht jeder an die Vereinbarung, einander in Ruhe zu lassen, hält, bot sie auch Stoff für jede Menge Konflikte. Einen solchen stellt uns nun "The Million" vor; Schauplatz ist diesmal die Urheimat der Menschheit selbst.
Eine Million und zehn Milliarden
In einer nicht näher bestimmten Zukunft wird die weitgehend in den Naturzustand zurückgeführte Erde nur noch von der im Titel genannten Million Menschen bewohnt. Da ihnen sämtliche Ressourcen des Planeten zur Verfügung stehen, leben sie – insbesondere die elitären Hundred – in unvorstellbarem Luxus. Als die Tochter einer angesehenen Familie in Venedig eintrifft, tut sie dies in einem gigantischen Luftschiff, das sich in eine leuchtende Wolkenbank gehüllt hat: ein reisender Sonnenuntergang. Und weil Musikbegleitung und Luftakrobaten für den pompösesten Auftritt ever noch nicht ausreichen, projiziert das Luftschiff auch noch per Mega-Laser zwei leuchtende Punkte auf die dunkle Region neben der Mondsichel, um den Erdtrabanten in ein Smiley-Gesicht zu verwandeln. Einfach nur aus Spaß.
Wenn sie sich nicht gerade für irgendeinen Anlass in einer der wenigen verbliebenen Museumsstädte trifft, lebt die Elite auf weit verstreuten Landgütern, verwaltet die umgebenden Großregionen und frönt dem Müßiggang zwischen Bällen, Intrigen und Spielen – der eine oder andere von Robotern ausgetragene Krieg inklusive: Everybody had armies and air forces, or if you lived on the coast, a navy or two. Why not? They were fun toys.
Und die Pointe daran: Sie sind alle nur Hausmeister. Oder zumindest würde die andere Zivilisation der Erde sie so betrachten. Die erwacht nur einmal alle 30 Jahre zum Leben. Dann steigen zehn Milliarden Menschen aus ihren Kälteschlafkammern und überrennen den Planeten wie beim größten Spring Break aller Zeiten. Erst wenn der Irrsinn nach einem Monat wieder vorbei ist, finden die Erde und ihre Million zurück zur Ruhe.
Der Plot
Hauptfigur der Novelle ist der junge Gavin Penn-of-Chaffee, der ein Geheimnis hat beziehungsweise ein Geheimnis ist. Er gehört nämlich zu jener anderen Zivilisation (ist also ein sogenannter visitor) und gelangte als Kind unter ungeklärten Umständen auf die Erde der Million. Ein Familie hat ihn liebevoll aufgenommen, muss ihn aber vor der Außenwelt verstecken – bis eines Tages das Anwesen angegriffen wird und Gavin fliehen muss.
Durch eine – zugegebenermaßen mit der Brechstange konstruierte – Konstellation von Umständen kann Gavin eine falsche Identität annehmen und sich bei der Human Sustainability Task Force, gewissermaßen der globalen Polizeitruppe, als Azubi einschleichen. Dort versucht er die Hintergründe der Attacke auf seine Familie herauszufinden, seinen Adoptivbruder zu retten, dem die Tat in die Schuhe geschoben werden soll – und letztlich das Rätsel seiner eigenen Existenz zu lösen.
Schroeder bekannte, dass es ihm einen Heidenspaß bereitet hat, die ultra-opulente Welt der Million auszugestalten – und das teilt sich beim Lesen auch mit. Vor lauter Aahs und Oohs über dieses "Downton Abbey" zur Potenz nimmt man die eigentliche Handlung über längere Zeit nur als Randerereignis wahr. Was zunächst nach einem konventionellen Mantel-und-Degen-Abenteuer aussieht, das mit der Originalität des Settings nicht mithalten kann, wird sich aber noch mausern und Form und Inhalt verschmelzen lassen: Immerhin ist Gavin einer Verschwörung auf der Spur, die eng mit der Grundstruktur seiner seltsamen Doppel-Zivilisation verbunden ist. Tolle Lektüre – und ich hoffe doch sehr, dass es dazu noch eine Fortsetzung geben wird!
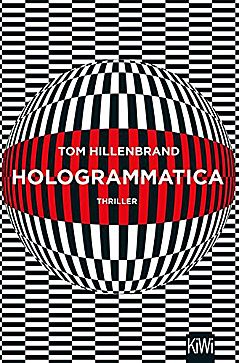
Tom Hillenbrand: "Hologrammatica"
Broschiert, 559 Seiten, € 12,40, KiWi 2018
Mit seinem Roman "Drohnenland" hat es der deutsche Autor und Journalist Tom Hillenbrand 2015 geschafft, sowohl den Friedrich-Glauser-Preis für den besten Krimi als auch den Kurd-Laßwitz-Preis für den besten Science-Fiction-Roman des Jahres zu gewinnen. Das ist eine Leistung, die es zu würdigen gilt, denn die Verschmelzung von handlungs- und settingbestimmten Genres ist nicht so einfach, wie viele Autoren es gerne hätten.
Häufig hat sich ein Autor auf ein Genre spezialisiert, das gewissen Handlungsmustern folgen muss, sei es Romance, Horror oder – wie in Hillenbrands Fall – Krimi. Zwecks Abwechslung verlegt er seine Plots dann vielleicht mal von der Gegenwart in ein historisches oder auch ein phantastisches Setting, wo es freilich einen weiteren Satz von Genre-Regeln zu beherzigen gilt. Diese Synthese gelingt bei weitem nicht jedem; unzählige hanebüchene Zukunftsentwürfe als Kulisse für Liebes- und Mordgeschichten lassen grüßen. Hillenbrands jüngster Roman "Hologrammatica" hingegen gehört zu den Fällen, in denen sowohl die Krimi- als auch die Science-Fiction-Aspekte sitzen.
Die Welt der Hologrammatica
In der Romanwelt des Jahres 2088 wimmelt es nur so von virtuellen Requisiten. Nicht jedoch – und das ist eine Abwechslung in der heutigen SF – in Form von Datenströmen, die als Augmented Reality eingespielt werden und nur via entsprechendes Empfangsgerät wahrgenommen werden können, ob VR-Brille oder Implantat im Kopf. Nein, hier findet das Ganze im Bereich des sichtbaren Lichts statt, als gute alte Hologramme.
Die sind einfach überall: Abgenudelte Hausfassaden werden mit Holopolish behübscht, Menschen verstecken ihre schleißige Morgenfrisur oder auch ihre Identität hinter Holomasques und so weiter. Erst wenn man all diese Kosmetik nicht mehr sehen will, braucht man spezielles Gerät. Sogenannte Stripper-Software schält die verschiedenen holografischen Ebenen von der Welt ab – das hat mitunter einen ähnlich ernüchternden Effekt wie die Einnahme des Gegenmittels gegen die Maskone in Lems "Futurologischem Kongress".
Gumshoe Galahad
Als Hauptfigur – es ist schließlich ein Krimi – haben wir einen Ermittler mit dem unwahrscheinlichen Namen Galahad Singh, spezialisiert auf das Aufspüren von Verschwundenen. Für einen Privatdetektiv (oder im Wording des Romans: Quästor) hat Galahad eine recht ungewöhnliche Eigenschaft. Nicht, dass er schwul ist, und auch nicht, dass er gelegentlich von Depressionsschüben heimgesucht wird – sondern dass er eigentlich aus superreichem Hause stammt. Das wird – wie vieles in diesem Roman – lange Zeit nur kurz erwähnt, ehe Hillenbrand auf das Wie und Warum eingeht. Und tatsächlich wird sich am Ende zeigen, dass hier wirklich jedes Detail seine Funktion im großen Ganzen hat.
Für seinen aktuellen Fall wird Galahad auf die verschwundene Software-Entwicklerin Juliette Perrotte angesetzt. Die arbeitete an Verschlüsselungen für sogenannte Cogits, die neuste Errungenschaft der Technologie. Statt seines Gehirns kann man sich einen Quantencomputer mit dem digitalisierten Bewusstseinsinhalt einpflanzen lassen, was einige Vorteile bringt – unter anderem das zeitlich befristete Wechseln in einen gleichermaßen ausgestatteten Ersatzkörper nach Wahl. Offenbar war Perrotte einer folgenschweren Schwachstelle dieser Technologie auf der Spur. Außerdem gab es da einige unerwartete Seiten an ihrer Persönlichkeit, wie Galahad noch herausfinden wird.
Rätsel über Rätsel
Für längere Zeit zieht man beim Lesen die Zwischenbilanz: solider Krimi; könnte freilich mit der einen oder anderen Änderung jederzeit in ein gegenwärtiges Setting übertragen werden. Aber nicht vorschnell urteilen. In stetem Tropf führt Hillenbrand nämlich ein Geheimnis nach dem anderen in die Handlung ein, stets nach dem System: beiläufig erwähnen, den Leser stutzen und auf mehr hoffen lassen – und dieses Mehr erst viel später nachliefern.
Da wäre zum Beispiel die ominöse Krankheit, die die Weltbevölkerung stark verringert hat. Der weit fortgeschrittene Klimawandel. Ein zunächst schlicht als "Turing" bezeichneter Zwischenfall vor Jahrzehnten, der dazu geführt hat, dass man von den Vernetzungs- und Überwachungsbestrebungen unserer Tage wieder abgekommen ist. Die rätselhaften Revenants: Menschen, die verschwunden sind, Jahre später zufällig wiedergefunden werden, nun aber eine vollkommen andere Persönlichkeit haben. Und buchstäblich alles überstrahlend ein gigantischer Lichtdom, der eines Tages von Knossos aus in die Stratosphäre ragte und sein Geheimnis bis zur Romanzeit immer noch nicht preisgegeben hat (jedem SF-Fan würde das Herz bluten, sollte Hillenbrand dieses spezielle Mysterium im Verlauf des Romans nicht entschleiern).
Verbunden mit den krimitypischen Familiengeheimnissen und unerwarteten Querverbindungen sammelt sich bis zum Finale ein ordentliches Bündel an offenen Fragen an. An einer Stelle sinniert Galahad: "Oft ist die Wahrheit ja viel banaler, als man denkt." Ob das auch für die Auflösung des Romans gilt? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, auf jeden Fall wird sie alles zusammenbringen und auf (fast) alle Fragen eine Antwort liefern. Was dann noch übrig bleibt, könnte Stoff für eine Fortsetzung bieten – und ausnahmsweise klingt das nicht wie eine Drohung.
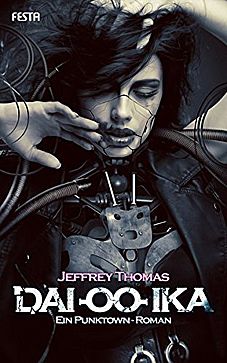
Jeffrey Thomas: "Dai-oo-ika"
Broschiert, 416 Seiten, € 14,40, Festa 2018 (Original: "Deadstock", 2007)
Asche auf mein Haupt! Vergangenen November ist ein neuer "Punktown"-Roman herausgekommen, und ich habe es erst heuer bemerkt. Dabei ist diese Stadt immer einen Besuch wert, das zeigt auch "Dai-oo-ika" wieder.
Punktown sehen und sterben
Zum Hintergrund: Paxton alias Punktown, das Autor Jeffrey Thomas in den vergangenen 20 Jahren zum Schauplatz einer ganzen Reihe von Romanen und Erzählungen gemacht hat, ist eine Millionenmetropole auf dem Kolonialplaneten Oasis. Errichtet auf den Fundamenten einer Alien-Stadt, ist sie heute die Heimat eines brodelnden Gemischs aus Menschen, Außerirdischen, Mutanten und künstlichen Geschöpfen aller Art. Das Alltägliche und das Absurde geben sich hier ein Stelldichein, getaucht in eine Atmosphäre von New-Wave-Coolness (womit in dem Fall nicht die New Wave of Science Fiction, sondern die von "Subway Riders" und "Diva" gemeint ist).
Es ist ein vitales multikulturelles Biotop und zugleich ein hartes Pflaster – durchaus ähnlich China Miévilles New Crobuzon. Vielleicht mit dem einen entscheidenden Unterschied, dass New Crobuzon – ganz der politischen Haltung seines Schöpfers entsprechend – immer nur fünf Minuten von der nächsten Revolution entfernt scheint, während das extreme soziale Gefälle in Punktown festgebacken wirkt. Den Unterschied zwischen Arm und Reich lernen wir bereits in der Einleitung von "Dai-oo-ika" kennen, wenn ein jugendliches Bandenmitglied aus den Slums auf der Suche nach seiner neuen Flamme ein wohlhabendes Viertel besucht. Ghetto-gestählt und entsprechend selbstsicher, landet der Unglücksrabe dennoch binnen Kurzem in einem Müllzerkleinerer.
Der Plot
Der Mörder, so viel sei verraten, ist selbst für Punktown-Verhältnisse von ungewöhnlicher Natur. Zwei abwechselnd beschriebene Handlungspfade werden sich ihm im weiteren Verlauf des Romans nähern. Auf dem einen ist die Jugend-Gang der Folger Street Snarlers auf der Suche nach ihrem verschwundenen Mitglied, auf dem anderen ermittelt der Privatdetektiv Jeremy Stake – zunächst freilich noch in ganz anderer Sache, mit dem Haupt-Plot wird er erst indirekt in Berührung kommen. Ein origineller Aspekt von "Dai-oo-ika" ist übrigens, dass die beiden Protagonistengruppen zwar in dieselben Geschehnisse verwickelt werden und doch bis zum Schluss nichts voneinander ahnen.
Jeremy Stake als zentrale Figur dürfen wir uns als den klassischen Noir-Detektiv mit Filzhut, stoischem Gemüt und tragischer Vorgeschichte vorstellen. Aufgrund einer Mutation ist er ein "Chamäleon": Je länger er ein anderes Gesicht betrachtet, desto mehr gleicht sich sein eigenes dem anderen an – beruflich kommt ihm das des Öfteren zugute, im Alltag wird die nicht wirklich kontrollierbare Gabe aber genauso oft lästig. Jeremy wird vom Leiter eines Biotechnologie-Konzerns engagiert, weil dessen Tochter die Puppe gestohlen wurde. Das mag nach dem lächerlichsten Fall aller Zeiten klingen, doch dürften die Alarmglocken bei den Lesern schon früh schrillen: Die Puppe soll nämlich lebendig sein, ihr Name Dai-oo-ika bedeute übersetzt "großer Tintenfischkönig" und der Beschreibung nach sehen wir eine niedliche Miniaturversion von Cthulhu vor unserem dritten Auge ...
Die Mischung macht's
Als Schwesterstadt zu New Crobuzon liegt auch Punktown an dem Punkt, an dem sich Science Fiction, Urban Fantasy, Horror und Bizarro überschneiden. Innerhalb des Horror-Universums wiederum befindet es sich an der Grenze der Lovecraft'schen Tradition (primär der Erzählstrang um Jeremy) und – dort, wo die Teenagerbande von unmenschlichen Kreaturen belagert wird – Szenarien, die wir aus einigen Erzählungen Stephen Kings und einer Unzahl Horror-Filme seit den 90ern kennen. Psychologischer Grusel stellt sich zudem ein, wenn sich Jeremy wie Rick Deckard in "Blade Runner" die Frage stellen muss, ob er ein "echter Mensch" ist, und wenn ihn Erinnerungen an seine Vergangenheit als Soldat quälen.
Punktown die Stadt wie auch Punktown der Erzählzyklus lebt vom bildgewaltigen, fast comichaften Aufeinanderprallen der unterschiedlichsten Motive. Während gute alte Flugautos über den Himmel ziehen, treibt unten am Boden die Biotechnologie wilde Blüten: ob Golems, Computer aus Gehirnmaterial und Bettlaken aus lebender menschlicher Haut oder Totvieh, das ohne Köpfe und Gliedmaßen in Tanks gezüchtet wird. Und zum Drüberstreuen durchschreitet man Portale in andere Dimensionen, und Tote melden sich bei den Lebenden via Ouija-Fon. Teils europäisch, teils asiatisch, teils völlig fremdartig, ist es letztlich eine phantasmagorische Version unserer Welt, in der immer wieder bekannte Motive, traumartig verzerrt, an die Oberfläche gespült werden: siehe etwa den Blauen Krieg, an dem Jeremy einst teilnahm und der eindeutig den Vietnamkrieg meint, auch wenn er in einer anderen Dimension ausgetragen wurde.
Bei ein paar Ingredienzen der Mischung merkt man freilich, dass der Roman im Original schon 2007 erschienen ist. Die Kawaii-Mode – also der aus Japan kommende Niedlichkeitskult – oder das Phänomen, dass japanische Schulmädchen ihre getragenen Höschen an erwachsene Männer verkaufen, haben zwar für Schlagzeilen gesorgt, als der Westen sie zum ersten Mal bemerkt hat; das ist nur schon einige Zeit her. Aber das soll den Gesamteindruck nicht trüben: Gut, dass auch diese Punktown-Erzählung endlich ihren Weg ins Deutsche gefunden hat!

Adrian Tchaikovsky: "The Expert System's Brother"
Broschiert, 176 Seiten, Tor Books 2018, Sprache: Englisch
Mit dem Evolutionsepos "Die Kinder der Zeit" hat sich Adrian Tchaikovsky heuer unter den Rundschau-Lesern offenbar sehr beliebt gemacht. Im Original erschien der Roman 2015, seitdem hat der fleißige Brite schon wieder jede Menge neue Titel veröffentlicht. Das meiste davon gehört zur Fantasy – seine jüngste Publikation, der Kurzroman "The Expert System's Brother", dreht sich aber wieder um die Frage, welchen Entwicklungsweg die Spezies Mensch einschlagen soll. Entsprechend dem Umfang wird das Thema diesmal freilich auf einer etwas kleineren Bühne abgehandelt.
Let me tell you about Aro. It's much where you come from, I'm sure, sagt Ich-Erzähler Handry und zieht damit den ältesten Autorentrick der Welt aus dem Hut. So erfahren wir in aller Kompaktheit, dass unsere Hauptfigur nur eine Lebensweise kennt – und können als alte SF-Hasen getrost davon ausgehen, dass sie überhaupt nicht so sein wird wie die unsere. Und so ist es auch: Besagtes Aro ist eine bäuerliche Gemeinschaft, deren Zentrum ein riesiger Baum bildet. In diesem Baum leben "Geister", die von Bewusstsein und Körper der wichtigsten Personen im Ort – dem Gesetzgeber und dem Arzt – Besitz ergreifen können. Dann geben die Besessenen Wörter wie "Dekontaminierung" oder "Antihistaminika" von sich, die keiner der schlichten Dorfbewohner versteht. Und Handry wundert sich, welche Welt die Geister eigentlich zu betreten glauben, wenn sie solche rätselhaften Ausdrücke für selbstverständlich halten.
Plötzlich fremd
Handry passiert im Grunde das Gleiche wie Obelix: Er fällt versehentlich in einen Kessel mit Zaubertrank. Dieser verleiht jedoch leider keine Superkräfte. Severance heißt das Gebräu, also Trennung, und dient zur Brandmarkung von Ausgestoßenen. Die Folgen bekommt der jugendliche Held schon bald zu spüren: Das meiste Essen wird für ihn unverträglich, Tiere beginnen ihn zu meiden – und bald die Menschen auch. Das geht über bloßes Mobbing hinaus, auch wenn Tchaikovsky es sehr gut versteht, in wenigen Sätzen zu skizzieren, wie Handry aus der Gemeinschaft hinausgleitet. Die anderen Dorfbewohner beginnen ihn zu vergessen, und bald scheinen sie ihn auch nicht mehr als menschlich zu empfinden.
Plötzlich fremd geworden, verlässt Handry sein Dorf und versucht sich allein in der Wildnis durchzuschlagen. Bei der Gelegenheit dürfen wir einen näheren Blick auf die fremdartige Tierwelt dieses ungenannten Planeten werfen. Wieder ist sie von der großen, vielbeinigen Sorte – nach "Die Kinder der Zeit" und "Die Schwarmkriege" darf man das wohl langsam als Markenzeichen des Autors werten.
Die Suche nach dem richtigen Weg
Ein Zeitlang fristet Handry sein Dasein als Dieb, dann trifft er auf einen Mann, der alles verändern könnte: Sharskin betrachtet die gesellschaftliche Lenkung durch die "Geister" als Sklaverei und will das System stürzen. Nachdem uns schon auf den ersten Seiten klar geworden ist, dass wir es hier mit den Nachfahren von Kolonisten zu tun haben müssen, die einer künstlichen Umweltanpassung unterzogen wurden, stellte sich früh die Frage, wohin der Plot verlaufen würde – der Geheimnisfaktor hätte die Handlung ja kaum noch tragen können. Das übernimmt nun das Revolutionsmotiv – und die Frage nach den möglichen Konsequenzen. Denn ist es wirklich eine gute Idee, etwas zu verändern, das funktioniert?
"The Expert System's Brother" ist also eine klassische Young-Adult-Geschichte: ausgerichtet auf eine jugendliche Hauptfigur, die vor das moralische Dilemma gestellt wird, welcher Weg der richtige ist. Große Knalleffekte bleiben aus, insgesamt aber eine gediegene Erzählung.

Michael K. Iwoleit & Michael Haitel (Hrsg.): "Nova Science Fiction 26"
Broschiert, 209 Seiten, € 13,90, p.machinery 2018
Sommerzeit, Kurzgeschichtenzeit. Wobei die seit 2002 erscheinende Anthologie-Reihe "Nova" natürlich mehr zu bieten hat als Erzählungen. "Nova" – vom Eigenverlag zunächst zu Amrûn und ab dieser Ausgabe zu p.machinery gewechselt – enthält immer auch einen "Sekundärteil" mit Fach- und Sachbezogenem. Den Löwenanteil davon stellt diesmal ein sehr ausführliches Interview mit dem Astrophysiker Harald Lesch, der einmal mehr zeigt, warum er ein gefragter TV-Experte ist.
In unterhaltsamer Weise und ohne mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten, spricht Lesch im Interview mit Thomas Sieber über Physik, Mathematik, außerirdisches Leben und nicht zuletzt den Zeitgeist: "Wenn ich heute höre, dass Leute immer wieder davon reden, wir müssen alles digitalisieren, und ich frage dann in den Saal: 'Wer von Ihnen kann denn programmieren, ist hier jemand, ja?' Nein! Das heißt, sie reden über eine Welt, deren Sprache sie gar nicht sprechen. Was ist denn das? Was wird denn da gefordert?"
Genre-Bezogenes kommt von Dirk Alt, der Stanislaw Lems 35 Jahre altes Essay "Das Katastrophenprinzip" aufarbeitet, den Rest des SF-Blocks müssen aus leider gegebenen Anlässen Nachrufe bestreiten: Horst Illmer erinnert an die im März verstorbene Kate Wilhelm ("Hier sangen früher Vögel"), die beiden SF-Autoren Christopher Priest und Vandana Singh ehren die große, im Jänner von uns gegangene Ursula K. Le Guin (von Singh ist übrigens vor kurzem eine Storysammlung erschienen, die in einer der nächsten Rundschauen vorgestellt wird). Die schönsten Worte kommen freilich von ihr selbst: Sehr gute Idee der Herausgeber, Ursula K. Le Guins Text "Ich stelle mich vor" aus den 90ern hier noch einmal abzudrucken. In ihrem vor Esprit funkelnden Essay spricht sie über die Erfindung des Konzepts "Frau", ein großes Vergnügen.
Geschichtenpaare
Der Schwerpunkt des Bands – mit etwa drei Viertel des Umfangs – liegt aber eindeutig auf der "Primärliteratur", also Storys. Acht sind es insgesamt, die Hälfte davon gruppiert sich zu themenverwandten Paaren. Sowohl "Nova"-Mitbegründer Michael K. Iwoleit als auch Michael Friebel nahmen sich der Quantenphysik an. Friebel wählte dabei den klassischeren Ansatz: "Quantentanz" kommt ganz im Stil einer Golden-Age-Geschichte daher, straight erzählt, mit Schlusspointe versehen und auf die Auswirkungen einer technologischen Innovation fokussiert – in dem Fall freilich nichts so "Altmodisches" wie Roboter oder Teleportation, sondern Quantenverschränkung an einem Teilchenbeschleuniger.
Iwoleit, der fraglos zu den besten Kurzgeschichtenautoren im deutschsprachigen Raum gehört, hat andere Prioritäten. Hauptfigur von "Die Seelen" ist ein todkranker Quantenphysiker, dem ein wissenschaftlicher Durchbruch gelungen ist. Der bleibt aber ähnlich vage wie der politische Hintergrund (es dämmert offenbar ein Weltkrieg herauf). Umso präziser wird die menschliche Seite einer Geschichte geschildert, die sich letztlich als Metapher auf den Wunsch lesen lässt, am Ende einer mäßig erfreulichen Lebensbilanz doch noch inneren Frieden zu finden.
Als zweites Autorenpaar konfrontieren sowohl Norbert Stöbe in "Wir kommen" als auch Thorsten Küper in "Confinement" ihre im Weltraum lebenden Protagonisten mit einer Infektion. In Küpers hochspannender Geschichte ruft ein Wissenschafter die Erde, nachdem ein nanotechnologisches Experiment außer Kontrolle geraten ist. Stöbe hingegen punktet mit der Zeichnung einer Raumfahrt-Ära, die nicht von technischen Innovationen, sondern von unglamouröser Kommerzialisierung geprägt ist; sein Patient Zero ist ein Kleinunternehmer, der Weltraummüll aufsammelt.
Weniger ist mehr
Moritz Greenman dürfte in "Façonneurs" gegen einige Lesererwartungen verstoßen: Zeitreisen sind das Thema, Spezialeffekte bleiben aber aus. Da jeder Zeitreisende durch seine Ankunft in der Vergangenheit einen neuen Geschichtsverlauf und damit ein Paralleluniversum erschafft, aus dem er nicht zurückkommen kann, lassen sich keine Effekte seines Trips nachweisen und das Ganze bleibt ein abstraktes Gedankenspiel. Reizvolle Idee. Wie schon in der vergangenen Rundschau gesagt: Bei wenig Platz beschränkt man die Handlung am besten auf eine einzige Situation, und das führt Greenman hier vor.
"Die fünfte Stufe der Entspannung" von Marc Späni könnte angesichts der auch nicht gerade epischen Länge ein paar Protagonisten und Termini weniger vertragen. Wie sich hier ein Konflikt zwischen der Erde und einer Kolonialwelt bis hin zum Big Crunch des ganzen Universums aufschaukelt, ist in seiner Konsequenz allerdings bemerkenswert; und das alles nur wegen eines doofen Flaschenöffners (!) als Casus Belli. – Der schwächste Beitrag der Anthologie ist wohl die First-Contact-Geschichte "Die Geschlechter der Leonen" von Bernhard Kempen, die offenbar für einen Ausbau geplant ist und deshalb als Einzelerzählung auch nicht völlig rund wirkt. Zudem hat es schon überzeugendere Szenarien gegeben, in denen die Geschlechterverhältnisse von Aliens ihre menschlichen Besucher verwirren – und die Passage mit dem Sex vor den Augen der Öffentlichkeit ist unfreiwillig komisch, sorry.
Qualitätskontrolle
Den gelungenen Abschluss des "Primär"-Blocks bildet die Erzählung "Ein Job für Krüppel" von Klaus Berger-Schwab. Anders als bei einigen anderen Beiträgen weiß man bei der die längste Zeit gar nicht, worauf sie hinauslaufen wird. Den Hintergrund bildet ein Bürgerkrieg in der nahen Zukunft, Hauptfigur ist ein Kriegsversehrter, der die Trümmer von Kampfmaschinen zwecks Recycling einsammelt und parallel dazu mit einer Ärztin über die Möglichkeit diskutiert, seine Nützlichkeit durch Implantate zu erhöhen: letztlich eine recht ernüchternde Parabel auf den Zwang unserer Tage, sich entweder dem fortschreitenden technologischen Wandel anzupassen oder auf der Strecke zu bleiben.
Mitherausgeber Michael K. Iwoleit ist als strenger Kritiker der Qualität von Kurzgeschichten bekannt, und das merkt man "Nova 26" an. Keine der Geschichten in dieser Anthologie – auch nicht die schwächeren – ist ein Totalausfall, und die besseren sind richtig gut. Iwoleitung macht sich doch immer wieder bezahlt.
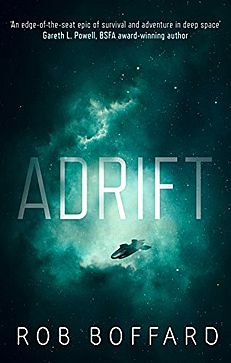
Rob Boffard: "Adrift"
Broschiert, 416 Seiten, Orbit 2018, Sprache: Englisch
Manche Blurbs geben schon Rätsel auf: "Adrift" soll perfekt für Fans von Adrian Tchaikovskys "Die Kinder der Zeit" und Becky Chambers' "Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten" sein. Also, um den intellektuellen Abstand zwischen diesen beiden Titeln zu überbrücken, braucht man schon ein sehr schnelles Raumschiff. Und der aus Südafrika stammende Autor Rob Boffard ("Tracer") hat in seinem jüngsten Roman bloß ein kleines Beiboot zur Verfügung, also erst mal schauen, wie sich das ausgehen könnte.
Der Plot
"Adrift" beginnt mit einer Weltraumschlacht, die sich zwar als Virtual-Reality-Spiel erweisen wird – man kann aber davon ausgehen, dass der Autor damit ein frühes Versprechen in Sachen Plot abgibt: Es wird um Tempo und Action gehen. Und einen realen Konflikt gibt es in der Mitte des 22. Jahrhunderts angesiedelten Handlung tatsächlich. Erst vor zehn Jahren ist ein Krieg zwischen den Kolonialwelten und der Frontier genannten Domäne der Erde zu Ende gegangen. Ressentiments gibt es nach wie vor, auch an Bord einer Raumstation, die in der Nähe eines Wurmlochs eine Doppelfunktion als Erzlager und Luxushotel erfüllt: Von hier aus hat man nämlich einen sagenhaften Blick auf den Pferdekopfnebel, was die Touristen in Scharen anlockt.
Eines grässlichen Tages kommt jedoch ein unbekanntes Raumschiff angeflogen und schießt die Station ohne Vorwarnung in Stücke. Die einzigen Überlebenden des Massakers hielten sich gerade an Bord des Ausflugsboots "Red Panda" auf und finden sich nun vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten wieder. Das Wurmlochportal ist zerstört und bis zum nächsten Außenposten der Zivilisation sind es Lichtjahre, die die kleine "Red Panda" mit all ihren technischen Mängeln niemals überbrücken könnte. Vorräte gibt es kaum an Bord – und wenn man schon denkt, schlimmer geht's nimmer, verschärft sich die Lage noch einmal.
Die Besetzung
"Adrift" ist ein Ensemblestück, eigentliche Hauptfigur(en) gibt es keine. Zu den zehn Überlebenden zählen unter anderem Hannah Elliot, die gerade ihren ersten Arbeitstag als Reiseführerin angetreten hatte, und die "Red Panda"-Pilotin Jana Volkova. Der Rest ist ein buntes Häuflein Weltraumtouristen: der Hotelkritiker und Alkoholiker Jack Tennant, die rüstige Asteroid-Mining-Veteranin Lorinda Esteban, die Frischvermählten Brendan und Seema O'Hara sowie die vierköpfige Familie Livingstone; unter Letzteren wird der Raumschiff-begeisterte Bub Corey mit seinem "Fachwissen" eine besondere Rolle spielen (aber keine Angst, nicht so ätzend wie Wesley Crusher). Den Großteil der Protagonisten lernen wir übrigens erst kennen, während bereits die Explosionstrümmer der Raumstation herumfliegen, hier wird keine Zeit verschwendet.
Man hat unwillkürlich Samweis Gamdschies aufbauende Ansprache an Frodo im Ohr, wenn Jana Hannah einbläut, dass Geschichten Heldenrollen brauchen: "This is your chance." Tatsächlich wird der eine oder andere der Protagonisten noch über sich hinauswachsen. Andere hingegen werden die Anstrengungen wieder zunichtemachen. Boffard liefert uns hier keine Instant-Heldentruppe, in der die Vernunft regiert. Schon eher gleicht die menschliche Gemengelage der von "The Walking Dead": An allen Ecken und Enden wird die Zusammenarbeit von Schwächen, Konflikten und persönlichen Geheimnissen beeinträchtigt.
Spannung als Trumpf
Ob und wie diese Zufallsgemeinschaft das Überleben meistert, ist einer der Faktoren, aus denen der Roman Spannung bezieht. Die anderen sind offensichtliche Fragen: Wer war der Angreifer – waren es Menschen oder Aliens? Haben sie "nur" die Raumstation zerstört oder gab es einen simultanen Angriff auf die ganze Menschheit? Und lauert das feindliche Raumschiff immer noch in der Nähe?
Auf letztere Frage lautet die Antwort übrigens ja, was unter anderem zum Unfug führt, dass man sich an Bord der "Red Panda" zeitweise kein Geräusch zu machen traut, als treibe man wie in "Das Boot" durchs Wasser und nicht durchs Vakuum. Auch das Manövrieren durch die Trümmerregion erweckt nicht wirklich den Eindruck von Weltraumdistanzen. Dafür ermöglicht es einige haarsträubende Stunts (Go, Lorinda, go! Voll die Action-Oma.), die zusammen mit nicht immer nachvollziehbaren Gesinnungswandeln und unerwarteten Comebacks fälschlich Totgeglaubter für Special Effects wie in einem Sommer-Blockbuster sorgen. Dieses Buch macht niemandem vor, mehr als spannend sein zu wollen. Das Versprechen hält es allerdings ein.

E. M. Brown: "Buying Time"
Broschiert, 320 Seiten, Solaris 2018, Sprache: Englisch
Zu Beginn eine Hilfestellung bei der Internetsuche: Auf die Punkte kommt's an. Epunkt Mpunkt Brown ist das neue Pseudonym des arrivierten britischen SF-Autors Eric Brown. Wer sie weglässt, landet im bemerkenswert umfangreichen Schaffen von Em Brown, die sich offenbar auf SM-Pornos in historischen Settings spezialisiert hat ("Submitting to His Lordship", "Punishing Miss Primrose"). Warum Brown – also der Eric – plötzlich auf ein halbgares Pseudonym zurückgegriffen hat, bleibt übrigens rätselhaft: "Buying Time" fügt sich eigentlich ganz gut in sein bisheriges Schaffen ein.
Die Ausgangslage
Der Roman dreht sich um einen Mann, dessen Bewusstsein – ohne zu wissen, wie und warum – immer weiter in die Vergangenheit zurückgeschleudert wird und dort die entsprechend jüngere Version seines Körpers in Besitz nimmt. Und dazu gleich noch eine Vorbemerkung: Ziemlich genau in der Mitte des Buchs wird zum ersten Mal ein für Zeitreisegeschichten typisches Mystery-Element auftauchen, nachdem sich die Handlung zuvor ganz auf das Seelen- und Liebesleben der Hauptfigur konzentriert hatte. Das sei all denen zur Beruhigung gesagt, die bei solchen Themen schon ganz gerne die Genre-Konventionen gewahrt sehen möchten. Und ja: Das Wie und das Warum werden am Ende auch geklärt.
Ironischerweise war mir das zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr wichtig. Für mich zumindest – die Geschmäcker dürften da auseinandergehen – war es in Sachen Spannung vollkommen ausreichend mitzuerleben, wie Hauptfigur Ed durch die Reise in seine Vergangenheit allmählich zu sich selbst findet. Denn mit jedem weiteren Sprung rückt Ed der mehrfach angedeuteten, aber sehr lange nicht geklärten "Urkatastrophe" seines Lebens näher, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist.
Die Reise beginnt
Ed Richie ist im Startschuss-Jahr 2017 ein 56-jähriger und nicht mehr allzu erfolgreicher Drehbuchautor aus Yorkshire. Als wir ihn kennenlernen, findet gerade seine aktuelle Beziehung ein stürmisches Ende. Das Kreischen der Autoreifen seiner Ex ist noch kaum verklungen, da löscht Ed schon ihren Namen aus dem Handy – es ist das Muster seines Lebens. Seine Freunde, die unzählige Frauen kommen und bald wieder gehen sahen, sind der Meinung, dass Ed seine Beziehungen unbewusst sabotiert. Doch Ed, der sich in emotionalen Momenten stets wie ein Schauspieler auf der Bühne vorkommt, vermag es nicht, die Distanz zwischen sich und anderen zu überbrücken: Irgendetwas Unausgesprochenes in seiner Vergangenheit lähmt ihn.
Und dann passiert das Unerwartete: Ed sieht ein weißes Licht und findet sich plötzlich neun Monate in der Vergangenheit wieder. Schon auf dieser ersten Etappe nimmt Ed mit dem Wissen aus der Zukunft eine kleine hilfreiche Korrektur vor – nicht für sich, sondern für seinen besten Freund. Selbst findet er allerdings keine Hilfe: Kaum hat er seinem Freund von seiner rätselhaften Reise erzählt, wird er noch weiter zurückgeschleudert und muss erneut bei null beginnen. Weitere Sprünge werden folgen, die ihn schließlich – der Roman folgt einem eher gemächlichen Tempo – bis in die 80er und zu besagter Urkatastrophe zurückbringen.
Die zweite Ebene
Parallel dazu schildert Brown in einem zweiten Handlungsstrang die recht ungemütliche Zukunft des Jahres 2030. Wie der Autor beim Brexit-Referendum abgestimmt hat, brauchen wir dabei nicht lange zu rätseln: Sein Roman-England ist wirtschaftlich runtergekommen und politisch zu einer faschistoiden Diktatur mutiert – in Tandem mit den ebenso autoritären USA. (Der Erzählstrang beginnt mit der Ankunft einer Flugzeugladung geflüchteter Lesben und Schwuler in Edinburgh, die aus den USA evakuiert werden mussten.) Schottland und Wales haben sich vom Königreich losgesagt und sind daher nicht nur liberal geblieben, sondern – in dem Punkt wird die Schwarz-Weiß-Zeichnung dann doch leicht unplausibel – prosperieren auch ökonomisch.
Hauptfigur dieses Strangs ist die Journalistin Ella Shaw aus Edinburgh, die nicht zuletzt aufgrund eines persönlichen Bezugs an einer Biographie über Ed Richie arbeitet. Der ist nämlich vor ein paar Jahren verschwunden – allerdings nicht im Jahr 2017, wie nun alle sofort schließen würden, sondern erst 2025. Davor hatte er noch eine Reihe von Aufsehen erregenden Romanen veröffentlicht, in denen er (wie Brown selbst) das Private und das Politische verknüpft und erstaunlich zutreffende Prognosen der Entwicklung Englands angestellt hatte.
Bange Fragen
Man beachte: Ed reist von 2017 aus in die Vergangenheit, soll nach 2017 aber Vorhersagen für die Zeit danach getroffen haben: Diese Diskrepanz treibt einen beim Lesen um, und ich muss gestehen, ich habe die Lösung dafür entweder nicht kapiert oder es gab keine. Mir scheint jedoch, dass hier in Sachen Zeitlinienkonstruktion die eine oder andere Lücke offenbleibt. In der Vergangenheit sind wir ja mit raffiniert verwobenen Zeitfäden verwöhnt worden (zuletzt etwa in Daryl Gregorys "Spoonbenders"), und damit kann "Buying Time" nicht mithalten.
Seine Stärken, die ihn auch zur empfehlenswerten Lektüre machen, hat der Roman dafür eindeutig, was das Gefühl anbelangt. Zentrales Motiv ist der vermutlich jedem Menschen bekannte Wunsch, noch einmal zurückzugehen und diesmal, mit der Erfahrung der Gegenwart, alles besser zu machen. Beide Protagonisten blicken auf die Vergangenheit zurück, als sie noch jung waren und die Welt – vermeintlich oder tatsächlich – besser. Und speziell für Ed mündet die Spurensuche in eine Frage, die sich so mancher andere auch schon gestellt haben dürfte: Was I ever happy?

A. E. van Vogt: "Die Expedition der Space Beagle"
Broschiert, 352 Seiten, € 10,30, Heyne 2018 (Original: "The Voyage of the Space Beagle", 1950)
Nostalgie-Alarm! Dieses Buch ist eine meiner allerfrühesten SF-Erinnerungen. Anlässlich der Wiederveröffentlichung schnell im Regal gekramt, aber leider muss die alte Donauland-Ausgabe irgendwann mal einem Umzug zum Opfer gefallen sein. Die hatte das (im Gegensatz zur Neuauflage korrekt kugelförmig dargestellte) Raumschiff "Space Beagle" und den Cœurl auf dem Cover, den man heute noch als Archetypus in manchen SF-Bestiarien finden kann. Wegen seiner ikonischen Wirkung ist er über das Schaffen des Autors hinausgewachsen, ein Ork-Effekt in verkleinertem Maßstab.
Als das Buch seinerzeit erschien, war es freilich schon alt: Der 1912 in Kanada geborene Alfred Elton van Vogt war einer der wichtigsten Vertreter des Golden Age of Science Fiction, in dem die SF den Schritt von Magazin-Veröffentlichungen zur Romanform vollzog. "Die Expedition der Space Beagle" spiegelt das wider. Es handelt sich eigentlich um vier Erzählungen, die 1939 bis 1950 in Pulp-Magazinen erschienen und nachträglich zu einem Roman verknüpft wurden. Schauplatz der Handlung ist ein Raumschiff, das ganz im Stil der "Enterprise" in Galaxien vordringt, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat (und in ihrem Fall stimmt "Galaxien" sogar). Benannt nach dem Forschungsschiff, mit dem einst Charles Darwin die Welt bereist hat, entdeckt auch die "Space Beagle" eine Reihe neuer Spezies. Anders als Darwins Tiere sind diese jedoch allesamt brandgefährlich und mit Superkräften ausgestattet.
Die Feinde
Der schon erwähnte Cœurl hat die Gestalt einer Raubkatze mit Tentakeln und kann elektromagnetische Strahlung manipulieren. Er lebt auf einem dem Untergang geweihten Planeten und sieht in der gelandeten "Space Beagle" eine unverhoffte Chance, doch noch dem Hungertod zu entgehen. Cœurl ist hochintelligent und versteht die Technologie der Menschen auf Anhieb – zugleich ist er jedoch ein triebgesteuertes Raubtier, das in einen Blutrausch verfallen kann. Für ein Monster, und das ist er zweifellos, wird der Cœurl bemerkenswert vielschichtig geschildert: Der Konflikt zwischen Intellekt und Instinkt, die melancholische Grundstimmung (er lebte schon zu Zeiten, als sein Planet noch eine Hochzivilisation trug, und streift nun einsam durch die Ödnis) sowie sein nachvollziehbarer Überlebenswunsch wecken Verständnis für das Ungeheuer.
Der dritte Romanabschnitt (ursprünglich die erfolgreiche Kurzgeschichte "Discord in Scarlet") wiederholt im Grunde den Plot der ersten, diesmal jedoch mit klarer Schwarz-Weiß-Zeichnung. Das dämonische Wesen Ixtl, das die "Space Beagle" mitten im Leerraum aufliest, ist ein unsterblicher Bewohner "des vorangegangenen Universums". Es kann durch Wände gehen und legt seine Eier in Menschen ab – ein ferner Urahn von Ridley Scotts "Alien". Anders als der Cœurl wird dieser Invasor an Bord ohne jeden Hauch von Sympathie geschildert. Ixtl, das mit seiner Brut das ganze Universum unterwerfen will, ist der Teufel selbst.
Keine feindliche Absicht hegen die Riim, eine Zivilisation von Vogelwesen, die sich wie Amöben teilen können. Ihre telepathische Kontaktaufnahme löst unter der "Space Beagle"-Besatzung allerdings verheerende Halluzinationen aus. Die Anabis schließlich ist wieder ein Gegner, den es rücksichtslos zu bekämpfen gilt: ein gasförmiges Wesen, das sich über die Galaxie M33 ausgebreitet hat und von der Lebenskraft ihrer Bewohner parasitiert. Auch dieses Wesen will die "Space Beagle" kapern, um sich universell auszubreiten – das eigentliche Monster an Bord ist aber ein ganz anderes ... nämlich van Vogts Held.
Ungewöhnliches gesellschaftliches Biotop
Die außerirdischen Bedrohungen sind für van Vogt kaum mehr als Katalysatoren für die zwischenmenschlichen Vorgänge an Bord. Die riesige "Space Beagle" dürfen wir uns am ehesten als fliegende Universität mit angeschlossener militärischer Abteilung vorstellen. Es gibt jede Menge Bürokratie, Hierarchien und Konflikte zwischen den Abteilungen. Und wer die Expedition leitet, das wird regelmäßig in demokratischen Wahlen bestimmt – ein ziemlich einzigartiges Szenario unter all den unzähligen SF-Romanen über Weltraummissionen. Ironie am Rande übrigens: Was Geschlechterrollen anbelangt, ist der Roman so altmodisch, dass er heute schon wieder unter dem Motto "Besondere Genderverhältnisse" beworben werden könnte. Alle 1.000 Besatzungsmitglieder sind männlich, ihr Sexualtrieb wird durch chemische Beimischungen im Essen unterdrückt.
Im Mittelpunkt der vier Episoden steht Elliott Grosvenor, Vertreter der noch jungen Wissenschaft des Nexialismus, einer Disziplin, die angetreten ist, alle Fachgebiete zu etwas Ganzheitlichem zu vereinen. Doch sie versteht sich nicht als bloße Schnittstelle, sie arbeitet auf eine neue Art des Denkens hin. Verschiedenste Psycho-Techniken und den Verstand beeinflussende Geräte gehören daher ebenfalls zu ihrem Repertoire. Wem das verdächtig bekannt vorkommt: Van Vogts Nexialismus entstammt nicht nur derselben Ära wie die Dianetik, der Autor stand damals auch in engem Kontakt mit Scientology-Gründer L. Ron Hubbard, seinerseits ursprünglich SF-Autor (erst als immer klarer wurde, in welche Richtung Hubbard abglitt, wandte sich van Vogt von ihm ab). Es war eine Zeit, in der man meinte, den menschlichen Geist völlig neu strukturieren zu können.
Von den anderen Abteilungsleitern an Bord – in seinen Augen Fachidioten – wird Grosvenor anfangs geringgeschätzt, aber das wird er noch ändern. Einer seiner wenigen Freunde attestiert ihm, der potenziell gefährlichste Mann an Bord zu sein. Zu Recht! Van Vogt beschreibt Grosvenor als die personifizierte Vernunft – doch pure Vernunft darf niemals siegen, wussten schon Tocotronic. Mit Manipulation und psychischer Gewalt arbeitet sich Grosvenor im Lauf des Romans an die Spitze der Befehlskette, stets im Gefühl, das Richtige zu tun (wobei ihm der Autor Recht gibt, indem er Grosvenor alle Probleme lösen lässt). Das liest sich aus heutiger Sicht durchaus gruselig – und kippt ins Komische, wenn ausgerechnet der allein gegen alle agierende Grosvenor über den ungezügelten Egoismus Einzelner schimpft, gemünzt natürlich auf seine Widersacher.
Obsolete Ansichten
Achtung ringt Grosvenor als Einziger ausgerechnet der Bord-Archäologe ab. Im Nachwort verweist der SF-versierte Politikwissenschafter Rainer Eisfeld darauf, wie stark van Vogt von den Thesen des Historikers Oswald Spengler beeinflusst war. Spenglers zyklisches Geschichtsbild wird hier in Bausch und Bogen auf vollkommen fremdartige Zivilisationen und Denkweisen angewandt – wieder mit unbeabsichtigt komischer Wirkung, etwa wenn die dominante Lebensform des vorangegangenen Universums der "bäuerlichen Entwicklungsstufe" zugeordnet wird. Die anthropozentrische Selbstherrlichkeit, mit der ein einziges Erklärungsschema über alles drübergestülpt wird, ist nicht nur ein geistiger Zwilling von Grosvenors Nexialismus-über-alles – sie wirkt heute auch ähnlich veraltet wie der Wissensstand des Romans in Sachen Physik.
Alles in allem war's also eine ambivalente Wiederbegegnung mit einem Stück Kindheit. Was seine philosophischen Aspekte anbelangt, lässt sich "Die Expedition der Space Beagle" heute nur noch als Zeitdokument lesen, als Einblick in die SF- und Ideengeschichte. Die kreativen Alien-Schöpfungen hingegen sorgen dafür, dass es nach wie vor als Abenteuerroman funktioniert. Beides zusammen ergibt eine auf jeden Fall interessante Lektüre.
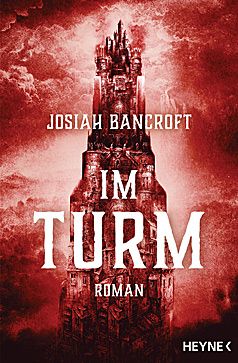
Josiah Bancroft: "Im Turm"
Broschiert, 448 Seiten, € 15,50, Heyne 2018 (Original: "Senlin Ascends", 2017)
Applaus für den Heyne-Verlag, der ein Risiko eingegangen ist und einen Fantasy-Roman weit abseits der gewohnten (und verkaufsträchtigen) Genre-Blaupausen veröffentlicht. Die Originalausgabe "Senlin Ascends" ist vor Kurzem erst in der Rundschau besprochen worden.
"Im Turm" führt uns in eine alternative Version der Erde, in der der Turm zu Babel immer noch steht und den Nabel der Welt bildet – in einer Epoche, die technologisch etwa dem Stand des 19. Jahrhunderts entspricht. Hauptfigur ist der Dorfschullehrer Thomas Senlin, der in seinen Flitterwochen das größte Bauwerk der Welt besuchen kommt und gleich nach der Ankunft seine frischangetraute Ehefrau in den Menschenmassen am Fuß des Turms verliert. Ebene für Ebene arbeitet er sich nun im Turm hoch, um sie wiederzufinden, wird in ein seltsames Abenteuer nach dem anderen verstrickt und wandelt sich dabei langsam vom Bücherwurm zum Action-Helden.
Der Roman, dem auf Englisch bereits zwei Fortsetzungen gefolgt sind (Erscheinen auf Deutsch derzeit noch nicht gesichert), besticht nicht nur mit einem höchst originellen Setting. Er bringt auch perfekt das Innere und das Äußere, das Metaphorische und das Greifbare in Einklang. Denn der Turm – an dem weit jenseits der Wolkendecke angeblich immer noch gebaut wird – ist ein Universum für sich, das alle seine Besucher in seinen Bann zieht und sie nicht mehr loslässt. Wer sich seinem Zauber einmal hingegeben hat, wird danach nicht mehr derselbe sein.
Nach der Turmbesteigung der Ausblick
Mit der Rundschau geht es im Oktober weiter. Der Rundschau-Buchclub könnte in der Zwischenzeit folgende Titel vorbereiten:
- "Weltenzerstörer" von Cixin Liu
- "Der Outsider" von Stephen King
- "Xeelee: Redemption" von Stephen Baxter
- "Once There Was A Way" von Bryce Zabel
Letzteres hat gerade den Sidewise Award für den besten Alternativweltroman gewonnen und dreht sich zur Abwechslung mal nicht um Hitler oder Kennedy, sondern um die Frage, was geschehen wäre, wenn sich die Beatles niemals aufgelöst hätten. Wie schon bei "Im Turm": Geht doch nichts über eine originelle Prämisse! (Josefson, 1. 9. 2018)
________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher