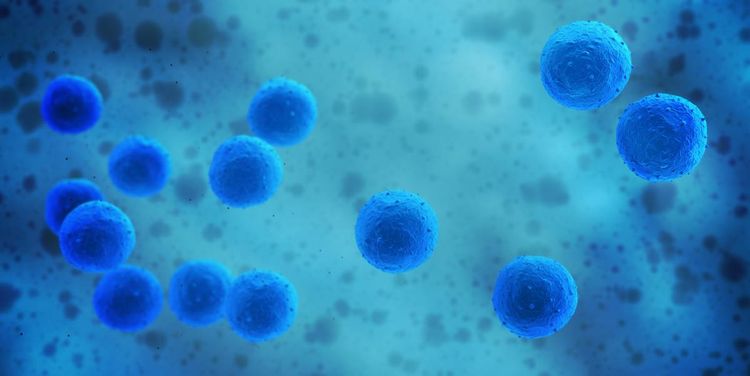
Wissenschafter der St.-Anna-Kinderkrebsforschung haben eine neue Methode entwickelt, um die "guten" T-Zellen einfacher und schneller als bisher zu vermehren.
Wien – Rund 185 Kinder erkranken in Österreich jedes Jahr an Krebs, über 60 Prozent davon an Leukämien. Bei diesen Blutkrebsarten werden große Mengen weißer Blutzellen gebildet, die das Immunsystem schwächen oder auch völlig blockieren. Um die Krebszellen im Blut zu zerstören, werden auch bei diesen jungen Patienten Chemotherapie und Bestrahlungen eingesetzt. Damit werden aber gemeinsam mit den Krebszellen auch alle anderen Zellen einschließlich der Stammzellen im Knochenmark ausgeschaltet.
Die Kinder brauchen also einen neuen Pool an Stammzellen, aus dem sich dann die nötigen Abwehrzellen gegen Virusinfektionen entwickeln können. Fehlen diese, kann schon der kleinste Schnupfen tödlich sein. Deshalb werden transplantierte Blutstammzellen von einem Spender als Therapie eingesetzt. Findet sich kein Spender, dessen Blutzellmerkmale mit jenen des Patienten übereinstimmen, können die Stammzellen etwa auch dem Blut eines Elternteils entnommen werden – selbst wenn dessen Blutzellmerkmale nur zur Hälfte mit jenen des kranken Kindes übereinstimmen.
"Da Stammzellen im Blut nur in geringen Mengen vorkommen, müssen sie aus dem Knochenmark quasi herausgelockt werden", erklärt der Immunologe René Geyeregger von der St.-Anna-Kinderkrebsforschung in Wien. "Das erfolgt durch einen körpereigenen Stoff – den Wachstumsfaktor G-CSF –, der dem Spender gespritzt wird." In dessen Blut sammeln sich dann aber nicht nur die "guten" virusspezifischen T-Zellen, sondern auch die potenziell gefährlichen alloreaktiven T-Zellen, die sich gegen den Empfänger richten könnten. Daher müssen vorerst alle Abwehrzellen vom Stammzellprodukt entfernt werden – auch die "guten". Das wiederum erhöht die Gefahr einer Viruserkrankung des Patienten, da zu Beginn noch kein Immunsystem vorhanden ist.
Jahrelange Vorarbeiten
In etwa achtjähriger Forschungsarbeit hat der Immunologe mit seinem Team ein neues zelltherapeutisches Verfahren entwickelt, mit dem es nun möglich ist, diese "guten" T-Zellen beträchtlich einfacher und schneller als bisher zu vermehren und gleichzeitig die "bösen" Zellen zu reduzieren. "Wir können mittels Zellkultur in zwölf Tagen aus sehr wenigen virusspezifischen T-Zellen sehr viele machen", so der Wissenschafter.
Dadurch können diese Zellen in einer Phase verabreicht werden, in der die Patienten noch kein funktionierendes Immunsystem gegen Viren besitzen. "Das ist eine massive Verbesserung, denn bisher waren die Methoden zur Herstellung virusspezifischer T-Zellen sehr kostenintensiv und dauerten bis zu zwölf Wochen." Außerdem müssen sich die Spender beim neuen Verfahren nicht mehr einer stundenlangen Zellsammlung unterziehen, da 100 Milliliter Spenderblut reichen, um daraus weiße Blutzellen zur Abwehr von Krankheitserregern zu isolieren.
Zwei Viren, die nach einer Stammzelltransplantation besonders gefährlich sind, stehen zurzeit im Fokus der Forschung: der Adenovirus und der Cytomegalovirus. Bei ihrem neuen Verfahren setzen die Forscher der Zellkultur mit den weißen Blutzellen aus dem Spenderblut Adenoviren in Form kleiner Peptid-Stücke zu. "Diese T-Zellen können im Patienten dann spezifisch gegen die mit Adenoviren infizierten Zellen vorgehen und ihn dauerhaft gegen das Virus schützen", erklärt Geyeregger. Und zwar ohne die gefährlichen Reaktionen auszulösen, die früher oft eine unerwünschte Nebenwirkung bei der Verabreichung von Spender-T-Zellen waren.
Erfolgreicher Heilversuch
Die Wiener Forscher waren 2012 weltweit die Ersten, die mit solcherart produzierten und optimierten Spender-T-Zellen einen Heilversuch unternommen haben. "Wir gaben unsere Zellen einem vierjährigen Kind mit Leukämie, das lebensbedrohlich an einer Infektion erkrankt war", erinnert sich der Immunologe. "Und es funktionierte, das Kind hat überlebt!"
Um allen Regulierungen des Arzneimittelgesetzes zu entsprechen, haben die Forscher ihre Methode inzwischen weiter verfeinert. Gelingt es ihnen, die Sicherheit und Wirksamkeit der neuen Zelltherapie nachzuweisen, darf man nicht nur auf höhere Überlebensraten bei Virusinfektionen nach einer Stammzelltransplantation hoffen, sondern auch auf deutlich verringerte Nebenwirkungen der Virusmedikamente.
Keine Tierversuche
Obwohl die klinische Studie bereits vor zwei Jahren begonnen hat, konnte das neue Verfahren bislang noch an keinem Patienten getestet werden. "Da es sich hier um relativ seltene Viruserkrankungen handelt, gibt es natürlich auch immer wieder Probleme, Studienteilnehmer zu finden", bekennt der Krebsforscher.
"Aus diesem Grund haben wir in unsere Studie zwei weitere Viren hineingenommen, die vor allem Patienten nach Organtransplantationen zusetzen: den Polyoma- sowie den Epstein-Barr-Virus. Hier konnten wir eine sehr spannende Kooperation mit Nephrologen der Med-Uni Wien aufbauen", sagt Geyeregger, der seit vergangenem Jahr das Forschungsteam Clinical Cell Biology and FACS Core Unit an der St.-Anna-Kinderkrebsforschung leitet.
Was ihn an dieser Arbeit fasziniert, ist nicht zuletzt die Bearbeitung komplexer und überlebenswichtiger Fragestellungen sozusagen von "bench to bedside", also von der In-vitro-Kultur bis hin zum fertigen Medikament. Und das alles ohne Tierversuche, was in der medizinischen Forschung durchaus nicht die Regel ist: "Da es kein Tiermodell gibt, wo man die von uns untersuchten Viren einsetzen könnte, wären Tierversuche bei unserer Forschung völlig sinnlos", so der habilitierte Immunologe. "Für mich persönlich ist das ein großes Glück." (Doris Griesser, 19.10.2018)