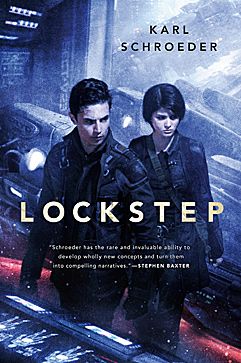
Karl Schroeder: "Lockstep"
Gebundene Ausgabe, 351 Seiten, Tor Books 2014
Nichts kann schneller sein als das Licht. Mehr und mehr SF-AutorInnen sind im vergangenen Jahrzehnt dazu übergegangen, diese Tatsache zu schlucken und auch auf bequeme Schlupf- bzw. Wurmlöcher zu verzichten. Damit entfällt aber leider auch ein traditionelles Kernstück der Science Fiction, die Idee vom interstellaren Imperium. Sollte man jedenfalls meinen. Es war an Karl Schroeder, das scheinbar Unvereinbare doch zu vereinbaren. Mit seinem jüngsten Werk "Lockstep" zeigt der kanadische Autor der "Virga"-Romane einmal mehr, dass Science Fiction eine Literatur der Ideen ist ... und sich tatsächlich immer noch neue finden lassen.
Das Lockstep-System
Der Trick, der's möglich macht, ist verblüffend einfach: Zehntausende Welten gehen samt all ihren BewohnerInnen synchron in den Kälteschlaf und tauchen daraus nur für kurze Wachphasen wieder auf: Ein Monat Aktivität, 30 Jahre Stasis - auf diese Weise können die gewaltigen Entfernungen zwischen den Kolonien gleichsam über Nacht überbrückt werden. Niemand trifft nach Reise und Rückkehr auf stark gealterte Mitmenschen, alle leben im selben Rhythmus. Das ermöglicht nicht nur ein Handelsnetz, das allseitige Prosperität garantiert. Es schont auch die mageren natürlichen Ressourcen der besiedelten Welten. Die können ganz sanft über Jahrzehnte hinweg abgebaut werden, um einen Monat Leben zu ermöglichen: "We live like arctic flowers, with a short growing season and long winter", wie es ein Angehöriger des Lockstep-Systems ausdrückt.
Natürlich reichen 30 Jahre nicht für einen Unterlichtflug quer durch die Galaxis. Das immerhin 70.000 Planeten umfassende Lockstep-Imperium erstreckt sich deshalb auch nur von den Ausläufern unseres Sonnensystems wie Sedna oder Makemake bis nahe an die nächsten Sterne heran. Doch mittlerweile wissen wir ja, dass sich zahlreiche Nomadenplaneten durch den lichtlosen interstellaren Raum bewegen. Deren Zahl schätzt Schroeder zugegebenermaßen hoch ein - aber wer will ihm das Gegenteil beweisen?
Das Szenario
"High Concept" nennen sich Story-Ideen wie diese. Und Schroeder versteht es noch in anderer Hinsicht, scheinbare Gegensätze unter einen Hut zu bringen: Nämlich im Rahmen von wissenschaftsorientierter Hard SF zeitlose Plots zu entwerfen, auf die auch die Fantasy gerne zurückgreift: Temporeiche Abenteuer, persönliche Vendettas und verzwickte Familiengeschichten - sogar das Motiv vom Auserwählten taucht hier auf (wenn auch im nüchternen Kontext einer gezielt gesteuerten Religion à la Bene Gesserit).
Im Mittelpunkt der Handlung steht der 17-jährige Toby Wyatt McGonigal, der in der nahen Zukunft zu einem Kometen geschickt wird, um diesen für seine Familie in Besitz zu nehmen, und dabei einen Unfall erleidet. Als er aus seiner Stasis erwacht, findet er sich in einer fremden Welt wieder und erfährt, dass deren Herrscher seinen Tod befohlen hat. Gefolgt von der Erkenntnis, dass dieser Herrscher sein Bruder Peter ist. Ganz zu schweigen von der sinnverwirrenden Tatsache, dass für Toby nur ein paar Stunden vergangen sind, für seine im Lockstep-System lebende Familie 40 Jahre - und für das Universum außerhalb satte 14 Jahrtausende.
Wunder in Zeit ...
Schroeders großes Zeitverschiebespiel ist natürlich der Hauptreiz des Romans. In den 14.000 Jahren, die außerhalb des Lockstep-Imperiums vergangen sind, haben sich auf den sogenannten fast worlds zahllose Zivilisationen entwickelt und sind wieder untergegangen. Der Roman erinnert von seiner Grundidee her unwillkürlich an Philip Josè Farmers "Dayworld" - was die Komponente geschichteter Zivilisationen betrifft, zeigen sich hingegen Parallelen zu Alastair Reynolds "Haus der Sonnen".
Das zeitlose Lockstep-Imperium hat sich in diesem ständigen Zyklus des Werdens, Wachsens und Vergehens wie eine Default-Einstellung der Menschheit erhalten, in die sich Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Zeitaltern retten konnten und so das Reich vergrößert haben. So ist es auf gewisse Weise uralt, obwohl es für seine Gründergeneration erst 40 Jahre auf dem Buckel hat. Und zu allem Überfluss gibt es nebem diesem Lockstep-Imperium noch andere, die sich teilweise mit ihm die Planeten teilen, aber in einem anderen Wach-Schlaf-Rhythmus leben.
... und Raum
Auch räumlich hat Schroeder aber einiges zu bieten. Da hätten wir zum Beispiel einen Planeten, der seine Edelgas-Atmosphäre kurzerhand in eine gigantische Neonröhre umgewandelt hat. Eine Welt am Rande der Laser Wastes, deren Himmel über Laserstrahlen aus dem nächsten Sternsystem beschienen wird. Einen Gasriesen, in dessen stürmischer Atmosphäre ganze Trauben bewohnter "Seifenblasen" schweben. Oder einen Planeten, auf dem ein endloser Pilgerstrom am Schrein von Tobys Mutter vorbeizieht - und dabei einen Choral singt, der seit 10.000 Jahren nie verstummt ist.
Zwischendurch ist dann sogar noch Platz für augenzwinkerndes Spielen mit der Genregeschichte. Mit einem Verweis auf Edgar Rice Burroughs beginnt der Roman - und greift dies später noch einmal auf, wenn sich Toby mit seiner Queste-Gefährtin Corva Keishion über einen ganz speziellen Planeten unterhält: "I thought Barsoom was a storybook name for Mars." - "Mars?" She rolled the word around in her mouth. "Maaaars. Never heard of it. But how can you not know about Barsoom? It's the capital - you know, the fourth planet of the solar system. Covered in ancient ruins and dried-out canals from all kinds of terraforming attempts. The water always drains away, but every thousand years or so somebody drops another comet on it and tries again. The inside of the planet's getting quite wet at this point!"
Für alle Altersgruppen
Schwer zu sagen, ob man "Lockstep" unter "Young Adult" führen soll. Wenn ja, dann nicht allein wegen des jugendlichen Alters seiner beiden Hauptfiguren. Es gibt auch andere "Light"-Elemente wie z.B. die denners, eine Art genmodifizierte Katzen, die für die Handlung eine wichtige Rolle spielen ... welche aber auch von etwas weniger Niedlichem ausgefüllt hätte werden können. Oder der Umstand, dass Tobys Familien-DNA ihm ungeahnte Zugriffsmöglichkeiten auf die Lockstep-Technologie ermöglicht: It was like playing Consensus in God mode, except that this was reality. "Consensus" ist übrigens der Name eines Computerspiels, das Toby einst gemeinsam mit Peter entwickelt hat - und das im Lockstep-Imperium eine real existierende Ausformung angenommen zu haben scheint. Und abschließend ist Peters Diktatur trotz einiger fragwürdiger Entscheidungen auch nicht gerade die grausamste, von der man in der Science Fiction je gelesen hat. Was auch zu einem recht zivilisierten Showdown führt.
Das alles sind YA-typische Elemente. Erwachsener ist hingegen das Thema Ökonomie, das sich durch den ganzen Roman zieht. Siehe etwa die endgültige Polarisierung des irdischen Wirtschaftssystems während Tobys erstem Leben: Hier die alles kontrollierende Oligarchie der Billionäre - dort die verarmte Rest- bzw. Gesamtmenschheit. Oder die strikten Entwicklungslimits, die den kalten Lockstep-Welten von ihrer Ressourcenausstattung her gesetzt sind. Solche Züge - und natürlich die atemberaubende Prämisse des Romans selbst - werden auch ältere LeserInnen ansprechen. Kurz: "Lockstep" hat für alle was zu bieten.
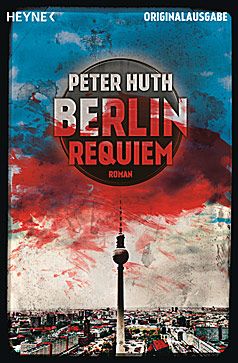
Peter Huth: "Berlin Requiem"
Broschiert, 336 Seiten, € 13,40, Heyne 2014
Im Südwesten ein Schuss. Sarah zieht an der Zigarette. Erstaunlich, wie schnell man sich an das Geräusch von Schüssen gewöhnt. Etwas stirbt, und man hört weg. Zu Beginn von Peter Huths "Berlin Requiem" ist der Ernstfall bereits eingetreten, hat sich aber noch nicht zur globalen Apokalypse ausgewachsen: Im Einband des Romans ist eine Karte der betroffenen Berliner Bezirke - die mit einer Betonmauer und Wachtürmen abgeriegelte Kontrollierte Zone - eingezeichnet. Hm, wenn ich in Berlin bin, ist das genau die Gegend, in der ich einen Großteil meiner Zeit verbringe. So schnell sitzt man in der Falle!
Ach ja: welcher Ernstfall? Na Zombies natürlich, man gönnt sich ja sonst nichts. Wobei Peter Huth zu denen gerechnet werden darf, die das Modethema mit einem eigenen Drall versehen haben. Und wie man es von einem Journalisten erwarten darf - Huth ist Chefredakteur der B.Z. -, handelt es sich dabei um eine politische Komponente. "Berlin Requiem" kleidet das untote Thema in eine Polit- und Mediensatire. Nicht dass das etwas grundsätzlich Neues wäre - gerade die Anfänge des modernen Zombieismus (also schlurfende Massen statt Voodoo-Einzelgänger) waren ja mehr oder weniger unterschwellige gesellschaftskritische Kommentare; siehe George A. Romero. Huth geht das bloß ein Stück offensichtlicher an.
Blondes Haar schützt nicht vor dem Untod
Huths Knüller ist der Umstand, dass das Lazarus-Virus, das die Toten wieder aufstehen und um sich beißen lässt, nur Menschen mit Migrationshintergrund zu befallen scheint. Scheint, wie gesagt - wir bekommen rasch zu lesen, was wir ohnehin geahnt haben: nämlich dass das kompletter Schmafu ist. Alle können sich anstecken. Aber darum geht es auch nicht. Sondern darum, dass diese Idee verbunden mit dem Stichwort Türken-Gen gezielt in die Welt hinausposaunt wurde und nun ihre Wirkungsmacht entfaltet.
Schon bald werden da Gedanken ausgesprochen, wie man sie nur allzu gut kennt: "Ali ist also ein guter Türke, ein Kumpel. Problematisch wird es, wenn die zu, sagen wir mal, dritt sind oder zu viert. Irgendwie werden die dann ... lästig. Aufdringlich. Das geht schon mit der Musik los und den Autos. Diese Karren, die die haben, mit den fetten Anlagen. Das ist doch total asozial, finde ich. Immer so, dass es jeder hören muss. So laut. So aufdringlich, auch wenn die vor der Ampel stehen. Die gucken dich an, als ob sie Streit suchen." Was lange Zeit zumindest nicht öffentlich ausgesprochen werden durfte, kommt nun an die Oberfläche. Und spätestens wenn eine aufgebrachte Menge zum Sturm auf die abgeriegelten Bezirke Kreuzberg und Neukölln bläst und "Wir oder die!"-Schilder schwenkt, stellt sich die Frage: Sind da noch Zombies gemeint?
Das klingt jetzt vielleicht nach einem gewagten Geniestreich Huths - ganz so ist es dann aber auch wieder nicht. "Berlin Requiem" wabert beständig zwischen "Traut sich was" und "Das war jetzt doch wieder inkonsequent" herum. Manches ist treffsicher, manches ziemlich platt. Wenn beispielsweise der Gedanke geäußert wird, dass die Zombies womöglich erst durch die Angriffe auf sie aggressiv wurden und "man sie doch einfach unter uns leben lassen könnte", dann ist das kaum weniger plakativ als der Umstand, dass Kontrollierte Zone abgekürzt KZ ergibt. Oder die neue Mauer samt Schießbefehl. Andererseits muss ja auch nicht jede Satire mit der feinen Klinge vorgehen ... und bei Zombies verbietet sich das vielleicht eh von selbst.
Die ProtagonistInnen
Soweit das Gesamtgeschehen, die Hauptfiguren sollte man natürlich auch nicht vergessen. Da hätten wir den Enthüllungsjournalisten Robert Truhs, dem die Wahrheit über das Lazarus-Virus zugespielt wird, die Talkshow-Moderatorin Sarah Samir, die vor laufenden Kameras die Beherrschung verliert und sich anschließend zu ihrer Familie mitten in der Kontrollierten Zone flüchtet (schlechteste Idee des Jahres) sowie den Medienunternehmer Christian von Posen: Alle drei arbeiten für denselben Berliner Stadtsender, zugleich sind sie durch eine komplizierte gemeinsame Vergangenheit - inklusive eines Falls von Schusswaffengebrauch - auch privat miteinander verbunden.
Eine wichtige Rolle spielt außerdem der Politiker Olaf Sentheim, der von Truhs einst wegen eines Skandals zu Fall gebracht wurde, nun aber - eher aus Berechnung als aus Fremdenhass - auf der Anti-Ausländer-Welle reitet und in eine neue Machtposition gespült wird. Er hält sich für den Strippenzieher schlechthin, doch steht ihm noch eine bittere Erkenntnis bevor. Sentheim, der ein Buch mit polemischen gesellschaftlichen Thesen veröffentlicht hat, erinnert nicht zu knapp an Thilo Sarrazin und sein "Deutschland schafft sich ab" - aber auch andere Politprominenz wie etwa Karl-Theodor zu Guttenberg geistert im Roman kaum vermummt durchs Bild und vervollständigt das Panorama.
Dass alle wesentlichen Figuren aus dem Bereich stammen, in dem Macht, Geld und öffentlicher Einfluss zusammenfließen, ist natürlich kein Zufall. Denn eigentlich ist "Berlin Requiem" kein Zombie-, sondern ein Spindoktoren-Roman. Wer es schafft, einem Thema in der Öffentlichkeit seinen Stempel aufzudrücken, der hat den Weg zum Erfolg schon fast geschafft. Im Grunde könnte es auch eine ganz andere Sache sein, die all die Geier aus Politik, Wirtschaft und Medien kreisen lässt - hier sind es eben Zombies. Und wie gut man selbst aus einer Apokalypse Kapital schlagen kann, zeigt der böse Schluss.
Kein Meisterwerk, aber lesenswert
In seinem Bemühen, den Zeitgeist einzufangen, hat "Berlin Requiem" was von Popliteratur. Man merkt, dass Huth Journalist und nicht Romancier ist, was aber keineswegs negativ gemeint ist. Die knappe Sprache hat ihren Reiz und zumindest ich habe an Huths Stil rein gar nichts auszusetzen. Abgesehen von der einen Sache, dass hier alle, sogar Mediziner, ständig der Virus sagen, was mich echt wahnsinnig macht.
Das letzte Spannungselement von "Berlin Requiem" schließlich liegt weitgehend außerhalb von Huths Einflussmöglichkeiten: Wie wohl eine Verfilmung aussähe? Ein Helmut-Dietl-Politikum wäre da genauso drin wie ein Action-Zweiteiler mit Heiner Lauterbach.
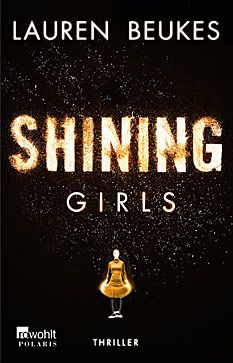
Lauren Beukes: "Shining Girls"
Klappenbroschur, 398 Seiten, € 15,50, Rowohlt 2014 (Original: "The Shining Girls", 2012)
Die südafrikanische Autorin Lauren Beukes hat sich mit ihren ersten Genreromanen rasch in die Herzen von Kritik und Publikum geschrieben: 2008 "Moxyland" (Science Fiction), gefolgt von "Zoo City" (Alternate History mit Fantasy-Elementen) und schließlich "The Shining Girls". Dass dieses Werk als erstes ins Deutsche übersetzt wurde, liegt wohl weniger daran, dass es im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht mehr in Beukes Heimatland angesiedelt ist. Sondern eher daran, dass es seine Genrezugehörigkeit so durchlässig gestaltet, um auch für ein Mainstreampublikum lesbar zu bleiben.
Dabei ist es nicht nur - siehe Coverzusatz - ein "Thriller", sondern auch eine Zeitreisegeschichte. Zudem eine von der besonders gelungenen Sorte: Schon lange mehr kein derart hermetisch in sich geschlossenes Geflecht von rückwirkenden Kausalitäten gelesen. Das ist beeindruckend!
Duell durch die Dekaden
"Shining Girls" ist ein sich über knapp 400 Seiten erstreckendes Duell zweier Hauptfiguren, deren eine zunächst noch ein nichtsahnendes Kind ist: die 1967 geborene Kirby Mazrachi aus Chicago. Bei der ersten Begegnung mit ihrem späteren Gegner - einer verstörenden Vorahnung auf Späteres - ist sie erst sechs, zeigt aber schon Ansätze eines starken Charakters. Beukes gelingt es, Kirby als plastische Figur zu zeichnen. Kirbys Gegenspieler hingegen wird weitgehend eine Leerstelle bleiben, doch das gehört unmittelbar zur Anlage des Romans.
Harper Curtis heißt dieser Mann. Er lebt ebenfalls in Chicago - und zwar zur Zeit der Großen Depression der 30er Jahre. Über seinen Hintergrund erfahren wir kaum etwas - zumindest aber, dass er schon einige Menschenleben auf dem Gewissen hat, bevor aus ihm ein Frauen-Serienmörder wird.
... also zu einer Zeit, in der Begriffe wie bevor und danach noch Sinn machen. Denn das ändert sich an dem Tag, an dem Harper von einer (inneren oder äußeren?) Stimme zu einem verlassenen Haus am Stadtrand geführt wird. In diesem Haus findet er nicht nur eine Sammlung von Gegenständen aus verschiedenen Zeitaltern, die sich in seiner Vorstellung zu einem Muster verknüpfen. Er stellt auch fest, dass er das Haus zu verschiedenen Zeitebenen hin verlassen kann. Beim Durchschreiten der Haustür kann er nach Belieben jeden Tag von 1929 bis 1993 betreten. Darüberhinaus kann er nicht pendeln (aus gutem Grund, wie sich am Schluss zeigen wird). Aber diesen Spielraum nutzt er aus und mordet sich durch die Dekaden.
Die Opfer
Unter seinen Opfern - den "Shining Girls" des Titels - finden sich so unterschiedliche Frauen wie Zora, eine Schweißerin aus dem Zweiten Weltkrieg. Die lesbische Architektin Willie aus der McCarthy-Ära, die in Angst vor politischer Verfolgung lebt. Oder Margot, die Anfang der 70er Jahre Beistand bei Schwangerschaftsabbrüchen leistet, als diese noch illegal sind. Stets hinterlässt Harper einen Alltagsgegenstand bei seinen Opfern, den er der seltsamen Kollektion des Hauses entnommen hat, und nimmt dafür ein anderes "Souvenir" mit.
Es scheint kein verbindendes Element zwischen all diesen Frauen zu geben - bis auf den Umstand, dass sie alle entschlossen waren, etwas aus ihrem Leben zu machen. Selbst wenn sie dies auf so selbstzerstörerische Weise taten wie Nackttänzerin Klara aus den 30ern, die ihren Körper mit Radium einpinselte, damit er schön leuchtet. Ein rein metaphorisches Leuchten hingegen ist es, das Harper zu seinen Opfern zieht und das er auslöschen will.
Die Rächerin
Auch Kirby wurde Jahre nach ihrer ersten Begegnung mit Harper zu seinem Opfer - allerdings hat sie als Einzige mit knapper Not überlebt. Körperlich und seelisch gezeichnet, ist sie wild entschlossen Harper aufzuspüren. Um an Archiv-Wissen zu gelangen (wir sind noch in der Prä-Internet-Ära), beginnt sie ein Praktikum bei einer Zeitung. Woraus sich auch noch eine rührende Doch-nicht-Liebesgeschichte mit dem g'standenen Sportreporter Dan Velasquez entspinnt, aber das sei nur am Rande erwähnt. Die Atmosphäre in einem Newsroom der auslaufenden analogen Ära zeichnet Beukes übrigens ebenso nachlebbar wie Kirbys vielschichtige Beziehung zu ihrer Mutter - eine der Stärken der Autorin.
Kirby recherchiert indes unerbittlich weiter - hat aber natürlich solange keine Chance Harper zu finden, wie sie am gewohnten chronologischen Denken festhält. Wie sollte sie auch wissen, dass die Ereignisse für Harper einen völlig anderen Zeitablauf haben als für den Rest der Menschheit?
Kein simpler Krimi
Dass das als "Thriller" deklarierte "Shining Girls" diese Zeitsprünge mitabsolviert, mag eine erste Hürde für KrimileserInnen sein. Mehr noch als der Aufbau könnte sie aber stören, dass ihnen hier nicht die krimitypischen Informationen zu Motiv und Täterpsychologie geliefert werden. Harper tut das, was er tut, weil er es schon getan hat. Bezeichnend eine Passage, in der er am äußersten Ende seines zeitlichen Reisespektrums eine Leiche in einem Müllcontainer verstecken will - und feststellt, dass schon jemand drinliegt, den er noch gar nicht getötet hat. Was ihn jedoch keine Sekunde lang stutzig macht: Das sollte Harper überraschen. Aber seine Vorstellungskraft ist begrenzt. Diese Leiche ist hier, weil es so sein soll, und das genügt.
In Zeitreisephilosophie versierte SF-LeserInnen werden mit dem Konzept von self-fulfilling prophecies und Kausalschleifen sicher keine Probleme haben. Und für sie liefert Beukes ein Beispiel exzellenter Konstruktion ab, in der am Ende alle sich selbst bedingenden Faktoren ineinandergreifen. Ok, bis auf den einen Umstand, dass ungeklärt bleibt, warum das Haus Zeitreisen überhaupt ermöglicht. Aber man kann ja nicht alles haben. - Ende des Jahres wird Rowohlt übrigens auch "Zoo City" auf Deutsch herausbringen, das darf man sich schon mal im Kalender eintragen!
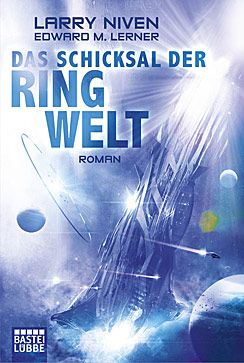
Larry Niven & Edward M. Lerner: "Das Schicksal der Ringwelt"
Broschiert, 525 Seiten, € 10,30, Bastei Lübbe 2014 (Original: "Fate of Worlds", 2012)
Let's do the time warp again! Mit dem vorliegenden Band ist die "Fleet of Worlds"-Prequel-Reihe zu Larry Nivens legendären "Ringwelt"-Romanen zu einem echten Sequel weitergeschritten: Wir schreiben das Jahr 2893 und befinden uns damit zeitlich nach allen anderen Romanen aus dem literarischen Kosmos des Known Space, auf die es in "Das Schicksal der Ringwelt" zahllose Querverweise gibt.
Bitte bewahren Sie den Durchblick!
Auch ganz ohne Zeitreisemöglichkeiten strecken diese Verbindungen ihre Ranken wie Kudzu quer durch die Jahrhunderte. Dafür sorgen chronologieverwirbelnde Elemente wie Stasis, Dilatationsflüge, wiederholtes Sterben und Wiederauferstehen oder die Verjüngungsdroge Boosterspice - da kann man es schon mal mit Urenkeln zu tun bekommen, die älter aussehen als man selbst. Und wenn dann noch ein Rest von guter alter Linearität vorhanden ist, dann wird der garantiert durch eine von den Puppenspielern gedeichselte Gedächtnismanipulation zerschmettert: Jener Spezies, der Larry Niven vermutlich selbst angehört. Denn er ist der Meister der Retroactive continuity, des rückwirkenden Anpassens und Veränderns von Fakten - fast nichts bleibt dauerhaft so, wie man es zu kennen glaubt.
Kurz: Ziemlich kompliziert, das Ganze. Etwa so, als hätten die Macher von "Saw" ein "Crisis on Infinite Earths"-Szenario für die "Lindenstraße" geschrieben und das in die Wookieepedia hineingequetscht. Am liebsten möchte man in einen Autodoc steigen und - wie es hier "Ringwelt"-Langzeitprotagonist Louis Wu erlaubt wird - sein Gedächtnis wiederherstellen lassen.
Das Ausgangsszenario
Ein paar Stichworte, direkt dem Text entnommen, was sich in Vorgängerbänden wie "Der Krieg der Puppenspieler" oder "Verrat der Welten" so alles ereignet hat: Gefährliche Zeiten, heruntergekommene Schiffe und wagemutige Rettungsmissionen. Der Überfall auf die Invasionsflotte der Pak, um deren Bibliothek zu stehlen. Raumfahrende Seesterne, die einen Bruderkrieg führten. Geistesgestörte Puppenspieler, die Planetenbrecher einsetzten, angeführt von einem Soziopathen. Eine in den Weiten des Alls verlorene Kolonie, von der niemand wusste, die Heimat von Millionen Menschen. Abenteuer und Gedächtnisverlust, beides eng miteinander verwoben.
All das haben die Hauptfiguren der vergangenen Bände erlebt und sehen sich nun mit den Folgen konfrontiert. Wie der Abenteurer Louis Wu, der unter anderem feststellen muss, dass er nun zwei Familien auf zwei Planeten hat. Sigmund Ausfaller, der ehemalige Verteidigungsminister der Kolonie New Terra, dessen Paranoia die neue Regierung nicht mehr zu brauchen glaubt - bis sie sich einmal mehr als angebracht erweist. Die beiden Puppenspieler Nessus und Baedeker, die ihre Heimatwelt Hearth retten wollen und dabei höchst speziesuntypischen Wagemut beweisen. Und ihr irrer Artgenosse Achilles, der immer mehr zum dreibeinigen und zweiköpfigen Gröfaz mutiert. - Kleiner Tipp: Am besten weniger darauf achten, wo die Genannten handlungstechnisch alle herkommen, sondern darauf, was sie jetzt tun.
Welten am Scheideweg
Und noch ein Tipp: Am Originaltitel orientieren, nicht am deutschsprachigen. Denn die Ringwelt ist im letzten echten "Ringwelt"-Roman "Ringworld's Children" ("Hüter der Ringwelt") in den Hyperraum entführt worden, um zu vermeiden, dass das Sechshundert-Millionen-Meilen-Umfang-Prachtstück im Hickhack der galaktischen Mächte zerstört wird. Und sie bleibt auch in diesem Roman hier im Off, ihr Schicksal ungewiss.
Stattdessen geht es in "Fate of Worlds" um New Terra einerseits und um Hearth andererseits. Die verlorene Menschen-Kolonie muss sich entscheiden, ob sie nach Jahrhunderten unfreiwilliger Isolation überhaupt wieder Kontakt zur Urheimat Erde haben will - da gehen die Meinungen weit auseinander. Während Hearth zum neuen Ziel der galaktischen Kriegsflotten wird, nachdem man ihnen die Ringwelt quasi unterm Hintern weggezogen hat.
Die armen Puppenspieler! Jahrhunderte des galaktischen Intrigenspinnens fallen ihnen nun auf den Doppelkopf. Schlimm genug, dass Hearth insgeheim längst von einer Spezies kontrolliert wird, die man einst aus Angst vor deren Potenzial ausrotten wollte, den Gw'oth. Es scheint nur gerecht, dass diese nun ihrerseits die Puppenspieler lenken ... doch laufen die grauen Eminenzen langsam aus dem Ruder. Sowohl das Gw'oth-Kollektiv selbst als auch die von ihm installierte KI Proteus verlieren sich immer mehr in intellektuellen Gedankenspielen, während Hearth zwischen Invasionsflotten und Achilles' Irrsinn zerrieben zu werden droht. Die Vernichtung des Planeten und seiner Bevölkerung von einer B-i-l-l-i-o-n Puppenspieler ist nicht mehr undenkbar. Aber wie man in die Galaxis hineinruft ...
Ende? Wer redet hier von Ende?
Wie schon "dezent" angemerkt: Für einen Neueinstieg ins Universum des Known Space taugt "Das Schicksal der Ringwelt" eher nicht. Und für uns alte Hasen? Nun, bevor ich einen Gedanken an Kategorien wie gut / mittelprächtig / nicht so dolle verschwenden konnte, war ich erst mal 150 Seiten lang damit beschäftigt, mir all die Ereignisse ins Gedächtnis zu rufen, auf die hier angespielt wird, als wär's erst gestern gewesen. Allerdings sind diese 150 Seiten wie im Flug vergangen: ein positives Zeichen, denn ich langweile mich schnell.
Und so ging's dann auch weiter: Mit einem Getümmel aus Geheimplänen, Countdowns, Weltraumgefechten (zumindest gegen Ende hin), Insiderwitzen, Twists und Deus-ex-Machina-Lösungen am laufenden Band. Aber ist "Das Schicksal der Ringwelt" nun ein würdiger Abschlussband sowohl des "Fleet of Worlds"- als auch des alten "Ringworld"-Zyklus? Ach was, die Frage stellt sich gar nicht erst. Mit Blick auf das Romanende und Larry Nivens noch nicht sonderlich fortgeschrittenes Alter von 76 Jahren müsste ich mich doch sehr wundern, wenn damit das letzte Wort zur Ringwelt gesagt wäre. "Abschlussband", ha!
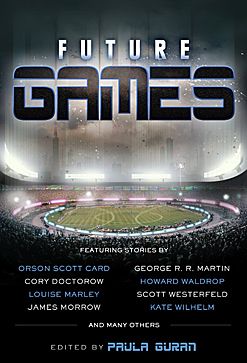
Paula Guran (Hrsg.): "Future Games"
Broschiert, 371 Seiten, Prime Books 2012
In Brasilien rollt der Ball - da bietet es sich an, einen Blick auf die Zukunft des Sports zu werfen. Wenn Sport in der Science Fiction auftaucht, scheint er sich im Wesentlichen um zwei Grundtypen herum zu gruppieren. Variante a): brutaler Wettkampf als überspitzte Ausformung eines dystopischen Systems. Das zieht sich von Pierre Pelots "Olympischem Krieg" und William Harrisons "Roller Ball Murder" über Gary K. Wolfs "Killerbowl" und Koushun Takamis "Battle Royale" bis zu Suzanne Collins' "Hunger Games" quer durch die SF-Geschichte. Variante b): Freizeitspaß, mag er nun Parrises Squares ("Star Trek") oder Pyramid ("Galactica") heißen - ganz zu schweigen von all den Varianten mit einem schwebenden Ball, die je nach Roman oder Comic unter unterschiedlichen Bezeichnungen daherkommen: "Aeroball", "Magnoball", you name it. Anders als bei Variante a) ist Sport hier nur ein Ausstattungsdetail, das für ein bisschen Exotik sorgen soll.
Kaum jemals ist Sport Hauptthema und positiv besetzt (und wenn ich mir so die Convention-Fotos mit den versammelten SF-AutorInnen ansehe, dann könnte ich den Grund dafür ... nein, das war jetzt fies). Wer Ausnahmen kennt, bitte posten - würde ich gerne lesen! Die US-amerikanische Herausgeberin Paula Guran jedenfalls ist in diese Lücke vorgestoßen und hat eine SF-Anthologie zum Thema Sport und Games zusammengestellt. Eigentlich hauptsächlich in Fantasy und Horror zuhause, war sie hier zur Abwechslung mal rein SFisch unterwegs. Und die insgesamt 16 Kurzgeschichten aus dem Zeitraum von 1965 bis 2008 decken eine große Bandbreite ab. Von lustig über spannend und blutig bis zu philosophisch ist da alles dabei.
Originelle Highlights
Gleich die Eröffnungsgeschichte "Will the Chill" des großen John Shirley lässt obiges Schema weit hinter sich und denkt in wesentlich größeren Bahnen: Immerhin lassen hier sogenannte waveriders gleich ganze Planeten gegeneinanderkrachen: ein kosmisches Eierpecken. Obwohl schon 1979 geschrieben, erinnert die Erzählung mit ihrem Mix aus Hard SF und Technozauberei an moderne Romane wie Dietmar Daths "Pulsarnacht" oder Hannu Rajaniemis "Quantum". Originell auch Howard Waldrops "Man-Mountain Gentian", in dem Sumo-Ringer mit herrlichen Namen wie Ground Sloth Ikimoto oder Knockdown Krugerrand ihre telekinetischen Kräfte gegeneinander richten. Beide Erzählungen beschränken sich aber nicht auf den Exotik-Faktor, sondern fokussieren auf das Menschliche: Bei Waldrop geht es um Fairness und Traditionsbewusstsein, bei Shirley um Reue und die Sehnsucht nach Transzendenz.
Ein Highlight ist auch Maya Kaathryn Bohnhoffs "Distance", das lange Zeit nach einer kompletten Themaverfehlung aussieht - wenn auch eine der vergnüglichen Art. Darin meldet sich die alte Sonde "Pioneer 10" wieder und sendet vom Rand des Sonnensystems Zahlenkolonnen, die niemand interpretieren kann. Das Thema der Anthologie lässt uns natürlich eine gewisse Richtung ahnen, trotzdem bleibt's spannend bis zum Schluss.
Von Ender zu Anda
Mit Orson Scott Cards "Ender's Game" ist auch ein echter Klassiker der SF vertreten. Es handelt sich um die 1977 veröffentlichte Kurzgeschichte, aus der später ein Roman, ein Zyklus und schließlich ein Film, der weitgehend unbemerkt durch die Kinos ging, entsprangen. Viel muss man zu der Erzählung um Kindersoldaten, die für das Militär der Zukunftserde Raumschiffe gegen den interstellaren Feind lenken, nicht mehr sagen. Auch der Schlusstwist um das beste "Spielergebnis" des genialen Jungen Ender dürfte bekannt sein.
Sehr viel sympathischer finde ich die Erzählung, die Cory Doctorow drei Jahrzehnte später in Anlehnung an Card "Anda's Game" genannt hat. Auch hier führen Kinder in der virtuellen Welt einen Krieg, der eine durchaus reale Seite hat: Die Avatare, die sie da zu hunderten abschlachten, gehören nämlich zu den Arbeiterinnen eines Sweatshops in Mexiko, die mit Handlangerdiensten für faule Gamer ihr täglich Brot verdienen. Eine Idee, die Doctorow übrigens der Realität entnommen hat. Das Thema ist für ihn ebenso typisch wie die Auflösung des Konflikts am Schluss. Doctorow und Card sind beides Autoren, die mit ihren politischen Ansichten nicht hinterm Berg halten. Während Card allerdings die Gabe hat, laufend im Trüben zu fischen (Homo-Ehe schlecht, Klimawandel eine Erfindung ...) und sich dann halbherzig dafür zu entschuldigen, bleibt Netzaktivist Doctorow seiner Linie treu: Unerbittlich auf die Gefahren unserer wirtschaftsgesteuerten Überwachungswelt hinzuweisen und dabei doch stets optimistisch bleiben, dass man etwas tun kann.
Fremde Wesen, noch fremdere Sportarten
"Future Games" ist (leider) eine US-amerikanische Anthologie, das schlägt sich natürlich in den ausgewählten Sportarten nieder. (Fußball kommt übrigens nicht vor.) Und führt zu der ungewollten Pointe, dass Sport hier gleich in mehreren Erzählungen zur Verständigung zwischen Menschen und Aliens führt ... was aber nur für Menschen gilt, die die Regeln von Baseball oder American Football intus haben. Etwa in "Unsportsmanlike Conduct" von "Leviathan"-Autor Scott Westerfeld oder "Run to Starlight", einem Frühwerk von George R. R. Martin: Darin will eine diplomatische Delegation von Aliens, gegen die man vor kurzem noch Krieg führte, ein Team in die Football-Amateurliga entsenden und sorgt damit für einiges Bauchweh. Beide Erzählungen, und noch viele weitere in dieser Anthologie, setzen auf ausführliche Beschreibungen von Abläufen - eine interessante Parallele zu Military SF. (Und ein kleines Problem für europäische LeserInnen, die mit diesen Abläufen und Regeln nicht vertraut sind.)
In idealer Weise verknüpft George Alec Effinger Spielablauf, Psychologie und SF-Setting in "Breakaway": Eigentlich will man auf einer Station fern der Erde nur der Klaustrophobie vorbeugen, indem man die Besatzung auf der gefrorenen Methanoberfläche eines nahen Planeten Eishockey spielen lässt. Doch für Hauptfigur Vaclav ist das Spiel alles - bis daraus unverhofft ein Überlebenskampf wird, der ihn seine Prioritäten und sein Einzelgängertum erstmals überdenken lässt. Sehr schöner Schluss!
Miscellaneous Sports
Was hätten wir da noch? Konzerne, die ihre Übernahmeschlachten in tödlichen Schachpartien mit menschlichen Figuren austragen, in Timons Esaias' "Pawn". Eine galaktische Gameshow mit Retro-Flair, die zum Schauplatz einer verdeckten Ermittlung wird, in Elizabeth Ann Scarboroughs "Name that Planet!". Freerunning im hypermodernen Verkehrssystem Seattles in Genevieve Williams' "Kip, Running". Und Martial Arts als speziesverbindende Tätigkeit in Joel Richards' "Listen" - allerdings sind die Aliens hier mehr an der dahinterstehenden Zen-Denke interessiert als am Kampfsport selbst.
"The Fate of Nations" ist sicher nicht das beste Werk des satirischen Autors James Morrow. Liefert aber immerhin eine launige Erklärung dafür, warum Sport erstens total wichtig und zweitens Männersache ist. Eine Ansicht, die die Anthologie übrigens sehr schön unterwandert: Die Geschichten, in denen Männer und Frauen gemischt antreten, sind hier leicht in der Überzahl. Thematisiert wird dies aber nur einmal: In Louise Marleys "Diamond Girls" müssen sich zwei Frauen - eine davon genmodifiziert - in der Männerdomäne durchsetzen und verkörpern trotz aller Anfeindungen Sportsgeist in Reinkultur. (Leider heißt der Sport allerdings auch hier Baseball ...)
Doch noch dystopisch
Und schließlich enthält "Future Games" auch noch die eine oder andere Erzählung, die dem eingangs genannten Schema a) entspricht. Mit Gänsehaut erzeugenden Ergebnissen. So schickt "Hier sangen früher Vögel"-Autorin Kate Wilhelm in "Ladies and Gentlemen, This Is Your Crisis!" Menschen wie du und ich zur Crisis Therapy, einem Überlebenskampf in der Wildnis, der live in die Wohnzimmer der Welt übertragen wird. Das Verstörende daran ist, wie weniger die KandidatInnen als vielmehr die ZuschauerInnen daheim zu Tieren werden - veranschaulicht an einem Ehepaar, das seine rivalisierende Seite mehr und mehr auslebt.
Mein persönliches Highlight der Anthologie aber ist "The Survivor" - schön, dass hier der weitgehend vergessene Autor Walter F. Moudy noch einmal zu Ehren gekommen ist. In der Erzählung aus dem Jahr 1965 veranstalten die USA und Russland als Ersatz für einen Vierten Weltkrieg die Olympic War Games: Jeweils 100 Mann treten gegeneinander an - wer als erster die gesamte Gegenseite abgeschlachtet hat, hat gewonnen.
Dieser Stellvertreterkrieg ist ein Mega-TV-Event, das an Zynismus kaum noch zu überbieten ist: Die Kameras zoomen auf Großaufnahmen der Leichen ein, die Familien der Gefallenen erhalten als Preis Videos, wo sie sich den Tötungsakt noch einmal in Zeitlupe anschauen können. Und alleine schon der laufende Kommentar der Moderatoren ist den Kauf der Anthologie wert: "Wait a minute, folks. He's been hit! He's down! The runner has been shot. You saw it here, folks. Brilliant camera work. Simply great. John, how about that?" - "Simply tremendous, Bill. A really great shot."

Sascha Mamczak: "Die Zukunft. Eine Einführung"
Klappenbroschur, 112 Seiten, € 9,30, Heyne 2014
Der Heyne-Verlag hat diesen Frühling das 50-jährige Bestehen seiner Science-Fiction-Schiene gefeiert. Ich juble mit Vorbehalt ... aber auch wieder mit deutlich mehr Hoffnung als noch vor einem Jahr.
Vom Massen- zum Nischenmarkt
Geschichte: Der Münchner Verlag - seit über einem Jahrzehnt nur noch ein Label, das zur Random-House-Gruppe gehört - hat sich in diesem halben Jahrhundert einen Status erarbeitet, der "Heyne" praktisch zum Synonym für "Science Fiction auf Deutsch" werden ließ. Wenn ich daheim so an den Regalen mit den SF-Taschenbüchern aus den 60ern bis 80ern entlangsehe, prangt mir von den meisten Buchrücken das Heyne-Logo entgegen. Daneben sieht der gesammelte Output der Konkurrenz - Goldmann, Suhrkamp, Knaur, Fischer, Bastei Lübbe und wie sie alle heißen - blass aus. Nur Moewig konnte eine Zeitlang mithalten, aber das ist auch schon lange her.
... wie es auch schon länger her ist, dass SF ein boomendes Genre war, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Oder vielleicht liegt es auch nur am Begriff "Science Fiction": Der war offenbar einst so zugkräftig, dass er auch auf Bücher gepappt wurde, die nicht mal annähernd dem Genre zuzuordnen sind. Heute ist es eben umgekehrt: Da stehen auf Büchern, die glasklar Science Fiction sind, Bezeichnungen wie "Umweltthriller" und was nicht alles. Oder gleich nur "Roman". Bei einem Verlag, dessen Name mir zum Glück entfallen ist, hat man sich bezüglich der Deklarierung sogar zu der Aussage verstiegen, dass SF schließlich nur eine Teilkategorie der Fantasy sei. Arrrgh. Allerdings zieht das Wort "Fantasy" mittlerweile auch nicht mehr so sehr wie noch vor einigen Jahren - egal, es wird sich was Neues finden.
Liest man SF-bezogene Sekundärliteratur aus den 70ern und frühen 80ern, könnte man angesichts des darin allenthalben durchschimmernden Optimismus richtig nostalgisch werden. Anscheinend dachten damals die meisten, dass der Boom immer weiter und weiter gehen würde. Stattdessen hat sich die Science Fiction in den folgenden 30 Jahren sukzessive zu einem Nischenmarkt entwickelt. (Interessanterweise parallel zu dem Trend, dass die Bücher größer, aufwändiger und teurer wurden ... dabei zeigt die Evolution doch, dass die Kleinen viel bessere Chancen haben, sich massenhaft auszubreiten. Riesenwuchs ist immer der Endpunkt einer Entwicklung.)
Das "Gesundschrumpfen"
Natürlich mussten sich die Verlage dieser Entwicklung beugen und verkleinerten ihren Output entsprechend - auch Heyne. Was doppelt betrüblich ist, denn wie Galadriel schon zu Heyne sagte: Wenn du dieses Buch nicht herausbringst, dann tut es niemand. In den letzten ein, zwei Jahren ist der Schrumpfungsprozess dann für meinen Geschmack allmählich auf eine kritische Marke zugesteuert. Die gewohnten Premium-SF-Titel gab es weiterhin, aber ihre Zahl war gering. AutorInnen, die lange Zeit eine Dauerkarte für Übersetzungen innehatten - nehmen wir etwa Lois McMaster Bujold oder Alastair Reynolds -, veröffentlichten inzwischen zwar munter weiter, die Übersetzungen aber rissen ab. Und ein qualitativer Griff ins Klo wie Evan Currie wiegt natürlich schwerer, wenn er nicht wie einst durch dutzende bessere Veröffentlichungen überdeckt wird.
Wiederveröffentlichungen
Dazu kommt noch, dass im fraglichen Zeitraum die Quote von Wiederveröffentlichungen am Gesamtoutput ein für mich unverhältnismäßiges Ausmaß erreichte: Nämlich nicht nur auf Sonderschienen wie "Meisterwerke der Science Fiction" beschränkt, sondern auch außerhalb (etwa die Werke von David Brin). Was auch der Grund ist, warum ich auf die an und für sich sehr gute Idee, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums ein wichtiges Werk aus jedem Jahrzehnt neu herauszugeben, nicht recht angesprungen bin. Ich habe mir nur das älteste dieser Bücher herausgepickt (Ursula K. Le Guins "Die linke Hand der Dunkelheit" als Vertreter der 60er Jahre, siehe die nächste Seite). Erwähnt werden sollten die anderen aber auch:
+ 70er: Joe Haldeman, "Der ewige Krieg". Hatten wir in der Rundschau vor kurzem erst, wenn auch leider in einer missglückten Übersetzung (hier die Nachlese). Die Jubiläumsausgabe dürfte mit ziemlicher Sicherheit besser sein, aber wie gesagt: Wir hatten's schon.
+ 80er: William Gibson, "Neuromancer". Logisch, da kommt man nicht dran vorbei. Aber ist der Cyperpunk-Klassiker eigentlich seit seiner Erstveröffentlichung irgendwann mal außer Druck gewesen? Ich kann mich an keinen Besuch in einer Buchhandlung mit SF-Regal erinnern, wo nicht ein "Neuromancer" herumgestanden hätte. Ich wollt' es einfach nicht noch mal, sorry.
+ 90er: Iain Banks, "Bedenke Phlebas". Sehr schön. War mir aber noch nicht lange genug her, um es noch einmal zu lesen - viel mehr interessiert mich die Übersetzung des letzten noch ausständigen "Kultur"-Romans "The Hydrogen Sonata". Und - täterätäää! - da hat das Warten nun ein Ende: Im Juli kommt das Werk des vor einem Jahr leider verstorbenen Autors, der uns so viele wundervolle Lesestunden beschert hat, nun auch auf Deutsch heraus.
+ 00er: Dmitry Glukhovsky: "Metro 2033"/"Metro 2034". Come again? Der videospielkompatible U-Bahn-Grusel aus Russland ist ja für ein bis zwei Romane unbestreitbar unterhaltsam. Aber wenn das das Gegenwartsäquivalent zu den zuvor genannten Klassikern sein soll, dann können wir alle einpacken und nach Hause gehen. Was ich aber nicht als Krisensymptom der SF werte - letztlich dürfte einfach ein nachvollziehbares wirtschaftliches Kalkül dahinterstecken: Hochqualitative neuere Werke wie z. B. Ian McDonalds "Cyberabad" oder Paolo Bacigalupis "The Windup Girl/Biokrieg" haben ihr Kernpublikum mit der Erstausgabe gefunden; die würden so kurz danach mit einer Neuauflage nicht plötzlich erweiterte Käuferkreise erschließen. Und wenn man etwas vergleichbar Gutes und bislang nicht Übersetztes zum ersten Mal im Jubiläumsrahmen herausbringt (ich plädiere für Daryl Gregorys "Pandemonium"), könnte sich die Frage stellen, warum man das vorher übergangen hat. Dann doch besser einen Omnibus zu einer laufenden Serie, bei der der Absatz sicherer erscheint.
Die Zukunft ...
Zum Trost für diesen Absacker wird das Jubiläumspaket von einem schmalen Band begleitet, in dem Sascha Mamczak, Lektor und Betreuer der SF-Schiene bei Heyne, zu Wort kommt - hier in der Rundschau als Mitherausgeber des famosen SF-Jahrbuchs von Heyne ein alljährlicher Gast. "Die Zukunft. Eine Einführung" dreht sich aber nicht um die weitere Entwicklung des verlagseigenen SF-Programms oder auch die Science Fiction im Allgemeinen. Es ist ganz dem Titel entsprechend ein Essay über dieses seltsame Ding, das eigentlich nie ist - und das sich der Mensch doch mit allen Mitteln anzueignen versucht.
... zumindest der heutige Mensch, denn auch die Zukunft hat eine Geschichte. Und das Bild, das sich unsere Vorfahren von ihr gemacht haben, war einem mehrfachen Wandel unterworfen, wie Mamczak auf seinem historischen Streifzug vom Neolithikum bis zu Niklas Luhmann darlegt. Er schreibt vom Unterschied zwischen zyklischem und linearem Zeitverständnis, vom Spannungsfeld zwischen Zukunftsforschung und Zukunftsliteratur und auch von aus der Mode gekommenen Zukünften wie der Angst vor einem Atomkrieg.
Krampf- und zwanglos
In lockerem Ton lädt Mamczak zum Nachdenken ein - Widerspruch ist dabei keineswegs ausgeschlossen. Ich zum Beispiel habe mich bei der Stelle eingehakt, in der er Stimmen aus Wirtschaft und Politik etwas abgewinnen kann, denenzufolge unser übermäßiger Ressourcenverbrauch unseren Nachkommen zwar gravierende Probleme einhandelt - sie aber auch mit mehr Mitteln ausstattet, um mit diesen fertigzuwerden. Hm. Weniger zynisch als rein mathematisch gesehen riskant, scheint mir. Wer mag kalkulieren, dass ihre Mittel im gleichen Ausmaß wachsen werden wie ihre Probleme? Da scheint mir nachhaltiges Wirtschaften doch der bessere Weg - damit garantiert man künftigen Generationen wenigstens die gleichen Chancen, die wir haben.
Aber darum geht es in "Die Zukunft" ja wie gesagt: zum Nachdenken anregen. Und das ganz zwanglos. Der Text ist gesprenkelt mit erfrischenden Formulierungen - etwa wenn Mamczak von der jahrtausendealten theologischen Brutkammer des Nahen Ostens spricht oder das derzeit in aller Munde liegende Schlagwort "Big Data" als neuen Modenamen des Laplaceschen Dämons bezeichnet. Vergnügt geschrieben, vergnüglich zu lesen.
Wir geben Zwischengas
Und wenn es in dem Band auch nicht um die Zukunft der Science Fiction geht, dann schlage ich jetzt den Bogen zum Anfang dieses Textes zurück und begründe noch schnell, warum ich wieder zuversichtlicher gestimmt bin als noch vor einem Jahr. Ganz einfach deshalb, weil bei Heyne für die kommenden Monate mehr interessante Neuübersetzungen angekündigt sind als in der gut einjährigen Durststrecke davor. Iain Banks habe ich ja schon bejubelt - dazu kommen der hier bereits abgefeierte Andy Weir mit "Der Marsianer", Stephen Baxters "Proxima", die aktuelle Nebula-Gewinnerin Ann Leckie mit "Die Maschinen" und - Tanze Samba mit mir! - China Miévilles "Das Gleismeer". Na also, geht doch!

Ursula K. Le Guin: "Die linke Hand der Dunkelheit"
Broschiert, 397 Seiten, € 9,30, Heyne 2014 (Original: "The Left Hand of Darkness", 1969)
Hier also der Klassiker schlechthin in dieser Rundschau und ein Meilenstein in mehrfacher Hinsicht. Das 1969 erschienene "The Left Hand of Darkness" bedeutete nicht nur den Durchbruch für die große Ursula K. Le Guin als Autorin. Der Hugo- und Nebula-gekrönte Roman war auch ein wegweisendes Werk in Sachen feministischer und genderbewusster Science Fiction. Wie wegweisend, merkt man(n) unter anderem daran, dass heutige SF-LeserInnen diese Ausrichtung gar nicht als sonderlich auffällig empfinden dürften. Eine solche Selbstverständlichkeit musste aber erst einmal errungen werden - und eine der Pionierinnen war eben Ursula K. Le Guin.
Der Plot
Im Grunde seines Herzens ist "Die linke Hand der Dunkelheit" ein klassisches planetares Abenteuer. Inklusive eines wochenlangen Gewaltmarsches über eine Welt, die gerade eine Eiszeit durchlebt. Hier auf Gethen - von galaktischen BesucherInnen bezeichnenderweise "Winter" genannt - kennt man wirklich dutzende verschiedene Ausdrücke für Schnee ... und Le Guin nennt sie ungefähr alle. Neben den vielen anderen, oft diskutierten Stärken des Romans sollte man auch nicht vergessen, dass diese fiktive Welt mit außerordentlicher Liebe zum Detail ausgestaltet wurde. Was mit einem ebenso gedrechselten wie fließenden Stil einhergeht, der eine erstaunliche Informationsdichte transportiert. Sobald man erst einmal in Le Guins Flow ist, ein echter Genuss!
Gethen ist noch in Einzelstaaten gegliedert, zwei davon lernen wir kennen: Karhide, ein recht heterogenes Königreich, in dem sich alles darum dreht, das Gesicht zu wahren. Und die nüchtern-bürokratische Commensalität von Orgoreyn, die etwas fortgeschrittener wirkt - wovon man sich aber nicht täuschen lassen sollte. Obwohl man auf Gethen alles eher langsam angeht und nicht mal Ansätze zum Sprung in den Weltraum zeigt, ist man draußen in der Galaxis längst auf die Welt aufmerksam geworden. Der Roman gehört zum "Ökumene"-Zyklus, in dem eine über mehrere Planeten verstreute Menschheit einen zwanglosen Bund eingegangen ist. Die Erde ist darin übrigens nicht die Urheimat der Menschen, sondern eine der Welten, auf denen die "Saat" der Menschheit ausgestreut wurde.
Die Hauptfiguren
Genly Ai ist der Abgesandte der Ökumene, der die BewohnerInnen von Gethen zu einem Beitritt bewegen soll - im Alleingang, weil man vonseiten der Ökumene keine Invasionsängste wecken will. Trotzdem hat Ai erhebliche Schwierigkeiten, sein Anliegen vorzubringen: Erst in Karhide, dann im vermeintlich aufgeschlosseneren Orgoreyn, wo Ai in politischem Hickhack, dann im Arbeitslager und schließlich auf einem Trek übers ewige Eis landet.
Hilfe erhält er ausgerechnet von jemandem, dem er die längste Zeit misstraut hat: dem in Karhide in Ungnade gefallenen Lord Estraven. Der Roman ist ganz wesentlich auch die Geschichte der freundschaftlichen Annäherung zwischen zwei Menschen, die erst einmal eine Menge von Hürden zu überwinden haben. Die Missverständnisse, die sich zwischen den beiden immer wieder ergeben, sind ihren völlig unterschiedlichen Denkweisen geschuldet und bieten viel Raum zum Philosophieren - ein typisches Element von Social SF.
Die Sache mit der Ambisexualität
Der wesentlichste Faktor - und der, der den Roman berühmt gemacht hat - ist der Umstand, dass die Menschen von Gethen als einzige im bekannten Universum "ambisexuell" sind. Die meiste Zeit leben sie in einem androgynen Zustand. Etwa einmal im Monat geraten sie dann in die Kemmer: Sie werden sexuell aktiv und nehmen - vorausgesetzt, es ist ein Partner vorhanden - einen "männlichen" oder "weiblichen" Zustand an ... Bezeichnungen, die für sie natürlich nicht existieren. Jemand, der wie Ai seine Sexualität non-stop (eigentlich buchstäblich) vor sich herträgt, wird bei ihnen als "pervers" belächelt.
Obwohl Ai aus einer aufgeschlossenen Gesellschaft kommt, bereitet ihm dies einige Probleme. Immer wieder interpretiert er optische Merkmale, aber auch Verhaltensweisen oder Ansichten einzelner PlanetarierInnen als "maskulin" oder "feminin". Was natürlich völlig absurd ist - erst recht, wenn seine Bewertungen ein- und derselben Person von Situation zu Situation wechseln - und zeigt, wie sehr er trotz seiner Offenheit doch in seinem bipolaren Denken gefangen bleibt.
Ein interessantes Detail noch: Le Guin bezeichnet die Menschen von Gethen durchgehend als "er". Geschlechtsneutrale Pronomen gab es zwar auch schon zu der Zeit, als sie den Roman schrieb. Aber die Verwendung wurde erst später (ein bisschen) gebräuchlicher. Kunstwörter wie "ys" in Ian McDonalds "Cyberabad" etwa (und dazu ist noch niemandem die Bezeichnung "feministische SF" eingefallen). Aber nicht nur in der Literatur, sondern auch in der realen Welt. So gab es vor zwei Jahren erst in Schweden eine politische Diskussion um die Verwendung des Neo-Pronomens "hen" statt "han" (er) und "hon" (sie). Die Welt hat sich fürwahr weitergedreht.
Gründlich nachgedacht, mit Esprit formuliert
Neuartige sexuelle Erfahrungen lässt Le Guin ihren Protagonisten übrigens nicht machen, falls das jetzt jemand vermuten sollte. Stattdessen spinnt sie den Gedanken einer weitgehend eingeschlechtlichen Gesellschaft ohne "natürliches" Rollenverhalten weiter und überlegt, was eine solche Grundlage für soziale Auswirkungen haben könnte. Der Sexualität wird Raum gegeben, reichlich Raum, aber sozusagen ein separater Raum. Die Gesellschaft von Gethen ist in ihren alltäglichen Funktionen und ihrer Kontinuität frei von Konflikten, die ihren Ursprung in der Sexualität haben. Oder: Man bedenke: Eine Einteilung der Menschheit in stärkere und schwächere Hälfte, in Beschützer und Beschützte, in Beherrschende und Beherrschte, in Eigentümer und Eigentum, in Aktive und Passive existiert nicht.
Es wird sogar gemutmaßt, dass es auf Gethen vielleicht deswegen (noch) keine Kriege gibt - obwohl sich Le Guin ein Hintertürchen offen lässt, um nicht einseitig-ideologisch rüberzukommen, und die harschen Umweltbedingungen Gethens als alternative Erklärung dafür anbietet, warum man sich hier einfach keine Kriege leisten kann. In dem Zusammenhang fallen übrigens immer wieder Sätze wie Zucker - siehe etwa diese Passage hier: Nein, er wollte etwas Unfehlbares, die unfehlbare, schnellste und dauerhafteste Methode, ein Volk zu einer Nation zusammenzuschweißen: den Krieg. Seine Vorstellungen in dieser Hinsicht konnten bestimmt nicht allzu präzise sein, aber sie waren logisch. Das einzige andere Mittel, ein Volk in seiner Gesamtheit schnell zu mobilisieren, ist eine neue Religion; es war gerade keine zur Hand, also musste er es mit einem Krieg versuchen.
Und so liest sich der Roman wegen seiner Intelligenz überaus vergnüglich - das fängt schon im Vorwort an, das dem Roman seit den Ausgaben von 1976 vorangestellt wurde. Etwa wenn sich Le Guin über das der Science Fiction gerne angedichtete Vorhersagepotenzial in Sachen gesellschaftlicher Fehlentwicklungen lustig macht und SF mit Gesundheitsstudien unter Laborbedingungen vergleicht: Wenn man es bis zum logischen Extrem treibt, wird so ziemlich alles deprimierend, wenn nicht krebsbildend. Word! Nach all den Jahrzehnten immer noch hervorragende Lektüre - ein Klassiker eben.
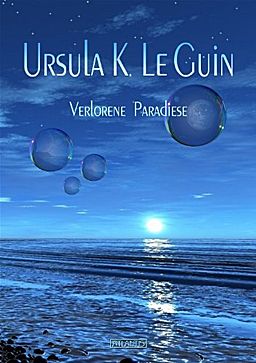
Ursula K. Le Guin: "Verlorene Paradiese"
Broschiert, 147 Seiten, € 20,60, Atlantis 2014 (Original: "Paradises Lost", 2002)
Wenn ich nichts übersehen habe, liegt der jüngste ins Deutsche übersetzte Roman von Ursula K. Le Guin auch schon wieder zehn Jahre zurück ("Die wilde Gabe"/"Gifts"). Und das war bezeichnenderweise der erste Band einer Trilogie, deren zweiter und Nebula-gekrönter dritter Teil ("Powers") nicht mehr auf Deutsch erschienen.
Dabei war die Grande Dame der US-amerikanischen Science Fiction in den 80er, 90er und 00er Jahren alles andere als untätig. Es sieht nur so aus, als wären die deutschsprachigen Verlage seit langem primär am Recycling der immergleichen Klassiker interessiert: "Erdsee" natürlich und das eine oder andere herausragende SF-Werk wie "The Left Hand of Darkness" oder "The Dispossessed". Spätere Werke wurden weitgehend ignoriert - mit ein paar löblichen Ausnahmen. Eine solche ist nun bei Atlantis erschienen.
Alter SF-Topos mit neuem Leben erfüllt
"Verlorene Paradiese" ist eine Novelle und greift das alte Motiv vom Generationenschiff auf, zu dem jeder SF-Fan vermutlich gleich eine ganze Reihe kanonischer Beispiele runterrattern könnte. Nicht so viele werden vermutlich auf dem Zettel haben, was Le Guin als eine der Inspirationsquellen nennt: Nämlich Harry Martinsons Versepos "Aniara" aus den 50er Jahren. Hui, das hatte ich seinerzeit im Schwedischunterricht! Den einen oder anderen Vers kann ich sogar noch. Schön, wenn ein nicht-angloamerikanisches (und formal so aus dem Rahmen fallendes) Werk auch mal gewürdigt wird. Aber Le Guin ist halt eine echte Literatin und legt Wert auf Stil.
Zugleich wollte sich Le Guin zur Abwechslung mal denen widmen, die am vermeintlich unspektakulärsten Abschnitt der Reise eines Generationenschiffs teilhaben: Den "mittleren Generationen", die lange nach dem Start an Bord geboren wurden und die vermutlich auch das Ende der Reise nicht mehr erleben werden. Es gibt keinen Jahreslauf. Es gibt keine Sonne. Die Zeit ist unterteilt in Lichtzyklus, Dunkelzyklus und Zehnerwochen. Nach jeweils 365,25 Zyklen gibt es ein Fest und eine als "Das Jahr" bezeichnete Zahl wird geändert. Dieses Jahr ist das 141. Das steht jedenfalls auf der Uhr im Klassenraum.
In einfachen Worten führt uns die Autorin in das Denken derer ein, die nichts anderes als das Schiff kennen und die sich trotz freundlichen Bemühens kaum noch in das hineinversetzen können, was ihnen im Unterricht von der alten Heimatwelt - abwechselnd als Erde und Dichew bezeichnet - erzählt wird. Es sind Angehörige der fünften Generation wie die Gärtnerstochter 5-Liu Hsing und ihr Freund 5-Nova-Luis, deren Leben wir vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter miterleben. Und gleich die ersten Abschnitte der Novelle zeigen in wunderbar komprimierter Form, wie weit sich diese Menschen auch geistig von unserer Welt entfernt haben.
Utopische Gesellschaft
Wie schon der Titel (im Original: "Paradises Lost") mit seinem Verweis auf John Milton zeigt, hat sich Le Guin einmal mehr des Themas Utopie angenommen. Was sich übrigens auch in der Form niederschlägt: Deskriptive Passagen über die neue Gesellschaft an Bord des Raumschiffes "Discovery" sind ebenso wichtig wie die narrativen - "Verlorene Paradiese" ist nicht die Geschichte von Hsing und Luis, sondern die ihrer Welt. Gegen Ende hin macht sich dies noch stärker bemerkbar, wenn die weiteren Ereignisse chronikartig gerafft geschildert werden.
Im Vergleich zum zurückgelassenen "Müllplaneten" mutet das System "Discovery" tatsächlich utopisch an. An Bord sind außer 4.000 Menschen nur Pflanzen und nützliche Bakterien, aber keinerlei Störfaktoren. Alles ist perfekt austariert - in ökologischer ebenso wie in gesellschaftlicher Hinsicht, wo neue Familienstrukturen dem Gebot einer konstant großen Bevölkerungszahl Rechnung tragen. Solange es zu keiner unerwünschten Vermehrung kommt, ist dafür alles erlaubt - die erfrischend offene Haltung zu Sex atmet stark den Geist der 70er Jahre. Insgesamt ist es eine ebenso liberale wie funktionale Welt.
Der Systemfehler
Genau so hatten es die Mütter und Väter der "Discovery"-Mission einst geplant, als sie das entwarfen, was in Le Guins poetischem Text mit einer Seifenblase verglichen wird und was Horst Ilmer im Nachwort der Erzählung prosaischer als konzentrierte Versuchsanordnung einer geschlossenen Welt bezeichnet. Doch jedes System bringt seine eigenen Bruchstellen hervor - und hier ist es just die Perfektion, die zur Imperfektion wird. Nach dem ersten Drittel deutet sich dies erstmals an, als jemand meint: "Unsere Aufgabe ist es zu reisen. Ankommen ist etwas ganz anderes. (...) Aber eine Generation, die nur weiß, wie man reist - kann die einer anderen Generation beibringen, wie man ankommt?"
Längst hat sich mit der neuen Religion der Glückseligkeit an Bord eine Strömung etabliert, die die Reise selbst als das eigentliche Ziel der "Discovery" und ihrer Menschen betrachtet. Warum die Perfektion aufgeben, nur um wieder im Dreck eines Planeten zu wühlen? Ein Konflikt mit den laizistisch geprägten Bordmitgliedern, die am ursprünglichen Missionsziel festhalten, baut sich auf. Der mündet zwar nicht in Bürgerkriegsaction (soviel sag ich zur Enttäuschung der Krawumm-Fans gleich im Vorhinein), ist aber trotzdem überaus spannend.
Denn im Grunde handelt es sich um den alten Konflikt zwischen dem Rationalen und dem Spirituellen. Nur dass die Religiösen - die sich selbst als Engel bezeichnen - hier dem Diesseits, also dem Ist-Zustand, anhängen und ihn verklären, während das Ziel der weltlich Denkenden außerhalb der Schiffswelt, also gewissermaßen im Jenseits, liegt. Eine raffinierte Umkehr!
Empfehlung
Nach der Lektüre freut es mich umso mehr, dass "Verlorene Paradiese" mit Verspätung doch noch übersetzt worden ist. Denn an Faszination hat Ursula K. Le Guin auch Jahrzehnte nach ihren Klassikern, die sie wohl für immer definieren werden, nicht eingebüßt. Nur wenige SF-AutorInnen vermögen es, philosophische Betrachtungen so dichtgepackt wie hier in schlichte Worte zu kleiden. Wie gesagt: Es ist Poesie.

David Walton: "Quintessence"
Broschiert, 320 Seiten, Tor Books 2014
Ich weiß nicht, woher's kommt, aber ich hatte mal wieder Lust auf ein Abenteuer zur See. Eines aus der Zeit, als Abenteuer noch wirklich abenteuerlich waren. Als die Erde noch eine flache Scheibe war und der Ozean von riesigen Meeresungeheuern wimmelte, die Schiffe mit Mann und Maus ins Verderben zogen.
Das Szenario
Und David Walton liefert. Ein US-amerikanischer Autor, der ab den Nuller Jahren eine ganze Reihe von Erzählungen querbeet durch SF und Fantasy veröffentlicht hat, bei uns aber noch weitgehend unbekannt ist. Mit "Quintessence" führt er uns ins 16. Jahrhundert, also mitten ins sogenannte Zeitalter der Entdeckungen - geografischer ebenso wie wissenschaftlicher. Der neuzeitliche Paradigmenwandel, beginnender Kolonialismus und religiöse Konflikte (in England hat gerade die blutige Phase vor der Regentschaft Elizabeths begonnen): All das klingt in "Quintessence" an.
... und doch gibt es in dieser Alternate History, die bis zur Handlungszeit ganz dem Verlauf unserer Geschichte gefolgt ist, einen entscheidenden Unterschied. All das, was man sich in unserer Realität über das Wesen der Welt so zusammenspann, existiert hier wirklich - und wird nun in der Ära der Entdeckungsfahrten auch gefunden: Der Rand der Welt, die Quelle der ewigen Jugend, die Möglichkeit beliebige Materie in Gold zu verwandeln ... absonderlich fremde Tiere und kostbare Gewürze gibt's gratis obendrauf.
Die Hauptfiguren und ihre Weltanschauungen
Im Prolog des Romans kehrt eine Expedition aus dem mythischen Westen nach England zurück. Was sie mitgebracht hat - und nicht zuletzt die exotische Weise, in der sämtliche Expeditionsmitglieder auf der Heimfahrt zu Tode gekommen sind -, scheucht den großen Alchemisten Christopher Sinclair auf. Er setzt alles daran, umgehend eine neue Expedition auszuschicken, und schreckt dabei vor keinem Mittel zurück. Sinclair ist ein ebenso monomanischer wie extrem manipulativer Charakter - und doch, das sei hier betont, macht Walton ihn nicht zum Bösewicht des Romans.
Der Arzt Stephen Parris kriegt Sinclairs Skrupellosigkeit am eigenen Leib zu spüren. Immerhin verliert er dank Sinclair seine Existenzgrundlage, wodurch ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als sich der Expedition anzuschließen. Familienmensch Parris ist deutlich geerdeter als Sinclair - mag er seine Ehefrau auch gelegentlich in Rage bringen, wenn mal wieder eine Leiche zum Sezieren auf dem Küchentisch liegt. Zugleich verkörpern die beiden zwei unterschiedliche Prinzipien: Sinclair steht für die Alchemie (die in dieser Welt allerdings funktioniert) samt ihrer Geheimniskrämerei und ihres Einzelgängertums. Parris hingegen praktiziert Wissenschaft im modernen Sinne - und betont ausdrücklich die Bedeutung von Informationsaustausch und Vernetzung. Der Konflikt zwischen diesen beiden Sichtweisen wird sich in vielfältiger Weise durch den ganzen Roman ziehen.
Und so sticht der Segler "Western Star" ein weiteres Mal gen Westen in See. Mit an Bord ist nicht nur eine Gruppe protestantischer Kolonisten, die vor der neuen katholischen Königin Mary und der auch nach England geschwappten Inquisition flüchten. Da wäre auch noch Parris' Teenager-Tochter Catherine, die sich so gar nicht mit der zeittypischen Frauenrolle als Heimchen am Herd abfinden will, sondern ihrerseits ein Interesse an der Wissenschaft hegt. Dazu wird sie noch reichlich Gelegenheit bekommen - vor allem deshalb, weil auch ein blinder (und unsichtbarer) Passagier mitreist, der sich seinerzeit bei der Vorgängerexpedition an Bord geschlichen hat: Ein Bewohner des Landes im Westen, wo der Ozean in Kaskaden ins Nichts stürzt. Und er ist kein Mensch, sondern ein intelligenter Mantikor.
We're not in Kansas anymore
Mantikore bleiben zugleich Waltons einziger Zugriff auf das bestehende mythologische Arsenal. Ansonsten erweist sich sein Fantasy-Szenario als erfreulich originell. Wenn beispielsweise ein gebirgsgroßer Behemoth über dem Meer schwebt und von Schwärmen räuberischer Fische mit Metallknochen attackiert wird, dann hat das mehr mit Wayne D. Barlowes "Alien Planet" als mit herkömmlicher Fantasyfauna zu tun.
Wunder über Wunder warten in der Neuen Welt, und verantwortlich dafür ist das, wonach Sinclair sein ganzes Leben gesucht hat: Die Materia prima, eben die Quintessence der Welt, die an deren Rand viel stärker wirkt als daheim in Europa. Wer sie beherrscht, kann physikalische Eigenschaften nach Belieben ändern - etwa unsichtbar werden, sein Gewicht und seine atomare Zusammensetzung wechseln und sogar Tote aus dem Jenseits zurückholen. Und all das tut die Fauna und Flora des Landes im Westen auch. Wo sich in unserer Welt im isolierten Australien ein evolutionärer Wettlauf in Sachen Giftigkeit entsponnen hat, wird hier der Einsatz von Quintessence zu immer neuen tollen Effekten getrieben.
... überaus praktischen Effekten manchmal. Und die Neo-Siedler machen sich diese Effekte nicht nur zunutze, rasch entwickeln sie auch eigene Anwendungen: bis hin zur Quantenverschränkung und der Erzeugung eines Schwarzen Lochs. All das aber stets fußend auf Paracelsus' Lehre von den "Urstoffen", nicht schlecht! Und so ganz nebenbei erschließt sich einigen von ihnen dabei das Wesen der Welt: He spun, astonished, the wonder of this sight taking his attention from the danger of the situation. Sinclair had discovered this, and yet not told them? This was more than just seeing invisible creatures. It was an invisible world. He had no doubt he was seeing the connection between the quintessence of the stars and life on earth, the source of all this island's magic.
Großer Spaß
Die Lust am Entdecken trägt den Roman ebenso wie die Konflikte, die sich zwischen den Hauptfiguren aufgrund ihrer unterschiedlichen Weltanschauungen ergeben. "Quintessence" ist damit die längste Zeit spannend genug, ohne ein herkömmliches Gut-Böse-Szenario zu bemühen. Da fand ich es dann fast ein wenig schade, wenn schließlich doch noch eine Schiffsladung Schurken angeschwommen kommt. Aber gut, der Autor wollte halt einen Showdown (und lässt's dafür auch gewaltig krachen).
David Walton ist kein Neal Stephenson. Trotz der zahlreichen geschichtlichen und wissenschaftshistorischen Themen, die hier angerissen werden, bleibt "Quintessence" in erster Linie ein großes Seemannsgarn. Aber eines von der sehr unterhaltsamen Sorte. Und wer gerne noch mehr Abenteuer dieser Art lesen würde, für den gibt's eine gute Nachricht: Der Nachfolgeband "Quintessence Sky" ist ebenfalls bereits erschienen.
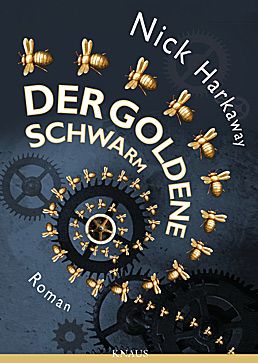
Nick Harkaway: "Der goldene Schwarm"
Broschiert, 607 Seiten, € 20,60, Knaus 2014 (Original: "Angelmaker", 2012)
Und jetzt noch zwei Geheimdienst- bzw. Agentengeschichten der phantastischen Art, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Die eine lebt vom Nicht-Ausgesprochenen, von den Lücken, die die LeserInnen mit ihrer eigenen Fantasie ausfüllen müssen. Das andere springt einem mit allem, was man sich so vorstellen kann, ins Gesicht - das wäre dann dieses Buch hier.
Nicht kleckern, klotzen
Nur kurz angerissen, was hier alles von der Leine gelassen wird: Kriegselefanten und Roboter. Ein Hannibal-Lecter-mäßiger Serienkiller und ein asiatischer Diktator, der unmittelbar von Dr. Fu Manchu und "Flash Gordons" Emperor Ming inspiriert sein muss. Schwärme mechanischer Bienen, die die Welt ins Chaos stürzen, und eine Maschine, die das Denken der Menschen verändert. Selbstgebastelte Bomben, die nicht immer im richtigen Moment hochgehen, und ein irrer Kult von nicht-menschlich wirkenden Robenträgern. Nicht zu vergessen ein Hund mit zwei Glasaugen und eine Bibliothekarin, die ihre dritten Zähne je nach Situation wechselt; ein Gebiss aus Stahl hat sie auch im Sortiment.
... und das sind nur ein paar der Ausstattungsdetails von "Der goldene Schwarm", einer schwer zu kategorisierenden Mischung aus Mystery, Actionthriller, schwarzer Komödie, Familiendrama und Steampunk (bzw. Meta-Steampunk, mehr dazu später). Schon in seinem Aufsehen erregenden ersten Roman "Die gelöschte Welt" setzte der britische Autor Nick Harkaway auf eine unbekümmerte Vermischung von Genreelementen - für sein zweites Werk wollte er offensichtlich noch eins draufsetzen.
Das dynamische Duo
Die zentrale Figur des Romans ist der Londoner Uhrmacher Joe Spork, der über der alten Werkstätte seines Großvaters wohnt und ein recht zurückgezogenes Leben führt. Wir lernen ihn dabei kennen, wie er sich einen skurrilen Kleinkrieg mit einer streunenden Katze liefert, und stufen ihn rasch als Nerd ein. Aber natürlich ist mehr an ihm dran - unter anderem eine komplizierte Familiengeschichte. Bastler Joe lebt ganz den Traum seines Großvaters, während er jeden Zug seines (ebenfalls bereits verstorbenen) Vaters aus seiner DNA zu streichen versucht - der war nämlich ein Gangster und das schwarze Schaf der Familie. Zur Hälfte dreht sich "Der goldene Schwarm" darum, wie diese Familiengeschichte rekonstruiert wird (was zu einigen Überraschungen führt) und Joe sich damit auszusöhnen hat. Außerdem zeigt sich, wie die Geschichte der Sporks mit dem zweiten Handlungsstrang zusammenhängt, in dem sich immerhin eine Art Apokalypse zusammenbraut.
Die zweite Hauptfigur heißt Edie Banister: Einst eine britische Superagentin, mittlerweile weit in ihren 90ern, aber immer noch mit ordentlich Haudrauf-Potenzial ausgestattet. Harkaway widmet ihrem schillernden Werdegang sehr ausführliche Flashback-Kapitel. Von besonderer Bedeutung sind dabei ihre wechselvolle Beziehung mit einer genialen französischen Erfinderin und der aufreibende Kampf Edies gegen ihren Erzfeind: besagten Diktator, der sich als Mischung aus Salonlöwe und Massenmörder präsentiert (und das schon bevor er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat - erst danach legt der megalomanische und schamlos überzeichnete Pulp-Schurke nämlich so richtig los).
Realität: Vorsicht, zerbrechlich!
Joes und Edies Wege kreuzen sich in der Gegenwart, nachdem Joe nichts Böses ahnend einen Reparaturauftrag angenommen und dabei ungewollt eine Weltuntergangsmaschine in Gang gesetzt hat. Von da an fällt der Roman von anfangs gemächlichem Passgang erst in Trab und schließlich in wilden Galopp.
Nebenbei bemerkt: Hab ich eigentlich überlesen, wie dieser sogenannte Anschauungsapparat funktioniert? Harkaway bringt zwar eine interessante philosophische Komponente ins Spiel: Der Mensch sei durch seine Entscheidungsfreiheit nämlich auf quantenphysikalischer Ebene von existenzieller Bedeutung für das Universum. Wenn besagter Apparat also dem freien Willen ins Lenkrad greift, wird an den Grundfesten der Realität selbst gerüttelt. So weit, so gut.
Aber noch einmal: Wie arbeitet die Maschine? Die Hardware sind mechanische Bienen, die über die Welt schwärmen und das menschliche Denken verändern ... aber summen die Bienen jetzt den Menschen Botschaften ins Ohr? Oder schießen sie ihnen Zeta-Strahlen ins Gehirn? Als Genre-Leser ist man tendenziell eh bereit, sich auch mal mit fadenscheinigen Handwaving-Erklärungen zu begnügen. Aber dass nicht mal eine solche kommt, ist schon verblüffend. Entweder hat der Autor das in der prallen Fülle der Ereignisse übersehen, oder eben ich hab's überlesen. (PosterInnen-Wissen ist gefragt!)
Ein Zeitalter für sich
"Der goldene Schwarm" wird weithin als Steampunk wahrgenommen, was insofern bemerkenswert ist, da er in unserer Gegenwart oder möglicherweise sogar einer nahen Zukunft (nach dem Globalen Ölfördermaximum) angesiedelt ist. Aber Harkaway hat den Roman gezielt in seine ganz eigene Nicht-Zeit geschrieben. Das fängt schon bei den Figuren an, die durchgehend altmodisch klingende Namen wie Donald Beausabreur Lyon oder Rodney Titwhistle tragen und von Institutionen wie der Boyd Harticle Stiftung für Kunsthandwerk und Wissenschaftliche Praxis oder dem Loganfield Museum of Mechanical History kommen. Schauplätze wie der nomadisierende Nachtmarkt, auf dem sich Londons Halb- und Unterwelt ein familiäres Stelldichein gibt, und die Welt der Tosher, die sich in der Kanalisation auf Schatzsuche begeben, wirken ebenfalls wie dem 19. Jahrhundert entsprungen.
Und dann ist da natürlich die Technologie: Unter anderem dürfen wir uns an Steampunk-typischen Super-Vehikeln wie einem U-Boot im Art-déco-Stil oder dem gepanzerten Dampfzug "Ada Lovelace", der als rollende Datenverarbeitungsmaschine fungiert, erfreuen. Das Credo der Ruskiniten-Sekte schließlich, die im Roman eine zentrale Rolle spielt, liest sich sogar 1:1 wie die Lebensphilosophie von Steampunk-Tinkern: Ein Ruskiniten-Erzeugnis würde handgemacht sein (...), gut durchdacht und sehr individuell. Es würde dem menschlichen Standpunkt Respekt zollen. Sich bemühen, das Göttliche im Alltäglichen aufscheinen zu lassen. "Der goldene Schwarm" scheint der modernen Welt auf vielen Ebenen den Kampf angesagt zu haben.
Nichtsdestotrotz ist der Spielmannszug des Fortschritts, wie es im Roman mehrfach heißt, keineswegs stehengeblieben. Aus dem Radio dringen Nachrichten von Klimawandel und Terrorismus aber nur wie ein lästiges Hintergrundsummen. Joe versteht die moderne Welt nicht. Und Edie hasst sie. Die Nostalgie, die sich durch den ganzen Roman zieht (ist es die von Harkaway?) treibt aber auch durchaus seltsame Blüten: Etwa wenn Joes "Onkel und Tanten" - also die gesamte alteingesessene Gangstergesellschaft Londons - als letztes Aufgebot von Good Old Britain zu Ehren kommen.
Darf's ein bisschen weniger sein?
Einmal mehr ist ein Roman für meinen Geschmack länger, als ihm guttut. Streichpotenzial hätte bei diversen Flashbacks - nicht jeder davon ist wirklich bedeutend - sowie den vielen Nebenfiguren bestanden. Die geben sich zwar allesamt so viel Mühe, in ihrer jeweiligen Skurrilität zu glänzen, dass man sich wie in einem Film der Coen-Brüder vorkommt. Aber das schillert nur an der Oberfläche. Bis auf Joe und Edie sind sämtliche Figuren im Grunde eindimensional und auf ihre jeweilige Funktion für Joe bzw. die Handlung reduziert. Wobei manche zugegebenermaßen einen guten Job draus machen - allen voran die famose Anwaltskanzlei Mercer mit ihren Unterwelt-Connections, die Joe ein ums andere Mal mit aberwitzigen Ablenkungsmanövern aus der Bredouille holt:
Joe erwartet einen großen schwarzen Wagen mit getönten Scheiben, vielleicht auch mehrere Wagen. (...) Stattdessen schickt Mercer vier Krankenwagen, eine Demo gegen den Klimawandel, einen schottischen Wanderzirkus und eine Fuchsjagd. Die verschiedenen Ablenkungsmanöver kommen getrennt voneinander an, sind aber makellos koordiniert: Gerade verbirgt sich Joe Spork noch in den Schatten eines Vorgartens und glaubt, seine Verfolger in jedem Wispern des Windes zu hören. Schon im nächsten Moment aber wird das gesamte Viertel von Blaulicht erhellt und von Martinshörnern beschallt, und achtundsiebzig Beagle sowie ein Haufen aufgewühlter Weltverbesserer teilen sich die Straße mit Darla, der bärtigen Highländerin.
Absurdität zieht sich als roter Faden durch den ganzen Roman und macht ihn in Summe sehr unterhaltsam. Als Klammer, um ihn wirklich zusammenzuhalten, reicht sie für mich aber nicht aus - dafür hat Harkaway einfach zuviel hineingestopft.
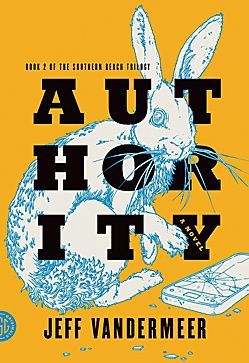
Jeff VanderMeer: "Authority"
Broschiert, 341 Seiten, FSG 2014
Und zum Abschluss noch einmal Paranoia total! Nach "Annihilation", dem genialen Auftaktband von Jeff VanderMeers "Southern Reach"-Trilogie, war die Neugierde ja groß, wie der Autor das Spannungslevel aufrechterhalten will. Er tut es, indem er einen Kontrapunkt setzt: "Authority" reflektiert die Geschehnisse aus Band 1 aus einer neuen Perspektive, stürzt dabei einiges an vermeintlich gesichertem Wissen um und gibt tatsächlich einige Antworten. Die aber umgehend noch mehr Fragen aufwerfen.
Andere Perspektive ...
Für ein Werk, das seinen Reiz daraus bezieht, dass es so vieles im Vagen belässt, grenzt es fast schon an einen Infodump, wenn auch mal ein paar harte Zahlen und Fakten geliefert werden. 32 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich an irgendeinem entlegenen Küstenstreifen - vermutlich im Südosten der USA - die Area X manifestiert hat: Ein 70 Meilen langes Gebiet, das von einer (fast) unsichtbaren Barriere umgeben ist, die bis in die Stratosphäre reicht. Wer zuvor dort gewohnt hatte, ist ebenso verschwunden wie alle sonstigen Anzeichen der Zivilisation. Area X präsentiert sich als unberührte Wildnis, deren Natur aber irgendeine schwer in Worte zu fassende Fremdheit ausstrahlt. Und diese Fremdheit scheint auch von all denen Besitz zu ergreifen, die Area X betreten.
38 Expeditionen hat die als "Southern Reach" bezeichnete Behörde bereits in die Region geschickt; offiziell zugegeben werden nur zwölf. Die wenigen Rückkehrer waren zumeist körperlich, vor allem aber geistig für den Rest ihres Lebens gezeichnet. "Annihilation" schilderte die Erlebnisse der "zwölften" Expedition. Da deren Mitglieder im Verlauf von Band 1 entweder gestorben oder verschwunden sind, ist es keine Überraschung, dass "Authority" neue Hauptpersonen einführt. Sehr wohl stellt es aber eine Überraschung dar, dass drei der vier Frauen der Expedition nun trotzdem wieder da sind. Oder zumindest etwas, das so aussieht wie sie.
... einer neuen Hauptfigur
Wir teilen also das mulmige Gefühl, das John Rodriguez alias "Control" befällt, wenn er die Biologin (die Erzählerin von Band 1) nach ihren Erlebnissen befragt, an die sie sich angeblich nur bruchstückhaft erinnern kann. Die Konfrontationen mit ihr bringen ihn regelmäßig aus dem Gleichgewicht ... als wäre das nicht ohnehin schon fragil genug. Als neuer Direktor von Southern Reach hat Control nicht nur mit den Mysterien von Area X zu kämpfen, sondern auch mit Widerständen von Seiten des alten Personals und jeder Menge seltsamer Verhaltensweisen seiner MitarbeiterInnen. Zudem wird er von persönlichen Dämonen geplagt, und das nicht nur in den beunruhigenden Träumen, die ihn nachts befallen.
Control stammt aus einer alten Geheimdienstdynastie. Seine Mutter stellt sich uns als geheimnisvolle Strippenzieherin im Hintergrund dar, Controls Verhältnis zu ihr ist gelinde gesagt ambivalent. Control's mother often seemed to him like a flash of light across a distant night sky. Here and gone, gone and here, and always remembered; perhaps wondered what it had been - what had caused the light. But you couldn't truly know it. Manchmal wirken Controls Assoziationen wie die Ausgeburten einer geradezu kindlichen Fantasie - etwa wenn er mit seinem anonymen Vorgesetzten "Voice" via Handy kommuniziert und sich ihn/sie als Megalodon vorstellt, der in einem wortwörtlichen Think Tank schwimmt.
Und natürlich ist es für Controls geistige Stabilität nicht förderlich, dass er nun für eine ebenso kafkaeske wie heruntergekommen wirkende Behörde arbeitet, deren Angehörige allesamt nicht ganz dicht zu sein scheinen. Rivalisierende Geheimdienst-Fraktionen, Doppelidentitäten, Angst machendes Beweismaterial, Geheimnisse, wohin man nur schaut, Lauschangriffe und Manipulation durch Hypnose: All das fügt dem literarischen Mix von Band 1 nun noch eine Prise John le Carré hinzu. "Authority" unterscheidet sich zwar im Setting von "Annihilation", behält aber den wichtigsten Faktor bei: das Gefühl, entrückt zu sein, den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Die Macht der Worte
"Terroir" wird zu einem zentralen Begriff des Romans, gemeint ist die Gesamtheit aller Faktoren, die an einem bestimmten Ort wirksam sind. In Band 1 war dieser Ort Area X, nun ist es die Southern-Reach-Behörde selbst. Und sie erweist sich als um keinen Deut weniger unheimlich oder surreal als die fremd gewordene Natur draußen. Warum hat sich Controls Amtsvorgängerin als Psychologin in die letzte Expedition eingeschmuggelt? (Sie war also die Kontrahentin der Erzählerin von Band 1, wie wir nun ganz beiläufig erfahren.) Warum hat sie eine mumifizierte Maus und eine nicht tot zu kriegende Pflanze aus Area X in ihrem Schreibtisch aufbewahrt? Und warum hat sie die Wände mit denselben Sätzen vollgekritzelt, die man in Band 1 im Inneren von Area X, geschrieben von einem nicht-menschlichen Wesen, vorgefunden hatte?
... unverständliche, an eine Beschwörung erinnernde Sätze, die man bei Southern Reach genauso ungern ausspricht wie das Wort "Aliens", das hier erstmals zögerlich fällt. Denn Worten wohnt eine Macht inne, die das Denken verändern könnte. Daran sollte man übrigens auch bei der Lektüre denken: Wie ein paar gekonnte Wortspiele zeigen, ist Sprache für Jeff VanderMeer kein bloßes Transportvehikel für den Plot; seine Bücher fordern aufmerksames Lesen.
Bald auch auf Deutsch erhältlich!
Dafür, dass Mittelteile meistens der schwächste Part von Trilogien sind (Setting und Plot sind etabliert, Höhepunkt und Auflösung müssen aber noch warten), versteht es "Authority", ordentlich zu fesseln. Denn ohne es zu bemerken, geraten nach und nach alle unter den Einfluss dessen, was sie nur zu studieren glauben. Und Area X beginnt sich zu verändern - da stehen im dritten Teil noch große Dinge bevor.
Der Abschlussteil "Acceptance" wird Anfang September erscheinen. Nahezu zeitgleich - gute Nachrichten für alle, die wegen VanderMeers intensiver Sprache vor der Originallektüre zurückschrecken - wird der Verlag Antje Kunstmann mit "Auslöschung" die Trilogie in deutscher Übersetzung starten.
Und so geht es weiter
In der nächsten Rundschau singen wir nicht den Post-WM-Blues, sondern - endlich!!! - die Wasserstoffsonate. Zwei Autoren, die ich sehr schätze - Daryl Gregory und Will McIntosh -, haben Neues herausgebracht. Und die eine oder andere Überraschung (auch für mich) wird es bis dahin wohl auch noch geben. "Bis dahin" ist gleichbedeutend mit "Bitte um etwas Geduld": Soccer kills the Lesezeit. Für Ungeduldige wird aber über die übliche Verlinkung aus dem Forum heraus das Gerüst der nächsten Rundschau zugänglich sein - angehende UrlauberInnen können sich da vielleicht noch rechtzeitig den einen oder anderen Strandbuchtipp vorab abholen. (Josefson, derStandard.at, 14. 6. 2014)