
Terry Pratchett & Stephen Baxter: "Der Lange Krieg"
Broschiert, 492 Seiten, € 18,50, Manhattan 2015 (Original: "The Long War", 2013)
Wenn man sich die unfassbare Flut an Reaktionen auf den Tod Terry Pratchetts durchliest - ob von Berufskollegen oder von Fans -, dann kann man mit Fug und Recht behaupten: Terry Pratchett war einer der meistgeliebten Menschen auf dem ganzen Planeten. Was für eine wunderbare Bilanz eines Lebens - und vielleicht das Einzige, was noch schwerer wiegt als die Bücher, die er uns hinterlassen hat.
Noch in der Trauerphase ist nun der zweite Teil der Saga von der "Langen Erde" auf Deutsch erschienen, in der der unerreichte Meister der Funny Fantasy einen seiner seltenen Ausflüge in die Science Fiction unternahm und dafür mit Hard-SF-Autor Stephen Baxter kooperierte. Es ist nicht wirklich überraschend, dass die "Lange Erde" bei SF-Fans besser ankam als bei denen, die gerne einen weiteren Scheibenwelt-Roman gehabt hätten. Letztere beklagten, dass sie hier Pratchetts Handschrift vermissen würden. Aber das ist ein Irrtum: Ohne Pterry sähen diese Bücher nicht so aus, wie sie aussehen. Und sie wären nicht so gut.
The Big Picture ...
Zur Erinnerung: Im ersten Band der Reihe wurde eines schönen Tages der Bauplan einer billigen kleinen Erfindung veröffentlicht, die es Menschen ermöglicht, zu parallelen Erden zu wechseln. "Westlich" und "östlich" unserer Welt reihen sich ungezählte Millionen von Erden aneinander - jede ein bisschen anders als ihre Nachbarinnen, aber alle mit einer großen Gemeinsamkeit: Nirgendwo sonst als auf unserer alten Datumerde haben sich Menschen entwickelt. Ein noch nie dagewesenes Zeitalter der Kolonisierung beginnt.
Band 2 setzt 25 Jahre nach dem legendären Wechseltag ein. Inzwischen pendeln Twains genannte Luftschiffe zwischen tausenden neubesiedelten Welten, die zu nutzungsorientierten Großeinheiten wie dem "Minengürtel" oder dem "Weizengürtel" zusammengefasst wurden. China sprengt auf einer der Parallelwelten Teile des Himalaya weg, damit Zentralasien auch ein bisschen Regen abbekommt (geht's schief, probiert man halt "nebenan" was anderes aus). Und dann sind da noch Lücken in der Weltenreihe, in denen gar keine Erde existiert, weil sie in dieser Variante der Wirklichkeit einer kosmischen Katastrophe zum Opfer gefallen ist. Über solche Lücken kann man de facto "zu Fuß" in den Weltraum wechseln (was in Band 3 noch eine Rolle spielen wird). All das ist typisch Stephen-Baxter'sches Denken im großen Maßstab.
... und die großen kleinen Dinge des Lebens
Pratchett kommt da ins Spiel, wo Baxters Fähigkeiten seit jeher recht überschaubar waren: Der große Humanist verleiht dem Ganzen nämlich eine menschliche Note. Nehmen wir zum Beispiel eine Episode aus "Der Lange Krieg", in der ein Trupp US-Soldaten in einer nach Unabhängigkeit strebenden Kolonie abgesetzt wird, um den aufmüpfigen SiedlerInnen klarzumachen, dass Washington auch in parallelen Amerikas das Sagen hat.
Betreten stellen die strammen Krieger allerdings fest, dass sie zu doof waren, die nötige Ausrüstung mitzunehmen, um sich dort zurechtzufinden. Und so müssen sie sich von einem freundlichen Siedler mitnehmen lassen wie verirrte Touristen. Anstatt Eindruck für die Militärmacht der USA zu schinden, stehen sie letztendlich peinlich berührt im Versammlungshaus der Kolonie herum - in Socken, weil man vor dem Eintreten doch bitte die Schuhe ausziehen möge. So etwas konnte nur Terry Pratchett einfallen.
Amerikanische Themen
Im ersten Band verlegten die beiden britischen Autoren den Frontier-Mythos auf eine neue Ebene. Nun setzen sie mit weiteren uramerikanischen Topoi fort: der Sklaverei und der Verdrängung der amerikanischen Ureinwohner. Beides dargestellt anhand der Trolle genannten Hominiden, die die Lange Erde bevölkern. Eine intelligente und friedliche Spezies, die keine Technologie entwickelt hat und aus eigenem Vermögen zwischen den Welten wechseln kann. Sie werden oft für körperliche Schwerarbeiten herangezogen, zudem setzt ihnen die unaufhaltsame Ausbreitung der Menschheit zu - so lange, bis die Trolle zu verschwinden beginnen, und niemand weiß, wohin.
Die "Ich will nicht"-Geste einer Trollmutter gebiert aber auch den Slogan derjenigen KolonistInnen, die sich von der Datumerde lösen wollen. Aus gutem Grund: Erst wurden sie nach der Emigration enteignet, jetzt sollen sie auch noch Steuern zahlen - und das alles für null Gegenleistung von daheim. Genüsslich lassen Baxter & Pratchett die "No taxation without representation"-Bewegung des 18. Jahrhunderts wiederaufleben. Nur sind die USA diesmal die herrschsüchtige Kolonialmacht. Die Spannungen steigen, es droht der im Titel angekündigte Lange Krieg.
Themen, Themen und noch mehr Themen
Darüberhinaus werden wie schon in Band 1 weitere Welten der Langen Erde mit immer seltsameren Lebensbedingungen erkundet. So bricht eine chinesische Expedition zur symbolischen 20-Millionen-Welten-Marke im Osten auf. Mit an Bord das hochbegabte Mädchen Roberta Golding, das bereits das nächste Thema ankündigt: das erste Auftauchen eines neuen Menschen, eines Homo superior. Außerdem werden weitere intelligente Spezies entdeckt, und zu allem Überfluss beginnt auch noch der Yellowstone-Supervulkan Probleme zu machen. Eh schon wissen: Der, der etwa alle 650.000 Jahre ausbricht und zuletzt vor ... etwa 650.000 Jahren ausgebrochen ist.
Die riesige Themenfülle - ein typisch Baxter'sches Phänomen, for better, for worse - erfordert natürlich ein entsprechend großes Personal. Mit dabei sind neben einigen neuen Hauptfiguren auch wieder die versierten WechslerInnen Sally Linsay und Joshua Valienté. Letzterer mittlerweile in einer verschlafenen Kolonie namens Weiß-der-Kuckuck-wo ansässig und glücklich verheiratet ... und seine Frau ist so richtig gar nicht begeistert davon, dass er wieder zum Weltenwandern aufbricht. Aber wenn der Lockruf der Langen Erde erschallt, was soll man dann tun! Selbst die mittlerweile schwer kranke Polizistin Monica Jansson kann sich dem nicht entziehen und mischt wieder kräftig mit.
Skynet lächelt dir zu
Und dann ist da natürlich noch Lobsang, der mehr denn je hinter den Kulissen die Strippen zieht. Und was auch immer er vor seiner Existenz als Künstliche Intelligenz ursprünglich war - inzwischen hat er sich zu einer Art freundlichem Skynet mit ungezählten Backups entwickelt, die einfach überall sind, um den Fortschritt der Menschheit zu gewährleisten.
Seine Beinahe-Allmacht ist Lobsang schon selbst unheimlich geworden: Genug, um sich mit einem Bewusstseinsupload der verstorbenen Nonne Schwester Agnes einen digitalen Widerpart zu erschaffen. Die fluchende, motorradfahrende und gerne handgreiflich werdende wilde Hummel soll gewissermaßen das Orakel seiner Matrix werden. Mit dem Vergleich hab ich jetzt zwar zwei Filmreihen in einen Topf geschmissen, aber gab es nicht ohnehin Pläne, die "Terminator"- und "Matrix"-Franchises verschmelzen zu lassen? Was ist daraus eigentlich geworden? Lobsangs postmortale Existenz und sein Weg zur Quasi-Göttlichkeit sind zugleich Anlass für Gedanken über Religion, die auffallend oft in "Der Lange Krieg" auftauchen.
Rechnet man das alles zusammen, kommt man auf einen Roman, der hart an der Grenze der inhaltlichen Belastbarkeit steht (mir aber trotzdem fast so gut gefallen hat wie sein Vorgänger). Da die "Lange Erde" als Reihe konzipiert war - Band 3, "The Long Mars", ist auf Englisch bereits erschienen -, musste man sich bislang keine Sorgen machen, dass das alles nicht noch in befriedigender Form abgehandelt werden würde. Doch nun, nach Pratchetts Tod? Es ist zu befürchten, dass nach der Scheiben- und unserer Rundwelt nun eine dritte verwaist zurückbleiben wird.

Ann Leckie: "Die Maschinen"
Broschiert, 541 Seiten, € 15,50, Heyne 2015 (Original: "Ancillary Justice", 2013)
All die Lorbeerkränze auf dem Cover, das sieht ja aus wie das Filmplakat eines Oscar-Gewinners! Und es sind bei weitem nicht alle Preise, die die US-Amerikanerin Ann Leckie im vergangenen Jahr mit ihrem Debütroman "Ancillary Justice" abgeräumt hat. – Das erhofft man sich höchstens in seinen allerheimlichsten Träumen, wenn man sich nach einer Reihe Kurzgeschichten erstmals traut, einen Roman zu schreiben, dass der dann derart einschlägt.
Mein Hauptresümee nach der Lektüre war ein unerwartetes: Nämlich wie leicht sich das Ganze liest! Das war nicht unbedingt zu erhoffen – all die hymnischen Rezensionen, denen man wirklich nirgendwo entgehen konnte, hatten da schon eine gewisse Schwellenangst aufgebaut: Von wegen sprachliche Herausforderung, innovative Genderbetrachtungen, verwirrende Identitäten und so – alles drin. Und trotzdem ist "Die Maschinen" überaus flüssig zu lesen, also keine Angst.
Die galaktopolitische Ausgangslage
Beginnen wir mal mit dem großen Rahmen – es ist das bekannte Szenario vom interstellaren Imperium. Unter den diversen menschlichen Sternenreichen in Leckies Romanwelt ist das der Radchaai seit Jahrtausenden auf kriegerische Expansion bedacht. In ihrer Vorgehensweise lassen sie dabei abwechselnd an das römische Reich, den britischen Kolonialismus und Nazi-Deutschland denken. Status und Hierarchie werden bei den Radchaai großgeschrieben, zudem haben sie einen ausgeprägten Hang zu Ritualen: von der Teezeremonie über die tägliche Interpretation von Omen bis zu ihrer Religion, die ein bisschen an den Hinduismus erinnert. Kurz: Von der Makro- bis zur Mikroebene ist hier alles penibel durchorganisiert.
Auftritt Breq auf der Gegenwartsebene des Romans. Die Ich-Erzählerin des Romans ist eine ehemalige Hilfseinheit, von Nicht-Radchaai als Leichensoldatin geschmäht: ein toter Mensch, dessen Körper einem KI-gesteuerten Kollektiv einverleibt wurde. Als letztes überlebendes Fragment ihres Kollektivs hält sich Breq derzeit auf einem Provinzplaneten außerhalb der Radchaai-Domäne auf, um einen ehrgeizigen Plan zu verwirklichen: Sie will eine antike Superwaffe erwerben, mit der sie die Herrin der Radchaai töten kann. Ungeplant gabelt sie dabei auch die drogensüchtige Leutnantin Seivarden auf und nimmt diese ebenfalls mit in die Heimat zurück.
Die Gendersache
... Leutnantin oder Leutnant Seivarden genau genommen. Denn wie wir später erfahren, handelt es sich bei "ihr" um einen Mann, und damit sind wir bei der ersten Besonderheit des Romans angelangt: Alle Figuren des Romans werden grundsätzlich als "sie" bezeichnet. Die Radchaai unterscheiden nicht nach dem biologischen Geschlecht – das spielt allenfalls beim Fortpflanzungsakt eine Rolle, in allen anderen sozialen Kontexten ist es bedeutungslos. Ursula K. Le Guin musste für die gleiche Grundidee in "Die linke Hand der Dunkelheit" noch ein Volk mit besonderer Biologie erfinden. Leckies Radchaai hingegen reicht es, die Konvention verinnerlicht zu haben, Gender als soziales Konstrukt zu verstehen.
Da wir es gewohnt sind, geschlechterdichotomisch zu denken, prägt diese sprachliche Besonderheit natürlich das Leseerlebnis. Im Deutschen sogar noch stärker, da der Übersetzer Bernhard Kempen hier auch sämtliche Hauptwörter, die im Englischen noch geschlechtsneutral waren, dem "sie" angepasst hat – also immer "Ärztin" für "doctor" usw. Im Vorwort des Romans erklärt Kempen seine Wahlmöglichkeiten, wie er mit dem generischen Femininum des Originaltextes umgehen konnte – er hat wohl einige Reaktionen vorausgeahnt. Es gibt auch tatsächlich in LeserInnenforen lustige Statements von Feminismusphobikern, die aber am Thema vorbeigehen – genausogut könnten sich die Radchaai schließlich auch alle als "er" bezeichnen. Die Chance war fifty-fifty.
Den – ablehnenden ebenso wie begeistert zustimmenden – Reaktionen zum Trotz ist das aber nicht das Hauptanliegen des Romans und schon gar nicht der Radchaai. Allenfalls hat Breq außerhalb der Radchaai-Domäne, wo man/frau so denkt und spricht wie wir, Probleme, das richtige Personalpronomen zu erwischen. Unwichtig beispielsweise im Vergleich zu dem Gschisti-gschasti, das die Radchaai ständig um das Thema rituelle Reinheit machen, was sich unter anderem im Tragen von Handschuhen äußert. (Erinnert mich ein wenig an Ricardo Pintos Fantasy-Trilogie "Steinkreis des Chamäleons", in der das Herrenvolk die unreinen Außenlande nur mit monströsen Plateau-Pumps betritt.)
Wir sind ich
Auf der in einem parallelen Strang erzählten Vergangenheitsebene des Romans – 19 Jahre zuvor – ist gerade ein Planet frisch annektiert worden und unsere Erzählerin steckt mitten im lokalpolitischen Hickhack. In buchstäblich vielfacher Weise – und damit sind wir bei der zweiten, wichtigeren Besonderheit des Romans. Nun ist unsere Erzählerin – dieselbe wie in der Gegenwart – ein riesiges Kriegsschiff mit tausenden Hilfseinheiten. Sie ist aber auch eine Armee von LeichensoldatInnen. Sie ist ein kleiner Trupp auf der Oberfläche des Planeten. Und sie ist ein einzelnes Individuum. All diese unterschiedlich großen Teilmengen des KI-Kollektivs verstehen sich jeweils als ein und dasselbe "ich".
In einer faszinierenden Passage lesen wir, wie "ich" (ein kleiner Landungstrupp mit der Bezeichnung Eins Esk) in den Orbit fliegt, wo sich "ich" (das Kriegsschiff "Gerechtigkeit der Torren") aufhält, mit dessen geistigem Verbund verschmilzt, als würde man zwei Mengen Wasser zusammenschütten, und dabei die ganze Zeit über "ich" bleibt. Ann Leckie geht dabei wirklich beeindruckend konsequent vor. Während uns andere AutorInnen lesetechnische Hilfestellungen geben, um diverse Klone/Avatare/Manifestationen/Proxys/was auch immer jederzeit voneinander unterscheiden zu können, verwendet Leckie stets nur ein Pronomen – ganz wie es dem für uns fremdartigen Denken der Erzählerin entspricht. Das hab ich in der Form tatsächlich noch nicht gelesen.
Derselbe psychedelische Effekt stellt sich beim eigentlichen Plot-Driver des Romans ein. Anaander Mianaai, die Herrin/der Herr der Radchaai, besteht nämlich aus tausenden identischen Körpern, die dennoch dieselbe Person sind. Oder zumindest waren, denn inzwischen ziehen offenbar nicht mehr alle Inkarnationen am selben Strang – was Mianaai aber nicht so recht wahrhaben will. Aufgrund ihrer "Schizophrenie" schwebt das Imperium seit einiger Zeit am Rande eines schleichenden Bürgerkriegs – und der droht nun endgültig auszubrechen.
Identitäten
"... besteht nicht jede Identität eigentlich aus Fragmenten, zusammengehalten durch eine passende oder nützliche gemeinsame Geschichte, die normalerweise niemals als Fiktion erkennbar wird?", denkt Breq einmal. Auf jeden Fall ist Identität das Kernthema das Romans: ob geschlechtlich, kulturell, kollektiv versus individuell – oder auch was das Spannungsfeld zwischen gehorsamer Pflichterfüllung und dem Drang, dem eigenen Gewissen zu folgen, betrifft. Letzteres spielt gerade in einer tendenziell faschistoiden Gesellschaft wie der der Radchaai eine wesentliche Rolle.
Neben vielem anderen ist "Die Maschinen" auch die Geschichte, wie eine solche Identität – die von Breq – immer mehr an Profil gewinnt (was auch belohnt werden wird). Dass Breq in der Zeit zwischen den beiden Handlungsebenen schon einen beträchtlichen Weg zurückgelegt hat, zeigt ihre Reaktion auf das Angebot einer Nicht-Radchaai-Ärztin, ihre ursprüngliche Identität (also die, bevor sie zur Leichensoldatin verwurstet wurde) wiederherzustellen. Für uns wie die Ärztin mag dies wünschenswert klingen, doch Breq lehnt ab: "Sie meinen, Sie können mich töten. Sie können meine Selbstwahrnehmung zerstören und sie durch eine ersetzen, die Sie akzeptieren können." Dieses Selbstbewusstsein spiegelt die Selbstverständlichkeit wider, mit der uns Leckie mit einer anderen Art des Denkens konfrontiert.
Unterm Strich
Aufgrund der Genderthematik liegen Vergleiche mit Ursula K. Le Guin, Joanna Russ oder James Tiptree Jr. nahe. Allerdings hat mich "Die Maschinen" auch an etwas völlig anderes erinnert, nämlich an "Dune". Nicht nur aufgrund der feudalen Gesellschaft der Radchaai, ihrer Rituale oder ihrer ausgefeilten Zeichensprache – ganz zu schweigen von den undurchsichtig verschachtelten Plänen der ProtagonistInnen. Sondern vor allem wegen der leicht abstrakten Wirkung, die die über weite Strecken von Dialogen getragene Handlung beim Lesen auf mich hatte. Ähnlich wie bei Frank Herbert hat sich auch hier mitunter der Eindruck bei mir eingestellt, es mit einem Drama (nicht übertragen, sondern im Sinne eines Theaterstücks gemeint) zu tun zu haben.
Zumindest in einem Punkt kann man denen, die den Roman nicht so mochten, aber zustimmen: Tempo ist nicht seine größte Stärke (das wird das Buch auf der nächsten Seite dafür dann überkompensieren ...). "Die Maschinen" schreitet recht gemächlich voran – hat aber auch alle Zeit der Welt, es ist ja erst der Auftaktband einer Trilogie. Hoffentlich verkauft es sich gut genug, dass die weiteren Bände ebenfalls auf Deutsch erscheinen. Band 2, "Ancillary Sword", ist im Original bereits erhältlich. Ich freu mich drauf.
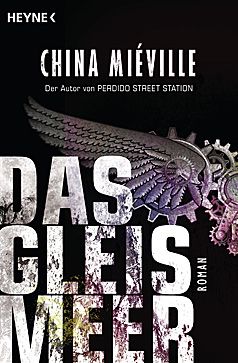
China Miéville: "Das Gleismeer"
Broschiert, 398 Seiten, € 14,40, Heyne 2015 (Original: "Railsea", 2012)
Endlich mal wieder ein Miéville, der so richtig Spaß macht! Mit etwas Verspätung & nach einem nicht ganz verständlichen Verlagswechsel haben wir jetzt auch das Buch auf Deutsch in Händen, mit dem der einzigartige China Miéville seine mit Power durchgezogene Ein-Roman-pro-Jahr-Phase abschloss, um sich vorerst anderen Dingen zu widmen - unter anderem einer Comic-Serie ("Dial H").
Nicht ganz verständlich ist der Wechsel für mich deshalb, weil Bastei Lübbe Miéville doch so lange die Treue hielt - weit über die populären Bas-Lag-Romane hinaus. "Die Stadt & die Stadt" gehört für mich zwar zum Besten, was Miéville je geschrieben hat; ich kann allerdings nachvollziehen, warum viele Altfans damit nicht so recht warm wurden. & was die darauffolgenden "Der Krake" & "Stadt der Fremden" anbelangt: Die haben unter ihrem eigenen Gewicht doch schon ziemlich gestöhnt; bei beiden hat mir irgendwie der Drive gefehlt. & just wenn diese Durststrecke endet & Miéville mit "Railsea" wieder einen deutlich leichter verdaulichen Roman schreibt, plumpst er aus dem Programm. Da hat Heyne im richtigen Moment zugeschlagen!
Applaus für den Schauplatz!
Es könnte glatt eine Schwesterwelt zu Bas-Lag sein, auf die es uns hier verschlägt. An bizarrem Worldbuilding mangelt es diesem Planeten jedenfalls nicht. Der möglicherweise die Erde einer fernen Zukunft ist - nach dem Plastozän (schönes Wort!) bzw. dem Götterstreit (naturwissenschaftliche vs. metaphysische Erklärung, pick your choice). In den höheren Schichten der Atmosphäre kreisen Lovecraft'sche Monstrositäten, nachdem Generationen von außerirdischen Besuchern dort ihren Müll verklappt haben. So richtig spannend aber ist's zu ebener Erd'.
Denn die Oberfläche des Gleismeers ist ein einziges gigantisches Schienengewirr. Fast jeder Quadratmeter ist von sich millionenfach verzweigenden, wieder zueinander findenden & Endlosschleifen bildenden Gleisen bedeckt. Das "&"-Zeichen sieht Miéville als schönes Symbol dafür an, weshalb er es im gesamten Roman anstelle des Worts "und" verwendet (tsss ... welcher Sadist behelligt denn seine LeserInnen mit sowas?). & da wir uns einmal mehr auf einem Planeten mit nicht einordenbarer Technologiestufe befinden, ziehen auf diesen Gleisen Dampf- & Dieselzüge ebenso ihre Bahn wie solche, die mit Wind- oder Solarkraft betrieben, von Rhinozerossen gezogen oder von Galeerensklaven vorangestrampelt werden.
Typisch Miéville'scher Brainstorming-Stil also: Gib mir ein Themenfeld & ich hau alles raus, was mir dazu einfällt. & wie immer, wenn Miéville mal wieder ein neues semantisches Feld entdeckt hat, das er beackern bzw. bis zur Neige ausbeuten kann, hört man ÜbersetzerInnen weltweit aufstöhnen, weil sie sich schon wieder ein neues Fachlexikon zulegen müssen - im konkreten Fall zur Eisenbahnkunde (Schleppweiche? Gleiskoppelspule?? ächz!). Gleiches gilt aber auch für die Fauna des Gleismeers, denn unter den Schienen graben sich monströse Lebewesen durch den Boden: Von Maulwürfen über Ameisenlöwen bis zu Würmern & Kaninchenkäuzen zerrt der Autor so ziemlich alles ans Licht, was unsere Erde an unterirdischen Bewohnern hergibt - natürlich gigantifiziert & groteskifiziert: ein Kaleidoskop des zoologischen Irrsinns.
Moby Dick, aber nicht Dumm
Womit wir auch schon mitten in der Handlung wären, denn das Schiff ... pardon: der Zug "Medes" kreuzt auf der Jagd nach einem gebirgsgroßen Maulwurf, einem Moldywarp, übers Gleismeer. Mit an Bord die Hauptfigur, der Jugendliche Sham, der als Assistent des Bordarztes fungiert. Befehligt wird die bunte Crew der "Medes" von Kapitänin Abacat Naphi. Die eine Armprothese trägt. Weil ein gigantischer Moldywarp ihr einst den Arm abgerissen haben soll. Den sie jetzt wie besessen durch die Weiten des Gleismeers verfolgt. Einen Moldywarp, der sich durch sein helles Fell von seinen Artgenossen unterscheidet ...
Anfangs macht man sich tatsächlich noch Sorgen, dass Miéville hier einfach Herman Melvilles "Moby Dick" unter schrilleren Umweltbedingungen nacherzählen könnte. Aber dafür ist er zum Glück viel zu gewitzt. Miéville macht in Melville, das schon. Aber auf der Meta-Ebene. Der Wal in "Moby Dick" ist eine der klassischen Projektionsflächen der Literaturgeschichte. In "Gleismeer" hingegen wird das Spiel mit den Deutungsebenen offen ausgesprochen und in die Handlung miteinbezogen. Der Wal ist wortwörtlich Käpt'n Naphis Philosophie - & andere Kapitäne haben ihrerseits Philosophien in Gestalt einer tierischen Nemesis:
Nicht jeder Kapitän aus Streggeye Land hatte eine solche, aber eine erhebliche Anzahl von ihnen entwickelte eine zwiespältige Affinität zu einem bestimmten Tier, in welchem sie Bedeutungen, Potenziale, Erkenntnisse verkörpert sahen oder zu sehen glaubten. An einem gewissen Punkt (...) wechselte die professionelle Einstellung des Jägers gegenüber dem Wild als auserkorenem Opfer auf ein anderes Gleis & wandelte sich zur Hingabe an ein Tier, das nun zur Weltanschauung geworden war. & Sham stellt fest: Ihm kam es vor, als bedauerten die Kapitäne manchmal, nur eine begrenzte Anzahl Gliedmaßen zur Verfügung zu haben, die man einer fixen Idee opferte. Man war ein Beinloser oder ein Armloser: Hätte man noch etwas anderes zu verlieren - Fühler, Tentakel, Flügel -, gäbe es zusätzliche Möglichkeiten für die prägnanten Narben des Philosophierens. Also wenn das kein großartiger Meta-Moby ist, dann weiß ich auch nicht.
Folge deinem Stern ... aber im Eilzugstempo, bitteschön
Zentrales Thema des Romans ist letztlich, eine Aufgabe zu haben, ein Lebensziel. Sham wird seine Aufgabe erst im Verlauf des Romans finden - & wenn sie sich ihm zum ersten Mal zeigt, wird er zu lange zögern. In einem Zugwrack findet Sham nämlich eine Speicherkarte, auf der etwas völlig Unvorstellbares enthalten ist: ein Bild von einem einsamen Schienenstrang, der aus dem Gleismeer hinausführt. Sham wird das junge Geschwisterpaar Caldera & Dero Shroake kennenlernen, die sich sofort aufmachen, den Ort zu finden, an dem dieses "unmögliche" Bild entstand. Sham wie gesagt vergurkt seine erste Chance, die beiden auf ihrem Abenteuer zu begleiten. Aber gehen wir mal davon aus, dass er noch eine zweite erhalten wird.
Es folgt eine halsbrecherische Jagd übers Gleismeer, in deren Verlauf Miéville zum dritten Mal den Brainstorming-Modus anwirft. Denn er wartet mit allem auf, was Seefahrermythen von der Odyssee bis zu Robinson Crusoe so angehäuft haben: Piratenüberfälle, Seeungeheuer, Geisterschiffe, Schatzsuche, Schiffbruch, Seegefechte, Schiffsfriedhöfe & so weiter & so weiter. Alles natürlich auf Schiene gelegt & erzählt mit dem Überschwang von einem, der in einer Hafenkneipe bei bester Laune & mit diversen Promille im Blut das tollste Seemannsgarn spinnt. Gleisgarn in diesem Fall.
Es ist immer intelligent, was China Miéville tut. Aber diesmal macht's auch wieder so richtig Spaß. Ich freue mich jetzt schon auf seine Storysammlung "Three Moments of an Explosion", die im Sommer erscheinen soll.

Laird Barron & Michael Kelly (Hrsg.): "Year's Best Weird Fiction"
Broschiert, 336 Seiten, ChiZine Publications 2014
Nachdem China Miéville ja als Galionsfigur der New-Weird-Bewegung gilt, bietet es sich an, gleich im Anschluss den ersten Band einer neuen Anthologie-Reihe zu "weirder" Literatur vorzustellen. Herausgeber und Koordinator Michael Kelly will für jedes dieser noch folgenden Jahres-Best-ofs jeweils einen Co-Herausgeber engagieren, der sich in diesem Bereich bereits verdient gemacht hat und seine persönliche Perspektive einbringen kann. In der ersten Ausgabe war dies ein allseits anerkannter Erneuerer des Horror-Genres, der US-amerikanische Autor Laird Barron ("Occultation").
Ein Begriff ...
Was ist überhaupt "weird“? Kelly spricht von einem Erzählmodus, nicht von einem Genre - was sich in den 22 hier versammelten Geschichten widerspiegelt, die formal von SF über Spukgeschichten und Steampunk bis zu Magic Realism und sogar über die Phantastik hinaus reichen. Barron bringt es so auf den Punkt: When there’s a sense of dislocation from mundane reality; the suspension of the laws of physics, an inversion or subversion of order, a hint of the alien. Dass dieses Gänsehautgefühl angesichts einer brüchig werdenden Realität schon mit minimalem Aufwand erzielt werden kann, führt Simon Strantzas in "The Nineteenth Step“ vor, in dem ein junges Paar in ein neues Haus zieht und feststellt, dass die Treppe zwischen den beiden Stockwerken eine Stufe mehr enthält, als sie enthalten dürfte.
Andere AutorInnen gehen’s weniger subtil an und belassen es nicht bei einem hint: Wir bekommen es auch mit Riesenmonstern zu tun, mit einer Frau, die ein Tier gebärt, Vulkanausbrüchen, leicht prätentiösen Lovecraft-Huldigungen, der Kollision zweier Himmelskörper oder einem Drag-Queen-Kommando, das die Festung eines Mad Scientist auf dem Mars stürmt. Letzteres ("Dr. Blood and the Ultra Fabulous Glitter Squadron“ von A. C. Wise) bleibt für mich freilich trotz seines Unterhaltungswerts die einzige Fehlbesetzung dieser Anthologie, weil es einfach ein überdrehtes Destillat von Pulp-Szenarien ist und Barrons obiger Definition von "weird“ nicht wirklich entspricht.
... und seine gelungene Umsetzung
Eines der Highlights der Sammlung ist die aus dem Chinesischen übersetzte Erzählung "Year of the Rat“, in der Chen Qiufan eine nahe Zukunft zeichnet, wie sie auch von Paolo Bacigalupi stammen könnte. Im Zuge einer landesweiten Kampagne wie zu Maos Zeiten sind Studenten in den Dschungel ausgezogen, um "Neoratten“ zu jagen. Die genmodifizierten Tiere zeigen allerdings beunruhigende - oder vielleicht besser: tragische - Anzeichen von Intelligenz und sogar Kultur. Und letztlich finden sich Mensch und Tier gleichermaßen auf dem Spielbrett der globalen Wirtschaftspolitik wieder.
Ebenfalls beeindruckend ist Scott Nicolays "Eyes Exchange Bank“, dessen Protagonist einen alten Freund in einem heruntergekommenen Kaff besucht. Dort irritieren ihn nicht nur seltsame optische Effekte, ihm ziehen auch die untot wirkenden BewohnerInnen der Stadt (keine Zombies!) die Gänsehaut auf. Die unheimliche Stimmung baut sich hier ganz langsam auf … und dann geht es plötzlich sehr schnell. Ein anderes kleines Städtchen löst sich in Livia Llewellyns "Furnace“ Schritt für Schritt auf - unter Begleiterscheinungen, die an David Lynchs "Eraserhead“ erinnern. Die Geschichte zählt zu den surrealsten dieser Sammlung und ist völlig offen für Interpretationen.
Weitere Highlights
Bekannte Namen bürgen in Anthologien meistens für verlässliche Qualität, und das ist hier nicht anders. "Punktown“-Schöpfer Jeffrey Thomas lässt den Protagonisten von "In Limbo" eines Tages erwachen und überall nur noch Weißes Rauschen wahrnehmen: Am Fernseher, am Telefon, am Computer und sogar vor dem Fenster. Toller Spagat, das dockt nämlich an Existenzialismus genauso an wie an mainstreamige Horrorfilme à la "The Darkest Hour“ oder "They“. Und der mit "Southern Reach“ wohl endgültig zum Genreheiligen erklärte Jeff VanderMeer, der selbst schon eine "Weird“-Anthologie herausgegeben hat, darf für sich verbuchen, die allerweirdeste Geschichte zu dieser Sammlung beigetragen zu haben. Wie bei einem Staffellauf reichen die ProtagonistInnen von "No Breather in the World But Thee“ die Fackel der Handlung aneinander weiter, ehe sie einer nach dem anderen unter bizarren Umständen zu Tode kommen. Dafuq did I just read?
Den Mehr-als-nur-ein-Geheimtipp-Autor Michael Blumlein hab ich schon länger auf meiner To-do-Liste, und die faszinierende Novellette "Success", in die Blumlein sein Fachwissen als Mediziner einbringen konnte, ist dafür ein weiterer Ansporn. Das akademische Enfant terrible Jim arbeitet darin manisch an einer Theorie zur Epigenetik und einer noch umfassenderen "Perigenetik" … unter anderem indem er im Garten eine hochkomplexe Schrottskulptur baut und mit seinem im Keller eingesperrten Zweiten Ich ringt. Die Epigenetik - also der Einfluss äußerer Faktoren auf die Aktivität von Genen - ist aber nicht nur das Thema der Erzählung, sie strukturiert gewissermaßen auch deren Handlung: Das Doppelgängermotiv symbolisiert, wie aus derselben biologischen Grundlage durch äußere Einflüsse gänzlich unterschiedliche Ergebnisse (in diesem Fall: Personae) herauskommen können. Ein kompliziertes und dennoch in sich wunderschön rundes Gedankenspiel.
Die Schwedin Karin Tidbeck ("Jagannath"), eine Meisterin genialer Irritation, serviert eine allegorische Erzählung über Verantwortung und menschliche Beziehungen, in der die Tochter einer schroffen Astronomin ihre erste Periode erlebt, während der Mond auf die Erde herabzustürzen droht. Und auch Maria Dahvana Headleys "The Krakatoan" dreht sich um die Tochter eines Astronomen - diese hier trifft auf einen Berufskollegen ihres Vaters, der seltsamerweise ein Teleskop aufs Erdinnere ausrichten will (ein ähnliches Szenario hatte auch Laird Barron schon mal entworfen). Und obwohl die Geschichte noch mit Menschenopfern aufwarten wird, bleiben mir vor allem ihre komischen Aspekte in Erinnerung: Herrlich, mit welcher Selbstverständlichkeit das Kind die Misslichkeiten seines Lebens berichtet - etwa dass die dritte Ehefrau des Vaters beim Auszug den halben Hausrat mitgenommen hat ... inklusive des Türknaufs.
I see dead people!
Sowohl in Richard Gavins "A Cavern of Redbrick" als auch in Anna Taborskas "The Girl in the Blue Coat" wirft ein in der Vergangenheit verübtes Verbrechen seinen Schatten auf die Gegenwart - und zwar in Form eines Geists, der seine Leidensgeschichte enthüllen will. Während Taborska dafür auf den Holocaust zurückgreift und eine ganz eigene Variante von Erbschuld entwirft, spielt Gavin geschickt mit den Interpretationsmöglichkeiten seiner Erzählung.
Am wenigsten konnte ich noch mit den Geschichten anfangen, die sich an Personen der Historie abarbeiten, etwa der Dichterin Emily Dickinson, H. P. Lovecraft und Oscar Wilde oder einer Patientin Sigmund Freuds. Schon interessanter eine Erzählung, die auf Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen schielt: John R. Fultz gelingt mit "The Key to Your Heart Is Made of Brass" das Kunststück, eine posthumane Steampunk-Geschichte zu schreiben, in der alle Protagonisten mechanische Körper haben. Die Krimihandlung selbst könnte origineller sein - aber die bizarre Ausstattung ist erstklassig.
Mit dem Wahnsinn unter einem Dach
Ein gutes Mittel, um Barrons sense of dislocation zu erzielen, ist es, uns mit ErzählerInnen bzw. Hauptfiguren zu konfrontieren, deren Perspektive sich im Lauf des Geschehens als nicht verlässlich entpuppt. In Paul Tremblays "Swim Wants to Know If It's As Bad As Swim Thinks" ist dies beispielsweise eine Mutter auf Meth, die ihre bei Pflegeeltern untergebrachte Tochter entführt, um sie zu retten, während sich gigantische Monster aus dem Meer erheben.
Mit viel einfacheren Mitteln zwingt uns Damien Angelica Walters in "Shall I Whisper to You of Moonlight, of Sorrow, of Pieces of Us?" zum Umdenken. Wenn hier aus dem Nichts Fotos der/des Ex im Haus des Erzählers/der Erzählerin auftauchen, denkt man zunächst an eine Stalker-Geschichte, ehe sich das Ganze in eine unerwartete Richtung wendet. Sehr schön stimmig. Und ähnlich wie im Eingangsbeispiel "The Nineteenth Step" eine gelungene Beweisführung, wie dünn die Wand sein kann, die uns vom Wahnsinn trennt. Was zugleich die zentrale Botschaft dieser sehr lesenswerten Anthologie sein dürfte.

Henning Koch: "The Maggot People"
Broschiert, 231 Seiten, Dzanc Books 2014
Nach Hannu Rajaniemi und Karin Tidbeck kommt mir mit dem Schweden Henning Koch nun schon der dritte Skandinavier binnen kurzem unter, der auf Englisch schreibt. Spricht für guten Sprachunterricht im Norden. Und Koch, der seine Kenntnisse im Rahmen langer Auslandsaufenthalte verfeinert hat, geht noch einen Schritt weiter: Er übersetzt sogar ins Englische, das er mittlerweile als seine erste Sprache betrachtet.
Nachdem Koch zuvor bereits einige Kurzgeschichten veröffentlicht hatte, ist "The Maggot People" nun sein erster Roman. Und den kann man sich mit seiner Mischung aus absurden Einfällen, schwarzem Humor, philosophischen Anwandlungen und nicht zuletzt seinem Ekelfaktor als eine Art europäische Variante von Bizarro Fiction vorstellen.
Ein neues Leben
Hauptfigur des Romans ist Michael, ein englischer Slacker Mitte 20, der noch nichts gefunden hat, zu dem er taugt. Aber immerhin hat er ein Haus in der Provence geerbt, nachdem seine Eltern beim Teetrinken in ihrem Eigenheim von einem entgleisten Zug überfahren worden sind. Schwarzer Humor, wie gesagt. Dass Michael vom Tod der Eltern recht ungerührt blieb, beschreibt seinen Charakter hinreichend.
Nur die junge Touristin Ariel vermag es, Michaels Interesse zu wecken. Ganz Ohr ist er spätestens, als sie ihm eröffnet, dass sie gar kein Mensch mehr ist, sondern ein anthropomorphes Kollektiv von Maden, das ihr Originalgehirn am Leben erhält. Bedauerlicherweise kommt diese Eröffnung erst nach dem ersten Sex - bei dem hat sie Michael nämlich infiziert, um ihn ebenfalls zu einer Madenperson zu machen. Für Michael beginnt ein ganz neues Leben.
Nächste Station Wahnsinn
"The Maggot People" hat die Struktur eines Schelmenromans, soll heißen: Michael stolpert von einer bizarren Begegnung zur nächsten. Da hätten wir zum Beispiel Günter, eine Madenperson in Gestalt eines Hundes, der Houellebecq liest und der offenbar irgendwann mal ein Österreicher war (auch wenn sich in seiner wirren Lebensgeschichte Österreich, die Schweiz und die DDR zu vermischen scheinen). Oder Mama Maggot, die auf Sardinien einen Kult leitet, der infektiöse - und ziemlich ekelige - Rituale praktiziert. Oder einen Mönch, der mit dem Genozid liebäugelt ("I've seen so much death and violence over the years, I no longer think of humans as anything but deranged, thoroughly objectionable, psychotic apes. I'd prefer them all dead and buried in mass graves."). Oder Jesus Christus höchstpersönlich, der im römischen Untergrund in Madenform eingelagert ist.
Michael wird Drogen schmuggeln, zum Assassinen ausgebildet werden, aber gleich beim ersten Auftrag - passiv, wie er nun mal ist - von seinem Opfer umgedreht werden und mit einer heroinabhängigen Prostituierten den Vatikan infiltrieren. Und so weiter. All das im Rahmen eines Machtgerangels zwischen verschiedenen kirchlichen Fraktionen, das mitunter an Dan Brown denken lässt: Es geht um Religion, Unsterblichkeit, Weltherrschaft und Deutungshoheit - bloß geht's hier deutlich fleischlicher zu als bei den Illuminati.
Zumindest gut gemacht
So bizarr die diversen ProtagonistInnen auch sind, eines haben sie praktisch alle gemeinsam: einen ausgeprägten Hang dazu, gallige Lebensweisheiten zum Besten zu geben. "... when you think about it, nothing actually exists anyway. Everything ... absolutely everything ... ist just one big illusion. A crock of shit, you might say." Anfangs ist das noch witzig, mit der Zeit werden die ständigen Aphorismen nihilistischer Prägung allerdings ein wenig ermüdend. Da kommt die sich im Schlussteil abzeichnende Erlösung dann wie eine ... Erlösung. Vorausgesetzt, man hat was mit Religion am Hut.
"The Maggot People" ist ein fraglos hochinteressanter Roman voller bizarrer Ideen, die sich letztlich zu einem stimmigen Ganzen verbinden. - Wer hört bereits das "Aber"? Hier kommt es: Das alles hat mich kalt gelassen. Es handelt sich wie gesagt um einen Schelmenroman. Nur leider ist mir der dazugehörige Schelm nie sympathisch geworden.

Catherine Fisher: "Die vergessene Kammer"
Broschiert, 319 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2015 (Original: "Crown of Acorns", 2010)
Ted Chiangs "Tower of Babylon", Brendan Connells "The Architect", François Schuiten & Benoît Peeters' Graphic Novel "Der Turm" und natürlich Arthur C. Clarkes Klassiker "The Fountains of Paradise": Mein Buchregal sagt mir, dass ich ein Faible für Geschichten über megalomanische, in den Himmel ragende Bauwerke habe. Deshalb war mein Interesse sofort erwacht, als ein Roman herauskam, der vorne dieses Cover und hinten folgenden Text trägt: "Er will eine gigantische, sich spiralförmig in den Himmel schraubende Straße bauen, die alle auf der Welt existierenden Bauwerke in den Schatten stellt." Yeah!
... und dann stellt sich beim Lesen heraus, dass es um nichts dergleichen geht. Gegenstand der in "Die vergessene Kammer" behandelten architektonischen Vision ist vielmehr eine ringförmige Wohnanlage aus dem 18. Jahrhundert, noch dazu basierend auf einem realen Vorbild, dem Circus von Bath. - Also manchmal fragt man sich schon, in welchem Paralleluniversum KlappentextautorInnen sitzen. Und warum man ihnen nicht den E-Mail-Zugang zu unserer Welt kappt.
Die Sache mit Sulis
Trotz dieses sich in den Himmel schraubenden Etikettenschwindels habe ich es letztlich allerdings nicht bereut, den Roman gelesen zu haben. Und das, obwohl - oder weil? - er auch diverse andere Erwartungen nicht erfüllt. Zum Beispiel, dass es sich um einen Fantasy-Roman handeln würde. Das Werk der walisischen Autorin Catherine Fisher, die wir bereits von "Incarceron" kennen, wird zwar unter Young-Adult-Fantasy subsumiert, lappt aber unverdrossen in andere Genres bzw. in die Mainstreamliteratur hinüber. Die grundsätzliche Konstruktion von "Incarceron" hat Fisher übrigens auch hier verwendet: Nämlich die Handlung auf mehrere Ebenen aufzuteilen, die durch Welten - oder in diesem Fall Zeiten - voneinander getrennt sind, zwischen denen es aber verbindende Elemente gibt.
Auf der Gegenwartsebene begegnen wir einem 17-jährigen Mädchen, das jetzt Sulis genannt werden will (sein Geburtsname bleibt geheim) und das gerade zum wiederholten Male bei einer Pflegefamilie untergebracht wird. Aus den Ortsbeschreibungen und der römischen Bezeichnung Aquae Sulis dürfen wir schließen, dass es sich bei ihrem neuen Wohnort um das südenglische Bath handelt; auch wenn dieser Name nie fällt. Stattdessen gibt es Umschreibungen wie "die goldene Stadt", die dem Ganzen eine leichte mythologische Überhöhung geben: Fishers erste Phantastik-Nebelkerze, das macht sie echt geschickt.
Die Umstände von Sulis' Umzug wirken ebenfalls recht mysteriös. Offenbar ereignete sich in ihrer Kindheit ein Verbrechen, bei dem eine Freundin zu Tode kam. Seitdem wird Sulis in einer Art Zeugenschutzprogramm von einem geheimen Aufenthaltsort zum nächsten weitergereicht. Und trotz all dieser Vorkehrungen scheint ihr ein bedrohlicher Fremder stets auf der Spur zu sein. Auch in ihrer neuen Heimatstadt wird Sulis ihn bald sehen - die Paranoia wächst.
Jahrhunderte und Jahrtausende früher
Auf einer zweiten Handlungsebene erfahren wir, wie die historische Anlage, in der Sulis nun lebt, einst geplant wurde. Jonathan Forrest nennt Fisher den dahintersteckenden Architekten - die Romanversion von John Wood dem Älteren, der den realen Circus von Bath gebaut hat. Forrest teilt einige Charakterzüge mit dem historischen Wood - etwa dass er von der keltischen und prä-keltischen Vergangenheit der britischen Inseln geradezu besessen war. Freimaurerei, die Weisheit der Druiden, bedeutungsschwangere Symbolik in Forrests Architektur und die Mitgliedschaft in einem Geheimbund: Fisher streut hier jede Menge Mystery-Elemente aus; die zweite Phantastik-Nebelkerze.
Hauptfigur dieser Ebene ist allerdings Forrests jugendlicher Lehrling Zac, der aus guter Familie stammt und sich von seinem Meister völlig verkannt fühlt. So sehr, dass er sogar bereit ist, Verrat an ihm zu begehen. Bis der junge Schnösel erkennen muss, dass er in Wirklichkeit nicht viel taugt und Forrest ihn bloß aus Großzügigkeit aufgenommen hat - wie die junge Prostituierte Sylvia und diverses streunendes Getier auch. Ein mächtiger Schlag fürs aufgeblasene Ego.
Auf einer dritten Handlungsebene schließlich wirft die Autorin den Saga-Modus an und erzählt ihre Version vom Leben des legendären Druidenkönigs Bladud, auf den sich Forrest bzw. Wood in seiner Arbeit bezog. Bladud, ein mythischer Herrscher aus vorrömischer Zeit, werden allerlei Großtaten zugeschrieben - unter anderem soll er die Heilquelle gefunden haben, um die herum er die Stadt Bath errichten ließ. In der einen oder anderen Form wird Bladuds Erbe in der Zukunft fortbestehen, in Zacs und sogar noch in Sulis' Zeit.
Only in 3's
Wie es sich für einen Roman gehört, der sich um eine architektonische Vision dreht, spielt Konstruktion eine maßgebliche Rolle. Allenthalben begegnen wir Kreisen und der Zahl 3: Drei Hauptfiguren, drei mal zehn dreistöckige Gebäude im Circus usw. Und natürlich drei Handlungsebenen, auch wenn die kursorischen Bladud-Kapitel mit den ausführlichen Berichten von Zac und Sulis keine vollkommene Symmetrie ergeben. Aber was ist schon vollkommen.
Wer eindeutig definierte Fantasy will, ist hier an der falschen Stelle. Catherine Fisher spielt geschickt mit Phantastik-Elementen, obwohl "Die vergessene Kammer" letztlich eher eine Mischung aus Psychothriller und historischem Roman ist (deshalb zuvor das Wort "Nebelkerze"). Aber Hauptsache spannend - und das ist der Roman allemal. Für YA echt nicht so übel.

Herbert W. Franke: "Der grüne Komet"
Broschiert, 235 Seiten, € 11,90, p.machinery 2014
Mit ihrem surrealen Antiquitätenladenlook gehören die SF-Cover Thomas Frankes für mich zu den schönsten im deutschsprachigen Raum. Den könnte p.machinery von mir aus gerne öfter engagieren, denn oft sind die Cover des Verlags so zuckerlbunt, dass ich erst mal eine gewisse Hemmschwelle überwinden muss. In diesem Fall soll der Franke-Look wohl betonen, dass wir es hier mit Zeitgeschichte zu tun haben: "Der grüne Komet" ist der erste Band einer auf 28 (feeett!) Bände angelegten Werkausgabe zu Herbert W. Franke.
Der aus Wien stammende Franke war ein echter Pionier der deutschsprachigen Science Fiction nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie drückt man es am besten aus? So: Er kann sich noch an das Zeitalter vor Wolfgang Jeschke erinnern. Wir sprechen also wirklich von Old School. Franke-Experte Hans Esselborn würdigt den Physiker, Höhlenforscher, Elektronik-Künstler und SF-Autor Herbert W. Franke in einem Nachwort, das an intensiver Auseinandersetzung mit dessen Werk nichts zu wünschen übrig lässt.
Aus dem Ideenlabor
Begonnen hatte die sich über ein halbes Jahrhundert erstreckende SF-Karriere Frankes 1960 mit diesem Storyband, der satte 65 Kurzgeschichten bzw. Kürzestgeschichten enthält. Um die wenigstens zum Teil vorzustellen, greife ich jetzt ausnahmsweise mal zum sogenannten "Listen-Tool" (mehr dazu später). Here we go:
+ "Start": Ein Astronaut bereitet sich zum Aufbruch ins All vor und gewinnt dabei eine unbequeme Einsicht über sich selbst.
+ "Der Auftrag": Ein Klinikpatient erzählt, wie er mit seiner PR-Agentur das Science-Fiction-Genre populär machte ... und warum er überschnappte, als er den Grund erfuhr, warum er damit beauftragt worden war.
+ "Kalziumaktivierung": Ein Techniker will sich an der Welt rächen, nachdem ihn ein missglückter Versuch zur lebenden Atombombe gemacht hat.
+ "Präparat 261": Der medizinische Fortschritt hat es ermöglicht, ein Gehirn ohne Körper am Leben zu erhalten - doch niemand scheint sich darüber Gedanken gemacht zu haben, dass darin noch ein Bewusstsein existiert.
+ "Das Ei": Der Erzähler opfert sich für ein Alien, das ultraharte Röntgenstrahlung zum Überleben braucht.
+ "Invasion": Aliens führen grausame Experimente an armen Planetariern durch - die Heimatwelt der Aliens heißt Erde.
+ "Die Raupen": Auf einem fremden Planeten treten Menschen in eine bislang unbekannte Stufe ihrer biologischen Entwicklung ein (der letzte, der etwas in diese Richtung schrieb, dürfte wohl Larry Niven gewesen sein).
+ "Fahrt zum Licht": Wesen vom Rand des Sonnensystems verfallen auf ihrem Kurs zur Sonne der Sucht nach Licht und streben wie Motten ihrem Verderben entgegen.
+ "Zweitexemplar": Eine Klongeschichte, die trotz Alter und Kürze das Thema so realistisch behandelt, wie es Hollywood ein halbes Jahrhundert später immer noch nicht gelingt ("Die Insel" ...).
+ "Meteoriten": Zwei sehr unterschiedliche Berichte von vermutlich ein und der selben Raumfahrt, tragisch der von "TB", geschönt der von "B" (jetzt müsste mir nur noch wer erklären, wofür "B" und "TB" stehen könnten).
+ "Der Entschluss": Was tut eine Maschinenstadt, wenn ihr letzter menschlicher Bewohner verstorben ist?
+ "Frau vom andern Stern": Die Ehe mit einer Außerirdischen als Metapher für das Gefühl, alle Bindungen an das frühere Leben zu verlieren.
+ "Schicksal": Winzige Wesen werden versehentlich von Giganten zerquetscht, die sich Menschen nennen.
+ "Der grüne Komet": Der Versuch, eine Fernzukunft des Universums zu zeichnen, in der alle bekannten Strukturen und Zustände in etwas psychedelisches Neues übergegangen sind.
Zack, zack!
Das war jetzt ein ziemliches Stakkato, nicht wahr? Aber genauso liest sich der Band auch: Die Geschichten sind jeweils nur zwei bis drei Seiten lang - gerade ausreichend, um einen Gedankengang auszuführen. (Und wenn man nach dem Nachwort geht, sind die Geschichten auch so geschrieben worden, nämlich innerhalb von zwei Wochen.) Franke, der stets einen schlanken, nüchternen Stil bevorzugte, konnte diese Vorliebe hier auf die Spitze treiben. In seinen Worten: "Also kein neuer Stil, mit dem ich die Literaturkritiker beeindrucken wollte, sondern eine vereinfachte, auf das nötigste beschränkte Kurzform."
Eingeleitet wird jede Episode mit einstimmenden Worten, die mitunter an die "Twilight Zone" erinnern ("Über die Kräfte, die die Atome zusammenhalten und aneinanderbinden, wissen wir einiges, wenn auch nicht alles. Die Kräfte, die den Menschen zum Handeln zwingen, sind uns noch weitgehend unbekannt."). Und am Ende, da steht fast immer eine Pointe. Wie es damals in SF-Kurzgeschichten eben so üblich war. Heute tut das kaum noch jemand - teils, weil das auf Dauer etwas schematisch wirkt. Teils aber wohl auch, weil den AutorInnen irgendwann einfach die Pointen ausgegangen sind. Und auch hier riecht man manche "überraschende" Wendung schon meilenweit gegen den Wind: der Fluch des Lesens mit zeitlichem Abstand.
Was ist schon "trivial"?
Esselborns Nachwort habe ich bereits für sein Fachwissen gelobt - was aber nicht heißt, dass ich mit jeder Aussage voll übereinstimmen würde. Für entbehrlich halte ich beispielsweise, Franke ständig "trivialer Science Fiction" gegenüberzustellen. Es stimmt, in vielen von Frankes Erzählungen erweisen sich auf den ersten Blick monströse Aliens als freundlich und die Menschen als grausam. Und Franke nutzt seine Mini-Plots für Überlegungen, wie sich neue technische Entwicklungen oder Begegnungen mit dem Fremden auf den Menschen auswirken.
Aber trotzdem. Für praktisch jedes von Esselborn genannte Kennzeichen "trivialer SF" ließen sich auch hier Beispiele finden. Womit ich nicht Franke runterziehen, sondern anregen möchte, das ganze verzopfte und etwas hochnäsige Konzept von "trivialer Literatur" einfach zu kübeln. Dann muss man sich nicht mehr verrenken, um es zu beweisen ... fast so sehr verrenken wie ein Satz Esselborns, der sich darauf bezieht, wie in der Geschichte "Gewalt" eine Frau zum Austragen eines Alien-Embryos gezwungen wird, und der weitergeht mit den Worten: aber es geht dabei nicht um physische Gewalt. Soso.
Zeichen der Zeit
Purer Pulp jedenfalls sind einige Episoden um ein wiederkehrendes Protagonistenduo: Bei den Kurzabenteuern der Raumfahrer Kai und Ben habe ich mich - internetverdorben, wie ich bin - irgendwann nur noch gefragt, ob die beiden wohl am Ende heiraten werden. Aber Slash-Literatur war damals noch unbekannt, und Franke sah seine Tätigkeit ohnehin sehr ernsthaft, wie sein aus dem Jahr 1957 stammendes Manifest "Zur Bewertung von Science Fiction" zeigt.
In diesem etwas didaktischen Begleitwort zu "Der grüne Komet" listete der Autor einst auf, welche Kriterien gute Science Fiction von schlechter zu unterscheiden hätten. Mündend in der Feststellung: "Vielleicht sind die an ein ideales Ergebnis gestellten Ansprüche auch zu groß für den durchschnittlichen Leser. Den wollen wir ja vor allem gewinnen, und wir werden das nur erreichen, wenn wir ihm zunächst nichts Fremdes, zu Ungewöhnliches liefern, sondern ihn vom Gewohnten her in unsere Richtung zu lenken versuchen." - Wie gesagt: Old School. Zeitgeschichte. Oder in Esselborns Worten: ein bahnbrechendes Werk der deutschsprachigen Science Fiction in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
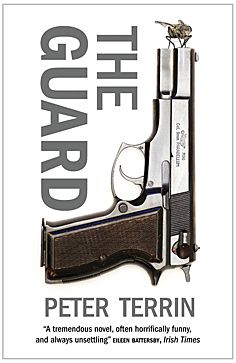
Peter Terrin: "The Guard"
Broschiert, 242 Seiten, Quercus 2012 (Original: "De Bewaker", 2009)
Im Urlaub hatte ich endlich auch mal Zeit, dieses Buch zu lesen, das mir seit Jahren immer wieder untergekommen ist und von dem ich ebenso lange dachte, dass es demnächst sicher auf Deutsch erscheinen würde. Immerhin hat der belgische Autor Peter Terrin damit 2010 den Literaturpreis der Europäischen Union gewonnen. Aber Pustekuchen. Das im Original auf Flämisch erschienene "De Bewaker" wurde zwar in eine ganze Reihe Sprachen übersetzt - sogar ins Englische, was für europäische (Genre-)Literatur keineswegs selbstverständlich ist. Aber nicht ins Deutsche. Und weil ich darauf vermutlich warten kann, bis die Kühe nach Hause kommen, hab ich's mir jetzt auf Englisch reingezogen. Hat sich gelohnt.
To put it in a nutshell
Das Szenario ist schnell zusammengefasst, weil hochverdichtet. Michel und Harry sind die uniformierten Wächter der Tiefgarage eines festungsartig abgeschotteten Luxuswohnkomplexes. Ihren Job nehmen sie ebenso ernst, wie er völlig sinnlos erscheint. Erst recht, nachdem eines Tages die reichen MieterInnen der Anlage allesamt eilig in ihre Autos steigen und auf Nimmerwiedersehen davonbrausen. In den folgenden Tagen, Wochen und Monaten grübeln unsere beiden Antihelden über die Frage, was denn da draußen passiert sein mag, das diese Flucht ausgelöst hat. Doch sie versehen weiterhin ihren Dienst.
Michel, der als Ich-Erzähler fungiert, und Harry schmoren erbarmungslos im eigenen Saft. Mehr noch als der mögliche Weltuntergang treibt sie aber die Frage um, ob die Geschehnisse ein Test ihrer Fähigkeiten als Wächter sind. Die Paranoia steigt und erreicht einen ersten Höhepunkt, als sie es für eine gute Idee halten, sämtliche Glühbirnen herauszuschrauben und im Dunklen weiterzuleben - in der bizarren Annahme, dass sie damit ihre Befähigung demonstrieren würden, in die ominöse "Elite" der Wächterorganisation aufgenommen zu werden. Wenn dann ein lange angekündigter, aber nicht mehr erwarteter dritter Wächter auftaucht, bringt er das fein austarierte Gleichgewicht des aufeinander eingespielten Duos durcheinander und die Ereignisse nehmen eine Wendung in Richtung Michael Haneke. Bevor schließlich alles komplett auseinanderfällt.
Die große Ungewissheit
Terrin belässt alles bewusst vage und namenlos. So erfahren wir beispielsweise nie, in welchem Land oder welcher Stadt wir uns befinden. Harry und Michel arbeiten für die "Organisation", politische Entscheidungen werden von der "Obrigkeit" bzw. den "Behörden" getroffen. Dieser Abstraktionsgrad ist typisch für AutorInnen, die genre-artige Literatur schreiben, aber nicht aus dem Genre kommen. Und ich mag das normalerweise nicht besonders, weil es für mich immer ein bisschen nach prätentiösem "Ich-treffe-Aussagen-für-die-ganze-Menschheit" riecht. Aber man darf ja bekanntlich alles, solange das Ergebnis gut ist.
Zeitlich dürfen wir davon ausgehen, dass wir uns in der nahen Zukunft befinden - immerhin gibt es laut Text schon lange keine Kinos mehr und die Landwirtschaft ist unter Giftbelastung und nicht näher spezifizierten Attacken zusammengebrochen. Keine schöne Zukunft, in der Tat: In der Gated Community, in der der Wohnkomplex steht, wird die nächtliche Ausgangssperre von Scharfschützen überwacht; Mauern, Stacheldraht und Sicherheitsschleusen sind allgegenwärtig. Und der Gedanke, dass hinter der Flucht der BewohnerInnen vielleicht ein Atomschlag gegen irgendwelche "Städte im Süden" steckt, erscheint Michel erschreckend selbstverständlich.
Verglichen wurde "De Bewaker" wegen seiner surrealen Atmosphäre sowohl mit den Werken J. G. Ballards als auch Franz Kafkas. Aber auch die Dramen Harold Pinters und Samuel Becketts wurden schon genannt. Durchaus passend, haben wir es doch mit einem Kammerspiel zu tun, in dem das vielschichtige Verhältnis der beiden Hauptfiguren von zentraler Bedeutung ist: Harry, der sich alles schönredet, fest an eine Beförderung glaubt und bereit ist, seine optimistische Sichtweise notfalls mit Gewalt zu verteidigen. Und der etwas naive, aber auch offene Michel, der in einem Wechselbad von Wahrnehmungen unterzugehen droht. Nicht nur, dass er sich ständig in geradezu neurotischer Weise seiner Körperfunktionen bewusst ist. Ein Stichwort hier, ein Sinneseindruck da - das reicht, um Gedankenketten in Gang zu setzen und sich Geschichten zurechtzuspinnen, bis Michel und wir LeserInnen irgendwann nicht mehr zwischen Fantasie und Realität unterscheiden können.
Terrin gibt's uns kalt - warm
Terrins Protagonisten leben in einer unglaublich kleinen Welt - und das nicht nur im räumlichen Sinne. Da wird als Entdeckung gefeiert, wie man eine kaputte Klospülung richtig bedient, und penibel festgelegt, wer wann die tägliche Dose Corned Beef mit Brot auswischen darf. Eine einschwirrende Fliege wird zum Ereignis, und wenn bei der Vorratslieferung ein luxuriös anmutendes Glas Marmelade zu Boden fällt, sind Michel und Harry der Hysterie nahe: "I smell strawberries." - "Let’s stay calm."
Die Absurdität, mit der Miniaturereignisse in den Köpfen der Protagonisten zu nervenzerfetzenden Katastrophen- und Bedrohungsszenarien aufgeblasen werden, sorgt immer wieder für Komik. Das Lachen vergeht einem allerdings wieder, wenn man sich die Situation der beiden Wächter vor Augen führt, die schon vor der (möglichen) Katastrophe draußen unmenschlich war. Nicht nur dass sie auf engstem Raum bei kaltem Wasser und eintönigen Rationen leben müssen, die noch dazu immer seltener geliefert werden. Im Grunde sind sie nichts anderes als Sklaven. Informationen werden ihnen vorenthalten, sie dürfen die Tiefgarage nicht verlassen, ihre Schlafzeiten sind kurz, so etwas wie freie Tage scheint es nicht zu geben. Das Allerschlimmste ist aber Harrys und Michels geradezu mittelalterlich anmutende Akzeptanz ihrer dienenden Rolle. Ihr einziger Traum: In die "Elite" aufgenommen zu werden, um künftig ein noch nobleres Anwesen bewachen zu dürfen ...
"The Guard" ist ein Gänsehaut erzeugendes Gesellschaftspanorama auf kleinstmöglicher Bühne. Gesprenkelt mit Humor, Spannung und gegen Schluss hin einem Schuss Rätselraten. Kurz: sehr lesenswert. Und übersetzenswert, aber echt.

Ralf Boldt: "Der Temporalanwalt"
Broschiert, 188 Seiten, € 9,90, p.machinery 2014
"Du musst mich auf dieser Mission begleiten", beharrte Josepha. "Das ist doch für Hans-Peter viel zu gefährlich", verteidigte mich Sabine. Ein Punkt, in dem sich aktuelle deutschsprachige SF-Erzählungen - selbst so bewusst altmodisch gehaltene wie diese - von solchen aus den Nachkriegsjahrzehnten unterscheiden: Damals fühlten sich Autoren noch bemüßigt, ihren Helden "coole" englisch klingende Namen verpassen zu müssen. Wie Ben, Tom ... oder Perry. Hier heißt der Protagonist Hans-Peter Grießau, kommt aus Oldenburg in Oldenburg und ist Anwalt und Notar.
Zur Handlung
Als wir ihn kennenlernen, schreiben wir das Jahr 2020 - es geht danach mehrfach ein paar Jährchen nach vorne und zurück - und da ist er bereits ein versierter Temporalanwalt. Nämlich seit er im Jahr 2014 eine Grundstückstransaktion für zwei Mandanten abwickelte, die in Wahrheit ein und dieselbe Person sind: Die 20- und die 50-jährige Ausgabe von Harm Meesters, einem Zeitreisenden aus dem Jahr 2043. Dort erhofft man sich durch kommerzielle Zeitreisen ein neues Wirtschaftswunder. Den Grundstein dafür will Meesters in Form einer Temporalkuppel im nahen Ammerländer Moor legen, weil dort die Geografie das Reisen durch die Zeit in einzigartiger Weise begünstige.
Ehe sich's Hans-Peter versieht, arbeitet er mit seiner juristischen Expertise am Projekt mit, kümmert sich in seiner Kanzlei nebenbei um weitere zeitreisende T-Mandanten und könnte sich im Prinzip seines Lebens freuen ... wenn da nicht eine junge Frau aus der Zukunft auftauchte, die ihn vor Meesters warnt. Vielleicht ist der ja doch nicht so philanthropisch wie gedacht. Nolens volens stolpert damit Hans-Peter, der ein eher gemächlicher Denker und Handler ist, ins Abenteuer.
Nordisch by Nature
Im Netz habe ich einen genialen Satz gefunden: Ralf Boldt (wir kennen ihn hier bereits als Mitherausgeber der Storysammlung "Die Stille nach dem Ton") hat den ersten ostfriesischen Science-Fiction-Roman geschrieben. Das bringt die beschaulich-norddeutsch-ländliche Atmosphäre, die den Roman vor allem anderen auszeichnet, sehr gut auf den Punkt - auf die Gefahr hin, dass ich damit einem Klischee aufsitze.
Aber es geht ja auch nicht nur um die Geografie, sondern vor allem um's Feeling: Wir begegnen hier so SF-typischen Elementen wie einem Bausparvertrag, artiger Konversation bei Tee oder der bangen Frage, was denn aus den Kranichen und Gänsen des Ammerländer Moors wird, wenn auf ihrem alten Sammelplatz eine Temporalkuppel steht. Über der dann ein buntes Kränzchen im Wind schaukelt, wenn man vor versammelter Lokalpresse das Richtfest feiert.
In der ersten Romanhälfte hatte ich echt ein paarmal das Gefühl, ich würde mich in einem Loriot-Sketch vor brauner Tapete befinden, so herrlich bürgerlich-bieder geht's da zu. Bezeichnend auch Hans-Peters Reaktion, als ihm zum ersten Mal bewusst wird, dass er eigentlich gar nichts über die Welt des Jahres 2043 weiß. Die erste Frage, die ihm nun durch den Kopf schießt: Wird es da noch den Euro geben?
Wo es konventionell wird
Natürlich scheiden sich an dieser Stelle die Geister. Für mich als Sehrvielleser läuft sowas unter Alleinstellungsmerkmal und ist daher etwas klar Positives. Für jemanden, der eher sporadisch Bücher kauft und sich einfach eine spannende Zeitreisegeschichte erwartet ... nun, nicht, dass Boldt nichts dergleichen zu bieten hätte. Das sind für mich allerdings die weniger interessanten Teile des Romans.
So gibt es etwa ein im Verhältnis zum Gesamtumfang überlanges Kapitel, das den Bericht eines Zeitreisenden beinhaltet, der im Germanien des dritten Jahrhunderts strandet, und das auf mich ein wenig den Eindruck macht, als hätte Boldt hier einen bereits bestehenden Text in den Roman integriert. Das und die Verschwörungs- und Aufdeckungs-Action in den Schlusskapiteln entsprechen dann klassischen Zeitreisegeschichten. Ist aber nichts, was man nicht schon hundertmal gelesen hätte.
Ein paar weitere T-Mandanten hätte ich Hans-Peter schon gegönnt, da hätte Boldt seine Fantasie ruhig noch ein bisschen spielen lassen können. Denn da wäre mehr drin gewesen - wenn wir zum Vergleich etwa nehmen, wie viele Deals der Protagonist von James Tiptree Jr.s erster Erzählung "Geburt eines Handlungsreisenden" abwickelte - und das im Rahmen einer Kurzgeschichte! Und auch die oben genannte Atmosphäre kommt in der zweiten Romanhälfte leider nicht mehr so zur Geltung, weil dann die konventioneller gehaltene Action im Vordergrund steht. So bleibt als Gesamtresümee für den "Temporalanwalt": Nicht aufregend. Aber irgendwie sympathisch.

Christian Cantrell: "Der zweite Planet"
Broschiert, 346 Seiten, € 9,30, Heyne 2015 (Original: "Containment", 2010)
Die Erde ist verwüstet, deshalb werden andere Planeten besiedelt: So richtig eingeleuchtet hat mir dieser klassische Plot eigentlich nie. Rechnet man alle Umweltfaktoren zusammen, müsste man den Planeten, dem wir uns angepasst haben, schon ganz gewaltig – und ich meine gewaltig – ruinieren, ehe eine Wiederherstellung aufwändiger wäre als das Terraforming einer komplett anderen Welt. Mit "Der zweite Planet" bestärkt mich der US-amerikanische Neo-Autor Christian Cantrell in dieser Meinung ... und zwar auf eine weitgehend unerwartete Weise.
Zur Handlung
Schauplatz ist die Kolonie V1, eine Ansammlung hermetisch versiegelter "Pods" auf der Venus. Unser innerer Nachbarplanet wurde anstelle des Marses kolonisiert, weil die mit der Erde vergleichbare Schwerkraft Faktoren wie Giftatmosphäre und 400 Grad Bodentemperatur übertrumpft – oder zumindest ist das der Grund, den man den Angehörigen der Generation V, den ersten in V1 geborenen Menschen, nennt. Einer davon ist die Hauptfigur des Romans: Arik Ockley, ein hochbegabter junger Mann, der an der Schnittstelle von Softwareentwicklung und Biowissenschaften forscht. Sein wichtigstes Ziel ist die Entwicklung künstlicher Photosynthese, um die lebensfeindliche Umgebung für Menschen tauglich zu machen. Besonderer Ansporn: Ariks Frau ist schwanger, und wenn nicht irgendein Weg gefunden wird, die Sauerstoffproduktion zu erhöhen, hat V1 bald einen Bewohner zuviel. Da liegt fast ein Hauch von "The Cold Equations" in der Luft.
Zu Beginn des Romans erwacht Arik aus einem dreimonatigen Koma, nachdem er offenbar einen Unfall erlitten hat. Auffallend früh erwähnen sowohl der Arzt als auch Ariks Vater die Möglichkeit, dass er unter Gedächtnislücken leiden könnte – erstes Anzeichen dafür, dass hier eine Verschwörung im Busch sein dürfte. Weitere folgen. So findet Arik eines Tages eine verschlüsselte Botschaft, die er vor dem Unfall an sich selbst geschickt hat. Und etwa zur Mitte des Romans bricht der Kontakt zur Erde ab. Cantrell lässt die Handlung schließlich auf einen Twist Marke "Er wird doch nicht ... jetzt hat er's tatsächlich getan" hinauslaufen, den man zwar nicht von Anfang an, aber doch für einige Zeit kommen sieht. Und bei dem man sich schon fragen muss, wie das die ganze Zeit geheim gehalten werden konnte. Erst recht in einem "Leuchtturm des Wissens" voller brillanter Köpfe, wie die GründerInnen von V1 ihre Kolonie sehen.
Gebrauchsanweisung für eine Zukunft
Auf dem Papier liest sich das Konzept des Romans tadellos – bis hin zur Konstruktionsweise, die Handlung parallel in zwei Strängen vor und nach dem Unfall ablaufen zu lassen. Nur leider passt die Ausführung nicht, und der Grund dafür ist: Cantrell erklärt zuviel. Viel zuviel. Entweder direkt an uns gerichtet in Form ausführlicher Beschreibungen, oder die Romanfiguren erklären einander etwas im Dialog – und wenn alle Stricke reißen, gibt's einen Bildvortrag im Public Pod.
Das zeichnet sich von Anfang an ab, wenn jede auftauchende Figur brav mit Funktion und Aussehen vorgestellt und jeder neue Begriff sofort erklärt wird. Jedes Navi im Auto lässt einem mehr Freiraum zum Selberdenken. Es folgen Infodumps zur Geschichte der Station und der Raumfahrt im Allgemeinen sowie immer wieder seitenlange Beschreibungen zur Methodik von Ariks Forschungen und der Funktionsweise technischer Systeme (wobei Cantrell, der selbst Softwareentwickler ist, auf seinem Fachgebiet fraglos eigene Stärken ausspielen kann). Sogar auf den letzten 15 Seiten, wo alles hektisch dem Höhepunkt entgegenstrebt, hält Cantrell es noch für eine gute Idee, mehrere Seiten dem Ablauf einer von Arik durchgeführten Analyse zu widmen. Inklusive fachmännischer Erklärungen zum Hintergrund natürlich. In Summe liest sich "Der zweite Planet" wie die Gebrauchsanweisung für eine Zukunft, weniger wie eine Erzählung aus selbiger.
Damit stellt sich die Frage, für welches Publikum der Roman denn gedacht sein mag. (Jungen) LeserInnen, die sich primär dafür interessieren, wie eine Science-Fiction-Welt bzw. deren Technik funktionieren könnte, dürfte er gut gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Hugo Gernsback selig an "Der zweite Planet" seine Freude gehabt hätte – die Mischung aus Erzählung und Sachtextpassagen hätte ganz dessen Version von Hard SF entsprochen. Was mich betrifft: Ich falle leider nicht in die Zielgruppe und werde auf die weiteren Bände der Reihe verzichten.
Und so geht's weiter
Zunächst darf ich stolz vermelden, dass die Rundschau erneut für den Kurd-Laßwitz-Preis in der Kategorie "langjährige Leistungen" (jetzt fühle ich mich alt) nominiert worden ist. Zeit für eine erbarmungslose Kampagne in eigener Sache, denn ich bin wild entschlossen, den vorletzten Platz, den sie vor zwei Jahren gemacht hat, mit Zähnen und Klauen zu verteidigen!!!
Dafür greife ich tief in die Trickkiste: Ich werde Bücher vorstellen(!), damit rechnet sicher keiner. Die Themen reichen von einem vor laufender Kamera verfaulenden Medienstar über einen Serienkiller, der all die Leute abmurkst, die ihn im Internet nerven, bis zur Historie der Hugo Awards. Man liest sich! (Josefson, derStandard.at, 28.3.2015)