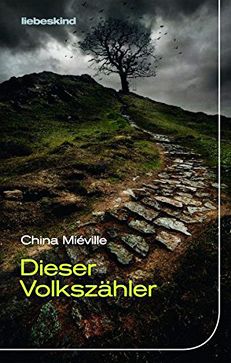
China Miéville: "Dieser Volkszähler"
Gebundene Ausgabe, 173 Seiten, € 18,60, Liebeskind 2017 (Original: "This Census-Taker", 2016)
Ein Jahr, das mit einem neuen Buch von China Miéville beginnt, kann ja nicht das schlechteste werden (drücken wir mal die Daumen). Nach einigen doch recht langen Schmökern – zuletzt "Der Krake" und "Embassytown" – hat der Larger-than-life-Autor aus England ein paar Gänge zurückgeschaltet. Auf das (tolle!) Jugendabenteuer "Das Gleismeer" folgten unter anderem Comics, ein Kinderbuch, der Storyband "Three Moments of an Explosion" und zwei Novellen: die Alternativweltgeschichte "The Last Days of New Paris" über das Aufeinandertreffen von Surrealisten und Nazis und diese schwer einordenbare Erzählung hier, die man am ehesten noch als Magic Realism oder Slipstream bezeichnen könnte.
Wo und wann?
Obwohl er aus dem Phantastik-Genre kommt, wendet Miéville in "Dieser Volkszähler" eine Technik an, die eher in der Mainstreamliteratur gebräuchlich ist: Er belässt alles sehr vage. Namen sind hier ebenso selten zu finden wie geografische Bezeichnungen. Es heißt nur nebelhaft das Brückendorf oder in einem fernen Land – ganz anders also als in SF oder Fantasy mit ihrer Hingabe an ausgetüfteltes Worldbuilding. Die Erwähnung von Klippschliefern legt nahe, dass wir uns in Afrika befinden. Andererseits muss das bei Miéville, der gerne bunt durcheinandermischt, noch lange nichts heißen. Und tatsächlich macht später ein Puma jede geografische Zuordnung zunichte ... und was in aller Welt mag ein Abscheuvogel sein?
Auch zeitlich bleibt es unscharf. Es hat zumindest den Anschein, dass wir uns in einer Zukunft befinden, in der der technologische Stand nach einigen größeren Konflikten auf ein geringeres Level zurückgesunken ist. Ein paar Andeutungen legen die Möglichkeit eines Maschinensturms nahe: Der Erzähler erinnert sich an "bewegliche Statuen" und einen "Puppenkopf", den er im Müll fand.
Das Trauma
Besagter Erzähler führt auf der Gegenwartsebene, die die eigentliche Handlung einrahmt, gemäß den rituell wirkenden Anweisungen seines Vorgesetzten drei Bücher: eine Bestandsaufnahme bzw. ein "Kontobuch" voller Zahlen und Fakten, eine für alle LeserInnen zugängliche Erzählung und ein persönliches Journal. Welches von beiden Letzteren wir zu lesen bekommen, sei an dieser Stelle offengelassen. Es dreht sich jedenfalls um ein traumatisches Erlebnis aus seiner Kindheit, das den Erzähler tief geprägt hat.
Er lebte damals zusammen mit seinem Vater und seiner Mutter auf einem kleinen Berghof etwas außerhalb des Brückendorfs. Eines Tages kam er panisch ins Dorf gelaufen und stammelte, dass seine Mutter seinen Vater getötet habe ... oder sein Vater seine Mutter? Ein Junge rannte schreiend einen Bergpfad hinunter. Der Junge war ich. So lauten die ersten Sätze des Buchs, und Miéville wird in weiterer Folge immer wieder zwischen erster und dritter Person wechseln. Später wird passagenweise sogar in zweiter Person erzählt.
Versuche einer Rekonstruktion
Der Perspektivwechsel unterstreicht das Fragmentarische unseres Gedächtnisses – in einer Erzählung, die sich in mehrfacher Weise mit dem Prozess des Erinnerns befasst. Da ist der Junge, der vor der Dorfgemeinschaft (und sich selbst) den Ablauf des Mordes zu rekonstruieren versucht. Dann der Erzähler als Erwachsener, der sich an seine Kindheit erinnert. Und schließlich die Menschen im Dorf als Ganzes: eine Gemeinschaft an der Peripherie der Zivilisation, die sich ihren eigenen Reim darauf gemacht hat, was mit der einstigen Welt von Eisenbahnen, Büros und Lichtspielhäusern geschehen sein mag.
"Dieser Volkszähler" verweigert Antworten auf die vielen Fragen, die sich einem beim Lesen stellen, und lebt von einer Atmosphäre unterschwelliger Bedrohung. Der Junge hat beobachtet, wie sein Vater mehrere Tiere tötete und in einen Schacht im Berg warf; möglicherweise hat er dasselbe auch mit Menschen getan. Aber auch im Jungen selbst steckt Seltsames – so irritiert er seine Mutter mit überzeugt vorgetragenen Ideen, wie die Welt auszusehen habe (Häuser, die niedergerissen werden sollten, oder Vögel, die Hundeköpfe tragen müssten). Phantastikelemente kommen vor – so lebt beispielsweise der Vater davon, dass er für die DorfbewohnerInnen Schlüssel anfertigt, die magische Wirkung zu haben scheinen. Doch ist es schwierig zu sagen, ob diese Phantastik-Elemente "echt" oder Ausgeburten bzw. Interpretationen der kindlichen Phantasie des Erzählers sind.
"Dieser Volkszähler" ist eine durch und durch enigmatische Erzählung und in ihrer betont sparsamen Ausgestaltung weit entfernt vom Hollodero Miévilles früherer Werke. Unbestreitbar faszinierend – ein bisschen aber auch, als hätte Miéville nach einer Reihe von IMAX-Epen einen Schwarzweiß-Film gedreht.

Cixin Liu: "Die drei Sonnen"
Broschiert, 592 Seiten, € 15,50, Heyne 2016 (Englischsprachige Ausgabe: "The Three-Body Problem", 2014, Original: "三体", 2008)
Wenn um ein Buch schon vorab ein so unvergleichlicher Wirbel veranstaltet wird, wie es bei Cixin Lius "The Three-Body Problem" der Fall war, lähmt das immer ein bisschen meine Leselust. Darum erst mal ein Dankeschön an alle hier im Forum wie auch im englischsprachigen Teil des Netzes, die den preisgekrönten und bejubelten Roman mit kritischen Kommentaren ein bisschen von seinem Podest geholt haben. Nicht tief genug, um ihn zu zertrümmern (was ungerechtfertigt wäre, er ist insgesamt empfehlenswert) – sondern genau so tief, damit er wieder als das erreichbar wird, was er ist: einfach ein Buch, das man lesen und sich dabei gut unterhalten kann.
Nach der Lektüre bleiben zwei Erkenntnisse, von denen eine im Nachhinein betrachtet eigentlich höchst erwartbar war: Wenn sich so viele Menschen auf einen Roman einigen können, dass er bei der Tor-Community gleich gut ankommt wie bei Rechtsausleger Vox Day, dann dürfte er weniger die Qualitäten eines schriftstellerischen Urknalls als die eines kleinsten gemeinsamen Nenners haben. Dazu gehört auch, dass er sehr einfach zu lesen ist. Die zweite Erkenntnis kommt schon etwas überraschender: Es gab viel Gedöns um den ersten großen chinesischen SF-Roman, der ins Englische übersetzt wurde, und man stößt in diversen Rezensionen immer wieder auf die "andere Perspektive", die Cixin Liu angeblich eröffne. Doch liegt sein Roman in Sachen Inhalt und vor allem Erzählweise weit, weit innerhalb der Bandbreite westlicher Science Fiction.
Zur Handlung
"Die drei Sonnen" wartet mit einem Einstieg auf, der sich gewaschen hat. 1967, im blutigen Chaos der chinesischen Kulturrevolution, muss Hauptfigur Ye Wenjie miterleben, wie ihr Vater – ein aufrechter Physikprofessor – in einem Schauprozess an den Pranger gestellt und schließlich von einer aufgehetzten Meute dümmlicher Schülerinnen massakriert wird. "Die Allgemeine Relativitätstheorie bestreitet die marxistische Dialektik! Die Annahme eines statischen Universums zeigt gründlich, dass sie vom reaktionären Idealismus erfüllt ist ..." Das unerträgliche Ideologiegeschwafel wird Cixin Liu Jahrzehnte später sehr schön (soll heißen: potthässlich) in den Richtungsstreitigkeiten einer Wissenschaftergruppe widerspiegeln, die den Kontakt zu einer Alien-Zivilisation monopolisieren will. Auch hier gilt die kindische Devise: Ich bin viel revolutionärer als du!
Später findet sich Ye Wenjie bei der Zwangsarbeit in der Nähe einer neuerrichteten Sende- und Empfangsanlage im Nordosten Chinas wieder. Wegen ihrer Physikkenntnisse wird sie im Geheimprojekt Rotes Ufer – der chinesischen Entsprechung von SETI – Karriere machen. Doch die Ermordung ihres Vaters hat Spuren hinterlassen – ebenso wie die Lektüre von Rachel Carsons Öko-Klassiker "Silent Spring". Beides führt Ye Wenjie zur gefährlichen (und folgenreichen!) Überzeugung, dass das Böse mit dem Menschen untrennbar verbunden sei und dass eine Entwicklung zum Besseren nur von außen kommen könne.
Zeitsprung
So ungewöhnlich die Kulturrevolution als Einstieg zu Handlungsebene 1 war, so wohlvertraut präsentiert sich der zu Ebene 2. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2007, als der Nano-Forscher Wang Miao mit freundlichem Nachdruck gebeten wird, an einer geheimen Sitzung teilzunehmen, auf der es vor wissenschaftlichen Koryphäen und Militärs nur so wimmelt: ein recht geläufiger Vorgang in der SF, der unweigerlich in eine große Eröffnung münden muss. Die lautet hier: Einige hochrangige PhysikerInnen haben Selbstmord begangen, es häufen sich Unfälle und Protestaktionen von Sekten und Umweltbewegungen. Als Gesamtbild betrachtet, scheint hier ein weltweiter stiller Krieg gegen die Wissenschaft stattzufinden. Ausgeheckt von Außerirdischen, unterstützt von einigen WissenschafterInnen selbst.
Für Wang Miao erhält dieser Krieg rasch eine sehr persönliche Note: Auf seiner Netzhaut läuft beunruhigenderweise ein Countdown ab, den keine irdische Technologie dort einblenden könnte. Und nach der unglaublichen Mitteilung "In drei Tagen, das ist der Vierzehnte, wird zwischen ein Uhr nachts und fünf Uhr morgens das gesamte Universum nur für dich flackern" ... da zwinkert die kosmische Hintergrundstrahlung Wang Miao tatsächlich zu. Das sind schon mal ziemlich großartige Mystery-Elemente.
Die Atmosphäre des Geheimnisvollen verdichtet sich, als Wang Miao das Virtual-Reality-Spiel "Three Body" kennenlernt, in dem es um das Werden und Vergehen ganzer Zivilisationen unter dem unberechenbaren Einfluss dreier Sonnen geht. Als Avatare treten hier die berühmtesten Köpfe der irdischen Wissenschaftsgeschichte auf und versuchen, das hinter ihrer Welt steckende System zu erkennen, um endlich aus dem Apokalypsen-Kreislauf auszubrechen. Wieder steht also die Wissenschaft im Mittelpunkt. Besonders faszinierend ist ein Kapitel, in dem Menschen als Logikgatter verwendet werden, um – ähnlich wie in Sean McMullens "Seelen in der großen Maschine" – in vieltausendköpfiger Formation einen lebenden Computer zu bilden.
Im Kontext betrachtet
Cixin Lius Roman ist zur Hälfte Hard SF – insofern, als die Wissenschaft an sich hier in verschiedenster Form zum eigentlichen Thema gemacht wird. Zur anderen Hälfte ist es physikalisches Seemannsgarn. Der Roman büßt einiges an Seriosität ein, wenn zu den Aliens geblendet und der Umgang mit der Physik etwas kreativer wird. Das hat was von (Prä-)Golden-Age-SF, in der bei Bedarf mal eben neue Naturkräfte erfunden wurden (ich muss bei solchen Gelegenheiten immer an den "Rhodomagnetismus" in Jack Williamsons "Wing 4" denken). Und so manches widerspricht ganz einfach der Logik. Da bricht die Alien-Flotte beispielsweise auf, obwohl sie nur weiß, in welcher Richtung die Erde liegt – ob die Entfernung nun vier oder 4.000 Lichtjahre beträgt, ist den Außerirdischen beim Start hingegen vollkommen unbekannt. Macht aber nix, anscheinend braucht man nur immer "geradeaus" weiterzufliegen, als führe man auf der Autobahn.
Einfach und präzise, aber auch poetisch: Mit diesen Worten wird im Roman Rachel Carsons "Silent Spring" beschrieben – man könnte sie aber genausogut auf das angenehm zu lesende "Die drei Sonnen" selbst anwenden. Von der Art des Erzählens liegt es in seinen besseren Teilen in dem Bereich, in dem wir unter anderem Autoren wie Stephen Baxter, Robert Charles Wilson oder Robert J. Sawyer finden. Etwas pulpigere Vergleichswerte müsste man wie gesagt finden, wenn's um Physik und Technologie geht. Und mitunter glaubt man auch einen Rücksturz ins 19. Jahrhundert zu erleben: Vor allem dann, wenn sich in der holzschnittartig gezeichneten Zivilisation der Aliens jeder Dialog als reichlich steifer Austausch philosophischer Konzepte liest. Fleisch auf den Knochen haben diese Außerirdischen nicht – aber vielleicht ist das ja unvermeidlich, wenn man bei jedem Weltuntergang "dehydriert" und als trockener Lederlappen liegen bleibt.
Bilanz: Kann man lesen, ohne vor Ehrfurcht zu dehydrieren
Nach dem Roman gibt es noch einen ziemlich langen Anhang: In dem Fall würde ich ausnahmsweise empfehlen, diesen vorab zu lesen. Es wird darin nicht gespoilert, dafür werden einige Begriffe aus der chinesischen Zeitgeschichte erklärt, deren Bedeutung einem sonst entgehen würde. Goldig ist allerdings die Stelle, an der der Autor stolz verkündet, dass er über die seltene Gabe verfüge, Konzepte wie "Lichtjahr" oder "Nanometer" so unmittelbar erfassen zu können wie einen Stein mit der Hand. Aber naja, Klappern gehört zum Handwerk.
And that's it: "Die drei Sonnen" ist nicht unbedingt ein Beispiel für eine so hinreichend fortschrittliche Schreibkunst, dass sie nicht von Magie zu unterscheiden ist. Aber ein sehr unterhaltsamer Roman, auf dessen Fortsetzung man sich freuen darf. Auch wenn es bis zu deren Erscheinen (Juni 2018!) noch so lange dauert, als käme sie mit der Flotte der Außerirdischen angetuckert.
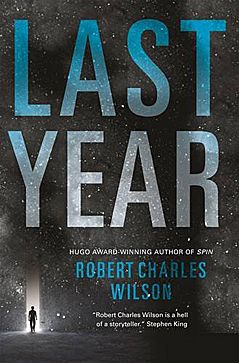
Robert Charles Wilson: "Last Year"
Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, St. Martin's Press 2016
Starautor Robert Charles Wilson scheint ein gewisses Faible fürs 19. Jahrhundert zu hegen. Und wie die Romane "Darwinia" und "Julian Comstock" zeigten, kann er sich bemerkenswert kreative Kontexte einfallen lassen, um diese Ära (bzw. ein sehr ähnlich wirkendes Setting) zu erreichen. Die für einen SF-Autor eigentlich naheliegendste Variante – eine "simple" Zeitreise – ist erst jetzt dran. Aber auch der kann er ungewohnte Aspekte abgewinnen.
Welcome to Futurity!
Man hat sich so an die Oberste Direktive von "Star Trek" und geistesverwandte Vorschriften in zahllosen anderen SF-Werken gewöhnt, dass man sich fast nicht mehr vorzustellen vermag, es könnte auch anders gehen. Aber bei Wilson kann von Tarnung um jeden Preis keine Rede sein: Die BesucherInnen aus unserem Zeitalter, die hier im Illinois der 1870er Jahre aufgeschlagen sind, machen keinen Hehl aus ihrer Herkunft. Sie haben sogar eine ganze Stadt aus dem Boden der Prärie gestampft, und diese City of Futurity empfängt zahlende Einheimische wie ein Themenpark der Zukunft.
Wie sehr sich die Menschen des 19. Jahrhunderts an ihre Gäste gewöhnt haben, zeigt der Umstand, dass als Gegenstück zur City mit dem nahegelegenen Futurity Station eine kleine Boomtown entstanden ist: eine vom Kommerz lebende Bretterbudenansammlung wie im Goldrausch. Nur dass hier nicht mit Nuggets, sondern mit Zukunftssouvenirs Handel getrieben wird.
Diese Akzeptanz erscheint auf den ersten Blick vielleicht ungewohnt, ist aber durchaus plausibel. Immerhin glaubte man im späten 19. Jahrhundert fest an Fortschritt durch Technologie. Und selbst heute gibt es in Sachen interkulturelle Kontakte Vergleichbares: Einige kleine indigene Völker werden wegen ihrer genetischen oder kulturellen Besonderheiten so oft von einem Forscherteam nach dem anderen besucht, dass sie längst ihre ganz eigene Gelassenheit entwickelt haben: "Wollen Sie heute Stuhl- oder Blutproben?" "Nein, diesmal sollen wir uns nur Musik anhören und dann sagen, was uns am besten gefällt." Manchmal wirkt die Realität wie ein Cartoon von Gary Larson.
Wunderbares Duo
Aus den Augen der Hauptfigur Jesse Cullum dürfen wir mit leichtem Verfremdungseffekt auf uns selbst blicken. Jesse ist in einem Bordell in San Francisco großgezogen worden und hat sich daher früh eine aufgeschlossene Weltsicht angeeignet. Die wendet er nun, da er für das Securityteam von Futurity engagiert wurde, auch an. Was ihn aber nicht daran hindert, die Seltsamkeiten unserer Zeit (und den Blick der BesucherInnen auf seine Welt) ironisch zu kommentieren: Step up, all you ladies in short pants, you beardless men. Bring your squabbling, spoiled children, too. See the Man from the Past. See the untrammeled syphilitic drifter of the Golden West.
Jesse ist eine wunderbare Figur: Pflichtbewusst und ruhig (eine Grundhaltung, mit der er allerdings ein Trauma aus seiner Jugend in Schach zu halten versucht), offen für alles – aber nicht naiv. Als adäquate Partnerin wird ihm eine Frau unseres Zeitalters zur Seite gestellt: Elizabeth DePaul, eine Ex-Soldatin, die den Job in Futurity angenommen hat, um ihre Tochter daheim in der Zukunft zu versorgen, und die nun Angst davor hat, dass sie den Kontakt zu ihr verliert.
Rasch wird aus Jesse und Elizabeth ein gutes Team, auch wenn sie sich erst aneinander gewöhnen müssen: Er akzeptiert ihre futuristic habits of speech (ein herrliches Understatement für das, was Jesses Zeitgenossen regelmäßig den Mund offenstehen lässt: nämlich dass auch Frauen "fuck" und "ass" sagen). Und sie seine Gesichtsbehaarung: "You look like a refugee from ZZ Top." "Last Year" ist auch die Geschichte der Liebe zwischen diesen beiden VeteranInnen – so zurückhaltend beschrieben, dass sie viel berührender wirkt, als wenn Wilson viele Worte darauf verwendet hätte.
Dreh- und Angelpunkte der Handlung
Als Plot-Driver kommt Verschiedenes zum Einsatz: Erst rettet Jesse dem US-Präsidenten Ulysses B. Grant bei einem Attentat das Leben und soll anschließend mit Elizabeth ermitteln, wie der Täter an eine Waffe aus der Zukunft gelangen konnte. Später wird er auf die Suche nach runners geschickt – also Zeitreisenden, die sich unerlaubt aus der City absetzen, um ein Leben im 19. Jahrhundert zu führen. Und zuletzt geht es um eine Geiselbefreiung, in deren Zuge Jesse noch einmal mit seiner traumatischen Vergangenheit konfrontiert wird. Der eigentliche Plot ist aber der Culture Clash zwischen Vergangenheit und Zukunft, den Wilson in allen Aspekten mit Witz und Weisheit beschreibt.
Geld und Gewissen
Futurity ist wie gesagt ein kommerzielles Projekt, hinter dem der etwas selbstherrlich, aber nicht schurkisch gezeichnete Finanzier August Kemp steckt. Er verdient zweifach: An Touristen des 19. Jahrhunderts, die staunend seine Stadt besuchen, und an Zeitreisenden, die auf durchorganisierte Touren in die Vergangenheit gehen.
Die Kommerzialität ist einer der Kritikpunkte an Kemps Projekt, doch es gibt noch mehr. Mit ihrem offenen Auftreten verändern die Zeitreisenden die Vergangenheit. Das bereitet ihnen keine Gewissensbisse, denn es ist weniger eine Reise von der Zukunft in die Vergangenheit als ein Wechseln zwischen parallelen Zeitsträngen, die im Hilbert-Raum eingelagert sind. Sie bleiben stets nur einige Jahre, dann bricht der Zukunftskarneval seine Zelte ab (vor allem deshalb, weil er aufgrund der akkumulierten Veränderungen kein authentisches Vergangenheitserlebnis mehr anbieten kann). "Last Year" heißt der Roman, weil die City of Futurity inzwischen in ebendiese Phase eingetreten ist.
Als Abschiedsfeuerwerk will Kemp den Menschen des 19. Jahrhunderts en gros medizinische und technologische Kenntnisse zukommen lassen. Doch merken kritische Stimmen an, dass er damit lebensrettendes Wissen länger als nötig zurückhält. Auch die IdealistInnen richten aber beträchtlichen Schaden an: Sie schmuggeln moderne Waffen für Indianer, Ex-Sklaven und chinesische Einwanderer ein, weil denen laut Geschichtsbüchern eine Zeit der Verfolgung droht – was natürlich erst recht in Gewalt mündet. Und last but not least sind da noch die Menschen der Vergangenheit selbst, die sich zwar einigermaßen an die ihnen ungehobelt erscheinende Zwanglosigkeit der Gäste gewöhnt haben. Als ihnen weitere Infos über die Zukunft geleakt werden, ist das Maß aber voll: Ein schwarzer Präsident? Schwulenehe? Diese Zukunft wollen wir nicht! Ein Konflikt bahnt sich an.
Sehr empfehlenswert
Robert Charles Wilson tut das, was ein guter SF-Autor tun muss: Er präsentiert eine faszinierende Ausgangsidee und lässt sie dann von seinen Figuren in all ihren Aspekten beleuchten. Kombiniert mit Wilsons glasklarem Stil hat man damit einmal mehr das Gefühl, ein Buch aus der Klassiker-Ära der Science Fiction zu lesen.

Jo Walton: "Das Jahr des Falken"
Klappenbroschur, 287 Seiten, € 17,40, Golkonda 2016 (Original: "Half a Crown", 2008)
Dritter und abschließender Teil von Jo Waltons "Inspector Carmichael"-Reihe, die die Autorin selbst sehr schön als "Stillleben mit Faschisten" bezeichnet hat. Nach den Ereignissen von Teil 2 ("Der Tag der Lerche") machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 1960, in dem in London eine große Friedenskonferenz angesetzt ist. Nach 20 Jahren Krieg und Atombombenabwürfen auf Moskau und Miami ist der Sieg der Achsenmächte vollendet. Russland wurde unterworfen und aufgeteilt, den geschwächten USA dürfte in mittlerer Zukunft ein ähnliches Schicksal bevorstehen. Auf der ganzen Welt gibt es nur noch wenige Oasen von Demokratie und Liberalität.
Großbritannien ist keine davon. Seit im ersten Band (auf Deutsch "Die Stunde der Rotkehlchen") ein Zirkel rechtsgerichteter Adeliger das politische System unterhöhlt hat, ist das Königreich ein Verbündeter Deutschlands – und nur noch nominell eine Demokratie. "Verbrecher" werden seit Jahrzehnten in die Lager auf dem Kontinent deportiert, mittlerweile laufen auch die Planungen für das erste Todeslager auf englischem Boden. Aber weiter rechts geht immer: Die Bewegung British Power will den heuchlerischen De-facto-Faschismus durch the real deal ersetzen. (Nebenbei bemerkt: Der singende, gitarrenschwingende Agitator aus Liverpool, der da auf einer Fascho-Kundgebung auftritt – war das etwa ein Beatle? Walton spricht es nicht aus.) Und der Duke of Windsor, also der abgedankte König Edward VIII., der auch in der realen Geschichte mit Deutschland liebäugelte, würde ebenfalls gerne wieder mitmischen.
Carmichaels Drahtseilakt
Diese Gemengelage ist brisant genug, dass Walton diesmal anders als in den Vorgängerbänden die Handlung nicht an einem Mordfall aufzieht, sondern sich voll und ganz dem gesellschaftlichen Gärungsprozess widmet. Mittendrin steckt Inspector Carmichael (von dem wir zum Abschluss übrigens tatsächlich noch so ganz nebenbei den Vornamen erfahren werden). Brillant und sorgfältig als Ermittler einerseits, erpressbar weil schwul andererseits, hat das System in ihm den idealen Kandidaten gefunden, um den Wacht genannten Geheimdienst zu leiten. Carmichael musste sich in diese Rolle fügen und führt sich auch systemtreu aus – doch insgeheim hat er auch die Innere Wacht ins Leben gerufen: ein kleines Grüppchen aufrechter Beamter, das schon tausenden Juden und anderen unliebsam Gewordenen zur Flucht ins Ausland verholfen hat.
Carmichael steckt in einem Zwiespalt, der jeden Menschen mit weniger Disziplin längst zerrieben hätte. Er hat sich so an diesen atemberaubenden Drahtseilakt gewöhnt, dass ihn ein Kollege und Mitverschwörer – der "Vorzeigejude" seiner Abteilung – daran erinnern muss, dass auch er letztlich nicht unangreifbar ist: "Was uns voneinander unterscheidet, ist die Tatsache, dass Sie im Grunde nicht damit rechnen, deportiert zu werden. Sie wissen natürlich, dass es möglich ist, aber Sie rechnen nicht damit. Sie glauben, wenn Sie weiterhin tun, was die von Ihnen verlangen, sich aus allem raushalten und jedes Mal ein Stück Ihrer Seele verkaufen, wenn es nötig ist, und wenn Sie dafür sorgen, dass alles andere im Verborgenen bleibt, landen Sie nicht im Güterwaggon. Das glaube ich in meinem Fall nicht. Den Luxus kann ich mir nicht leisten."
Wie schon in Band 1 und 2 werden die Kapitel um Carmichael denen einer jungen Frau gegenübergestellt – im dritten Band nimmt diese Rolle Elvira Royston ein, Carmichaels Ziehtochter. Sie stammt aus der Unterschicht, freundete sich in der Schule aber mit einer Adeligen an und hängt jetzt zwischen den gesellschaftlichen Schichten. Sie wird demnächst ganz altmodisch bei Hofe als Debütantin präsentiert werden – zugleich lassen die Verwandten ihrer Freundin Betsy sie spüren, dass sie nicht wirklich dazugehört. Sie ist eben nicht ganz ...; der Rest wird nie ausgesprochen. Einmal mehr versteht es Walton meisterlich, den Ton subtiler Verachtung wiederzugeben: "Aber warum in aller Welt willst du das Mädchen dann an Betsys Seite in die Gesellschaft einführen?" Mitgefühl quoll aus jedem Wort Lady Bellinghams wie Creme aus einem Eclair.
Form und Inhalt
Und wie zuvor setzt Walton auch in diesem Band die Erzählform als inhaltliche Aussage ein. Elvira erzählt wie ihre Vorgängerinnen in Ich-Form. Das spiegelt wider, dass sie mitten im System steckt und – trotz eigener Lebensziele, die nicht ganz den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen – betrüblich naiv ist. Einmal fragt sie sich allen Ernstes, welches Kleid optisch am besten zu einer faschistischen Kundgebung im Fackelschein passt. Carmichaels Kapitel hingegen werden in dritter Person erzählt – es ist der nüchterne, objektive Blick auf die Welt. (Das scheint Carmichael zwar ungewollt zu einer Nebenfigur in seiner "eigenen" Serie zu machen, aber seinen Namen trägt sie ohnehin nur in der deutschen Ausgabe. Im Original ist es einfach die "Farthing"-Trilogie.)
Ein vergleichbares Stilmittel wendet Walton in Bezug auf Carmichaels Lebenspartner Jack an. Im vorigen Band bloß erwähnt, muss er sich auch hier – bis auf einen einzigen Abschnitt im späteren Verlauf – mit einer Rolle im Off begnügen. Wenn er in Erscheinung tritt, dann nur, um Carmichaels Gästen kurz Tee zu servieren. Walton versteckt ihn also in der Erzählung genauso, wie Carmichael ihn in seinem Leben verstecken muss: das ist sehr raffiniert gemacht.
Der einzige Minuspunkt an "Das Jahr des Falken" – und der Grund, warum der Roman im letzten Moment doch noch aus dem Jahres-Best-of rausgefallen ist – ist der Schluss. Der ist einfach zu gerafft und für mich auch nicht glaubwürdig ausgefallen. Vielleicht ist das ja letztlich der Preis, den Walton für ihre zu Recht gelobte Subtilität zahlen musste: Dass sie nach all den kleinen, feinen Trippelschritten einen überstürzten Dreh finden musste, um das Ganze doch noch zu einem Ende zu bringen. Schade, was das anbelangt – insgesamt aber eine grandiose Trilogie.

Will McIntosh: "Faller"
Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, Tor Books 2016
Vogelwilde Physik und Technologie gibt's nicht nur bei Cixin Liu, sondern auch bei Will McIntosh – auch wenn der US-Autor es versteht, diese mit seiner unvergleichlich menschlichen Note zu konterkarieren. All das in seinem jüngsten Roman, der ein bisschen so wirkt, als wollte McIntosh die jeweiligen Charakteristika seiner früheren Romane in einem einzigen Buch zusammenbringen: Den langsamen, mit gutem Auge fürs Detail beschriebenen Untergang der Zivilisation von "Soft Apocalypse". Die unsterbliche Liebesgeschichte von "Love Minus Eighty". Die Unbarmherzigkeit von "Defenders". Und die quasi-magische Technologie des YA-Romans "Burning Midnight". Dabei war es eher umgekehrt: "Faller" ist die Romanfassung der ersten SF-Erzählung, die McIntosh je schrieb – und am Anfang der Karriere konzipiert man eben besonders ehrgeizig.
Das große Erwachen
Der Einstieg könnte faszinierender kaum sein: Der Protagonist, der sich später "Faller" nennen wird, erwacht auf der Straße, ohne sich an seinen Namen oder irgendetwas anderes erinnern zu können. Rasch wird erkennbar, dass es sich nicht um die Nachwirkungen eines simplen Unfalls handelt, denn allen Menschen um ihn herum geht es genauso. Da sie sich an nichts vor diesem Augenblick erinnern können, wundern sie sich auch nicht über das, was uns LeserInnen vom Sessel reißt: Ihre Welt – die Welt – ist ein Fragment einer Großstadt, das mitten in einem endlos blauen Himmel schwebt.
Sie vermuten zwar bald, dass die Welt einst größer gewesen sein könnte, doch sicher können sie sich nicht sein. Derweil glauben wir im Lauf ihrer unbeholfenen Orientierungsversuche einiges wiederzuerkennen, das für sie unerklärlich bleibt: Dieses Gebäude da dürfte wohl ein Museum sein, und die seltsamen schwebenden Kugeln Planetenmodelle. Und ist dies nun der New Yorker Central Park oder Washingtons National Mall?
McIntosh gibt's uns von Anfang an kalt-warm. Auf der einen Seite stehen rührend menschliche Gesten – etwa wenn Faller zwei verzweifelten alten Menschen anhand von Fotografien erklärt, dass sie zusammengehören: "That's you." Doch schon bald setzt sich aufgrund von Nahrungsmangel brutal das Recht des Stärkeren durch: Kinder und alte Menschen werden zu Hunderten über den Rand ins Nichts gestoßen – und die Täter schluchzen, während sie den aus ihrer Sicht notwendigen Massenmord begehen.
Einfach loslassen
Beim Erwachen fand Faller in seinen Taschen ein Foto, das ihn mit einer (ihm natürlich unbekannten) Frau zeigt, einen Zettel, auf den einige unverständliche Symbole in Blut gezeichnet sind, und einen Spielzeug-Fallschirmspringer. Der bringt ihn auf die Idee, sich selbst im Fallschirmspringen zu üben. Erst schafft er sich damit nur seine persönliche Nische – doch eines Tages, da gleitet er über den Rand der Welt. Im weiteren Verlauf des Romans werden übrigens einige noch spektakulärere Stürze folgen. Die Szene aus "Goldeneye", in der James Bond einem leeren Flugzeug hinterherspringt, ist NICHTS dagegen. Word!
Doch zurück zum ersten Sprung "zwischen den Welten": Tagelang fällt unser Held durch eine scheinbar unendliche Atmosphäre – bis schließlich am Horizont eine weitere fliegende Insel auftaucht und Faller erkennt, dass seine Zeichnung eine Karte mehrerer Welten ist. Auf diesen Welten wird er unter anderem auf die Frau auf seinem Foto treffen – aber anders als gedacht. Es wird die erste von vielen Überraschungen für ihn und uns sein.
Singularität für den Hausgebrauch
Im Schnitt alle zwei Faller-Kapitel wechseln wir auf eine zweite Handlungsebene, die offenbar in der Vergangenheit liegt. Hier hat der Physiker Peter Sandoval eine Singularität entweder erzeugt oder entdeckt – auf jeden Fall aber nutzbar gemacht. Und zwar in origineller Weise: für Quantum-cloning. Das Wurmloch verdoppelt alles, was man hineinsteckt, ob tote Objekte oder Lebewesen. Und das in verbesserter Form: Lebewesen werden nämlich – überaus praktisch in einer Welt voller freigesetzter Biowaffen – ohne Parasiten oder infektiöse Mikroben dupliziert (warum z.B. die nützliche Darmflora von dem Effekt nicht betroffen ist, bleibt freilich offen ...).
McIntosh, der "Faller" als seine bislang größte Herausforderung beim Schreiben bezeichnet hat, bekennt freimütig, dass er von Physik keine Ahnung hat. Und dass er Rat bei einem Astrophysiker suchte. Den dürften zwar sowohl der Duplikator als auch die fliegenden Inseln zum Haareraufen gebracht haben, aber ein paar Handwaving-"Erklärungen" konnte er dem Autor immerhin stecken. Und sei's drum: Wer wasserdichte Wissenschaftlichkeit sucht, ist hier fehl am Platze. Wer aber nur einen spannenden und ideenreichen Roman lesen möchte, der liegt richtig.
Die Zeichen stehen auf Eskalation
Will McIntoshs Stärke ist seit jeher die menschliche Seite – und wie sich großmaßstäbliche Ereignisse auf den Einzelnen auswirken. Im Hintergrund der Forschungen am Duplikator setzt sich ebenso langsam wie unaufhaltsam ein Weltkrieg um die letzten Energiereserven in Gang. Wie schon in "Soft Apocalypse" versteht es McIntosh hervorragend, mit wenigen treffenden Worten eine Situation zu skizzieren, die sich Schritt für Schritt von schlecht zu immer noch schlechter wandelt. Besonders beklemmend liest sich das Szenario mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen, das sich seit 2016 verstärkt in Richtung Konflikt und Eskalation bewegt. McIntosh zeichnet diese Entwicklung konsequent weiter – viel weiter, als beim Lesen angenehm wäre.
Aber auch im Zwischenmenschlichen stehen die Zeichen auf Eskalation. Zwischen Peter, seinem großspurigen Kollegen/Frenemy Ugo Woolcoff und ihren beiden Frauen entwickelt sich ein brutales Human Drama, das die vier zu Exzessen wie in einer griechischen Tragödie treiben wird. Es schnürt einem den Hals zu, wenn eine der Figuren – infiziert und todkrank – in eine Abfalltonne krabbelt, wo sie pflichtbewusst darauf wartet, von ihrem gesunden Duplikat erschossen und in Säure aufgelöst zu werden. Und letztendlich, wenn die beiden Handlungsebenen zusammengeführt werden, werden wir sehen, wie sehr die fatale Gemengelage zwischen diesen vier nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern das der ganzen Welt bestimmt hat.
Bilanz: Kein perfekter Roman – dafür stapelt der Autor in seiner Konstruktion einfach zu viele Faktoren übereinander. Zusammen mit der "magischen Technik" führt das schlicht zu einem unplausiblen Eindruck. Nimmt man die diversen Unwahrscheinlichkeiten hin, bleibt jedoch eine spannende und hochoriginelle Erzählung übrig – mit einigen Einsprengseln echter Größe.
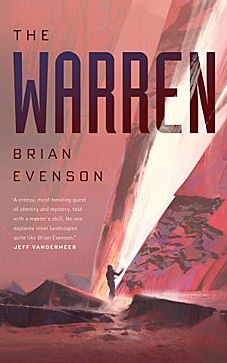
Brian Evenson: "The Warren"
Broschiert, 96 Seiten, St Martin's Press 2016
Kleine Ernüchterung für zwischendurch gewünscht? Da ist man bei US-Autor Brian Evenson immer an der richtigen Stelle. Rundschau-LeserInnen erinnern sich vielleicht an seinen postapokalyptischen Roman "Immobility" von 2013. Evensons jüngste Novelle "The Warren" hat einen sehr ähnlichen – möglicherweise sogar den gleichen – Hintergrund, ist aber sogar noch existenzialistischer gehalten.
Schauplatz ist der titelgebende "Warren" (auf Deutsch: Kaninchenbau), eine Bunkeranlage 71 Jahre nach einer unspezifizierten Katastrophe, die die Außenwelt als verseuchte Einöde hinterlassen hat. Ob außerhalb des Kaninchenbaus noch irgendwo Leben existiert, ist unbekannt – und die Bunkerbewohner werfen ihrerseits Fragen auf, was die Definition von Leben anbelangt.
Im Kopf von X
Als Ich-Erzähler fungiert X, jüngster und möglicherweise letzter Bewohner der Anlage. Einen Namen hat er nie bekommen, der Buchstabe "X" kann aber als gesichert gelten. Denn jede Generation trug alphabetisch aufeinanderfolgende Bezeichnungen, als wären es Würfe von Welpen. Bis "V" waren es immer zwei, aber seitdem hat das "Material", aus dem die Bunkerbewohner "erschaffen" werden müssen, nur mehr für einen gereicht. Alle zogen sie in die Außenwelt hinaus, um dieses Material zusammenzutragen, und erlagen anschließend der dabei erlittenen Verseuchung. Auch X's Vorgänger ist diesen Weg gegangen und hat unsere Hauptfigur einsam und ratlos zurückgelassen.
X trägt jedoch eine Bürde, die keiner seiner Vorgänger auf sich nehmen musste: Weil das "Monitor" genannte Computersystem der Anlage fehleranfällig geworden ist, hat man die darin gespeicherten Bewusstseinsinhalte der früheren Bunkerbewohner in X's Gehirn transferiert. Wo sie nun neben- und übereinander liegen und zu einer geistigen Architektur geführt haben, die den Leser (anfangs zumindest) genauso verwirrt wie X selbst: Parts of me know things that other parts do not, and sometimes I both know a thing and do not know it, or part of me knows something is true and another part of me knows it is not true, and there is nothing to allow me to negotiate between the two. Zu Beginn ist X also buchstäblich erst mal damit beschäftigt, sein Ich zu konstruieren.
Schlimmer noch: Wenn er eines dieser Geistesfragmente "weckt", schädigt er es zugleich; eigene Erinnerungen aus dem Jetzt löschen alte, weil zu wenig Platz in seinem Kopf ist. X muss also sehr vorsichtig mit dem Wissen seiner Vorgänger haushalten. Dabei wäre er so sehr darauf angewiesen, weiß er doch nicht, was seine Aufgabe und letztlich der Sinn seiner ganzen Existenz ist.
Gibt's hier auch Menschen?
Unerwarteterweise stößt X aber doch noch auf ein anderes Lebewesen. In einem Seitengebäude der Anlage wurde ein Mann namens Horak kryokonserviert. Aber ist das nun ein normaler Mensch? X taut Horak auf, was bei diesem erst mal schwere körperliche Schäden verursacht. Doch legt sich bald eine Art heilender Kokon über sein nekrotisches Gewebe: Hatte man zuvor schon X's Wesen angezweifelt, so wirkt Horak mit der Aktion auch nicht mehr wirklich menschlich. Dass ihm im Gegensatz zu X die Strahlen- und/oder Gifthölle draußen nichts ausmacht ("I am the outside manifest"), verstärkt das Rätsel noch. Und nur soviel vorneweg: Auch am Schluss von Evensons enigmatischer Erzählung wird so manche Frage offen bleiben.
Brian Evenson verwendet – je nach Genre – verschiedene Schreibweisen seines Namens: eine Kompartmentalisierung, die X's laufend umgebauter Ich-Konstruktion ähnelt. Bloß hat X keine vergleichbare Kontrolle darüber. Mehrfach muss er feststellen, dass er bzw. sein Körper Dinge getan hat, an die er sich nicht erinnern kann. Offenbar wurde er von einem der alten Geistesfragmente gesteuert – die dann auch noch, um das Maß voll zu machen, die Rolle des Erzählers übernehmen. Rein formal bleibt die Erzählung trotzdem immer beim "ich": ein Verwirrungseffekt ähnlich dem in Ann Leckies "Die Maschinen". And yet, who am I to say that the person I think I am, the personality that had risen to the top like cream, is the real me? These others fill up more of me than I do. Perhaps one of them is the real me and I am the interloper.
Inspiration für "The Warren" war laut Evenson übrigens eine andere Novelle, nämlich Gene Wolfes "Der fünfte Kopf des Zerberus" von 1972. Tatsächlich finden sich hier einige grundlegende Motive wieder – versetzt in ein hermetisches Setting, das in jeder Beziehung auf das absolut notwendige Minimum reduziert worden ist. Und mit einer Hauptfigur, die buchstäblich nichts mehr hat – nicht einmal sich selbst.
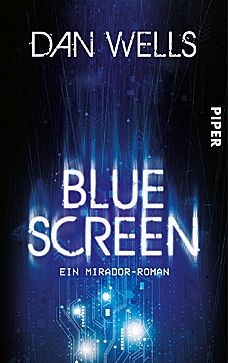
Dan Wells: "Bluescreen"
Broschiert, 364 Seiten, € 13,40, Piper 2016 (Original: "Bluescreen", 2016)
Mit seiner Serienmörder-Trilogie um Hauptfigur John Wayne Cleaver hat sich der US-Amerikaner Dan Wells als Romanautor 2009 ins Licht der Öffentlichkeit katapultiert und rasch eine begeisterte Fangemeinde um sich geschart. Nach den ersten Bänden schob er die "Partials"-Reihe um gentechnisch gezüchtete Übermenschen ein, ehe es mit Cleaver weiterging. Und schon ist der fleißige Schreiber mit einer weiteren Produktlinie auf dem Markt. Für die "Mirador"-Reihe verwendet er ein klassisches Cyberpunk-Szenario und vereinfacht es in Richtung jugendkompatibler Abenteuergeschichten. Und wie der erste – inhaltlich übrigens weitgehend in sich abgeschlossene – Band "Bluescreen" zeigt, macht er das gar nicht schlecht.
Zeit und Ort
Wir befinden uns in der Welt des Jahres 2050, in der jeder (außer älteren Menschen und bewussten Verweigerern) ein Djinni genanntes Implantat trägt, ein Interface zwischen dem Gehirn und der vernetzten Infosphäre. Wie sehr man davon abhängig ist, wird Hauptfigur Marisa Carneseca erst dann klar, als sie ihr Implantat einmal notgedrungen abschalten muss und selbst die banalsten Tätigkeiten plötzlich mühsam werden: Marisa rüttelte an der Vordertür, die jedoch abgeschlossen blieb. Sie schloss die Augen und seufzte über sich selbst, weil sie es vergessen hatte. Ohne ihr Djinni erkannte das Haus sie nicht. Ihr wurde fast schwindelig, als sie daran dachte, dass alle ihre Geräte untereinander kommunizierten, während sie selbst eine bloße Dreingabe war.
Schauplatz der Handlung ist eines der weniger noblen Viertel von Los Angeles, in dem Marisas Eltern ein kleines Restaurant betreiben und in dem Gangs das Gesetz sind. Marisas ältester Bruder wurde von den Eltern verstoßen, weil er sich einer dieser Gangs angeschlossen hat. Wenn wir ihn kennenlernen, erfahren wir allerdings, dass er gute Gründe dafür hatte: In einer Gesellschaft, in der fast alle Arbeiten und Dienstleistungen von Nulis genannten Robotern erledigt werden, gibt es kaum noch Jobs für Menschen. Marisa und ihre Freunde – allesamt noch SchülerInnen – verdienen sich ein Zubrot als populäre Gamer, die ihre Einsätze in der Spielwelt von Overworld in die sozialen Netzwerke stellen.
Seitenbemerkung: Ein Los Angeles der unteren Mittelschicht als Hintergrund, das multikulturelle Umfeld, der Stand der Technologie und Wettkämpfe als Einnahmequelle: Fast scheint es, als hätte Wells vor dem Schreiben von "Bluescreen" S. B. Divyas Novelle "Runtime" gelesen. Ein Eindruck, der sich noch verstärkt, weil hier auffällig viele Hightech-Prothesen am Werk sind: Marisa hat seit einem Unfall in ihrer Kindheit einen künstlichen Arm, Gangster rüsten sich freiwillig körperlich auf, bei anderen bleiben die Cyborg-Elemente sogar unerklärt – so selbstverständlich scheinen sie zur Handlungszeit zu sein.
Zur Handlung
"Cherry Dogs" nennt sich Marisas Gamer-Team, dem neben zwei aus Indien und China zugeschalteten Mitgliedern einige recht unterschiedliche Charaktere angehören, die ebenfalls in Los Angeles leben: Bao etwa, der als Taschendieb durchkommt und ein Djinni verweigert. Die stinkreiche Anja, die technisch ähnlich gut bewandert ist wie Profi-Hackerin Marisa. Und Sahara, die auf den ersten Blick nur eine eitle Social-Media-Selbstdarstellerin zu sein scheint – bis sie ihre Martial-Arts-Kenntnisse unter Beweis stellt: in der virtuellen ebenso wie in der realen Welt. Auf die obligatorischen VR-Kampfszenen hat Wells natürlich nicht verzichtet (die längste kommt gleich zu Beginn des Romans), er setzt sie aber keineswegs im Übermaß ein. Alle diejenigen, denen solcherlei Auflockerungs-Action am Arsch vorbeigeht, müssen also keine Angst haben.
Mit der Schul- und Spielroutine ist es allerdings vorbei, als die Freunde eines Tages mit Bluescreen konfrontiert werden: einer Art App, die auf den ersten Blick nur einen ebenso spektakulären wie gesundheitlich unbedenklichen Trip verspricht. Die aber, wie sich bald herausstellt, nur der erste Schritt zu einem veritablen Mindhack ist. Marisa geht der Sache nach – und spätestens, wenn der geheimnisvolle "Grendel" sie aus den Tiefen des Darknet kontaktiert, wird klar, dass unsere jungen HeldInnen hier in etwas richtig Großes hineingeraten sind.
Pluspunkte und eigentlich kein Minus
"Bluescreen" ist wie gesagt Cyberpunk light und YA-kompatibel, trotzdem wirkt Wells' Welt ziemlich stimmig konstruiert (anders als beispielsweise die von Jens Lubbadehs "Unsterblich" oder Bruce McCabes "Unfehlbar"). Wells versteht sich auf flüssiges Erzählen – und dankenswerterweise auch darauf, immer wieder eine gelungene Pointe einzubauen. Etwa wenn es auf den großen Showdown zugeht: Zu einem Zeitpunkt, da es unsere ProtagonistInnen schon mit Angriffen durch ferngesteuerte "Marionetten", Bandenkriegen und Railgun-Schießereien zu tun hatten, macht Marisa ein Aspekt ihres Gegenangriffsplans die allermeisten Sorgen: "Es ist sehr gefährlich, mit einem Auto zu fahren, das von einem Menschen gesteuert wird."
Ein guter Roman für LeserInnen, die nur gelegentlich zu Science Fiction greifen und dann nicht hüfthoch durch komplexeste Geflechte unverständlicher Neologismen waten können oder wollen. Und solche, die das gewohnt sind, finden hier eine erholsame Abwechslung. Band 2 ist auch im Original noch nicht erschienen – es lohnt sich, ein Auge offen zu halten.
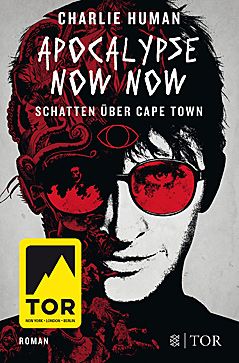
Charlie Human: "Apocalypse Now Now. Schatten über Cape Town"
Broschiert, 352 Seiten, € 10,30, Fischer Tor 2016 (Original: "Apocalypse Now Now", 2013)
Ein gewisser Jugendlichkeitsschwerpunkt hat sich da im ersten Saisonprogramm der neuen SF-Schiene von Fischer abgezeichnet: Neben Romanen mit juveniler Machart wie Wesley Chus "Tao"-Reihe oder Becky Chambers' "Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten" (kommt in der nächsten Rundschau) gab es auch solche mit einem Teenager als Hauptfigur: erst Katherine Addisons "Der Winterkaiser" und nun diese fiese kleine Urban Fantasy hier.
Ein Früchtchen
Der 16-jährige Baxter Zevcenko ist ein Schüler aus Kapstadt, wo auch der Autor Charlie Human lebt; "Apocalypse Now Now" war sein Romandebüt. Und hat man einen Baxter als Ich-Erzähler, dann prägt das den Ton in sehr unterhaltsamer Weise. Denn Baxter ist intelligent und (sprach-)kreativ, aber auch großmäulig, intrigant und Gewalt nicht abgeneigt: An seinen unschönen Seiten lässt er uns ohne jede Scham teilhaben. Das mündet in einer mitreißenden Stakkato-Erzählung zwischen punkiger Attitüde und blumigsten Sprachschöpfungen. Lese jeder selbst, was Sauron mit Augentripper oder Drogeriemarkt-Cro-Magnons bedeutet.
Aber Baxter ist auch ein Getriebener – vom eigenen Ehrgeiz und noch mehr: Er wird von apokalyptischen Visionen heimgesucht. Sein Großvater, der seine Familie immer mit Gefasel über "Riesenkrähen" zur Verzweiflung trieb, glaubt Baxter das Wissende Auge vererbt zu haben. (Aus den Familienerinnerungen der Zevcenkos könnte man übrigens die eine oder andere "Shameless"-Folge stricken.) Ein drittes Auge ritzt allerdings auch der Serienmörder, der in Kapstadt sein Unwesen treibt, seinen Opfern auf die Stirn. Kurz: Baxter hat eine Menge zu verdauen. Kein Wunder, dass er seine Persönlichkeit bei Bedarf in unterschiedliche Komponenten aufspaltet: den braven MetroBax und den knallharten BusinessBax ("meinen Donald Trump des Cerebellums").
Wenn das die Mama wüsste
An Baxters Highschool laufen zwischen rivalisierenden Gangs Machtkämpfe von beachtlicher Skrupellosigkeit. Die einen sind auf Waffenhandel spezialisiert, die anderen auf Drogen – Baxters Gang, "die Spinne", hat ihre Marktnische in der Pornografie gefunden. Aktuell im Trend liegen die Monsterpornos des Unternehmens Glamorex – und nicht nur Baxter kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass die Monster darin recht echt wirken. Als Baxters Freundin Esmé entführt wird, gerät er an den "verifizierten Schamanen" Jackie Ronin, einen Geisterjäger mit Vorgeschichte. Zusammen ziehen sie in den Kampf gegen das übernatürliche Böse.
Charlie Human erfindet für seinen Roman ein ganzes transzendentes Ökosystem, gespeist unter anderem aus den Mythologien der Zulu, San und der Ashanti. Und angereichert um neuere Schöpfungen wie Spinnenparasiten, die ihre Opfer zu Marionetten machen, oder ein Monster aus Elektrizität, das in klassischem Ghostbusters-Stil beseitigt wird. Etwas schwieriger zu händeln ist's dann schon, wenn bei einer Monster-Orgie auch Menschen fröhlich mitmischen: Politiker saugen genüsslich das Mark aus abgetrennten kleinen Fingern, und mehrere Mitglieder der Kricket-Nationalmannschaft nippen gerinnendes Blut aus Martini-Gläsern. Wie es aussieht, steht die Elite von Kapstadt auf Zombie-Chic und Gourmet-Kannibalismus. Verdammte Poser.
Witzigerweise werden Plot und Hauptfigur, wenn die eigentliche Urban-Fantasy-Handlung erst mal in Gang kommt, eher konventioneller. Sowas kennt man schon – Baxters Schulalltag hingegen ließ einen beim Lesen den Mund offenstehen. Denn im Grunde – man könnte da durchaus eine Metapher für Jugend(kultur) an sich herauslesen – befand sich Baxter schon vorher in einer untergrundigen Parallelwelt. Die Eltern sind völlig ahnungslos, was Gangs, Porno- und Drogenhandel und die zynische Weltsicht ihrer Sprösslinge betrifft. Wenn die Wind davon bekämen, was an Baxters Highschool abgeht, würden sie nach einem kurzen Schockmoment einen Strafenkatalog alttestamentarischer Prägung zücken.
Der Twist
"Ich heiße Baxter Zevcenko. Ich bin sechzehn Jahre alt. Ich bin auf der Westridge High School in Kapstadt und habe keine Freunde. Ich habe Menschen getötet. Viele Menschen. Und zwar brutal. Zumindest höre ich, es seien Menschen gewesen. Für mich sahen sie mehr wie Monster aus. Aber ich will nicht mit Einzelheiten langweilen. Wer möchte, findet alles darüber im Internet."
... so heißt es ganz zu Beginn des Romans, und das ist der Clou an der Geschichte. Denn ganz früh ist damit der Keim des Zweifels gesät: Bildet sich Baxter sein Dasein als Bad Buffy etwa nur ein und ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Soziopath? Charlie Human nährt diesen Zweifel beständig. Er lässt uns Auszüge aus der Patientenakte eines Psychiaters lesen, in der dieser vermutet, dass alle Geschichten Baxters – von den Schulgangs bis zur Dämonenjagd – nur Ausgeburten der Fantasie eines kleinen Armutschkerls sind. Und wirklich: Sind diese Geschichten nicht einfach zu unwahrscheinlich? Ein Spinnengott? Geistiger Kontakt zu Vorfahren aus dem 19. Jahrhundert? Oder ein paar 16-Jährige, die mal eben einen Boss der Russenmafia entführen?
Das Rätselraten, was es mit Baxter nun wirklich auf sich hat, ist noch spannender als die eigentliche Monsterjagd. Und weil das einer großen Zahl von LeserInnen großen Spaß gemacht hat, wurden Baxters Abenteuer in einem zweiten Roman fortgesetzt. Auf Deutsch wird "Kill Baxter" Ende Mai erscheinen.
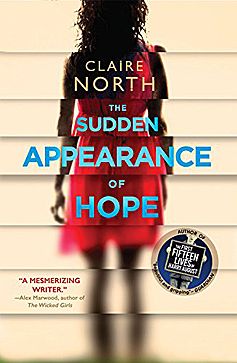
Claire North: "The Sudden Appearance of Hope"
Gebundene Ausgabe, 480 Seiten, Redhook 2016
Die britische Autorin Catherine Webb leistet seit ein paar Jahren unter dem Pseudonym Claire North das, was nicht vielen AutorInnen gelingt: Sie ist dabei, ihr ganz eigenes, schwer einordenbares Subgenre irgendwo zwischen Science Fiction, Contemporary Fantasy und Mystery zu etablieren.
Dies ist nun schon der dritte Roman in Folge, der sich um Personen dreht, die mit ihren besonderen Fähigkeiten wie U-Boote in der menschlichen Gesellschaft leben. Im fantastischen "Die vielen Leben des Harry August" waren es Menschen, die nach ihrem Tod wiedergeboren werden – zurückversetzt ins Jahr ihrer Erstgeburt, doch mit allem seitdem erworbenen Wissen ausgestattet. Und damit auch mit der Möglichkeit, ihr Leben und in weiterer Folge den Lauf der Geschichte zu verändern. Die ProtagonistInnen des darauf erschienenen "Touch" konnten im Todesfall ihren sterbenden Körper verlassen und auf einen anderen überspringen (in der Jugendbuchvariante verwendete Wesley Chu die gleiche Idee in seinen "Tao"-Romanen).
Aus den Augen, aus dem Sinn
Und nun bekommen wir es unter einem wunderschön doppeldeutigen Titel mit dem eigenwilligsten menschlichen Chamäleon zu tun, das die Welt seit langem gesehen hat. Hope Arden aus dem Norden Englands war noch ein Teenager, als sich ihr Leben für immer veränderte: The world began to forget me when I was sixteen years old. A slow declining, one piece at a time. My dad, forgetting to drive me to school. My mum, setting the table for three, not four. Das ist nicht metaphorisch gemeint (jedenfalls nicht metaphorischer, als das Phantastik-Genre per se ist): Hope hat von nun an die – übrigens bis zum Schluss erklärungslos bleibende – Eigenschaft, dass man sie vergisst, sobald man sie aus den Augen verliert. Und man vergisst nicht nur ihr Gesicht, sondern ihre ganze Existenz. Haben Interaktionen mit Hope sichtbare Spuren hinterlassen, konstruiert das Gedächtnis des Betroffenen irgendeine Version ohne Hope. Niemand kann etwas dagegen tun – auch nicht Hope selbst.
Das führt in logischer Konsequenz immer wieder zu Situationen, die so "mind-boggling" sind, dass ein junger Christopher Nolan sie sicher gerne verfilmt hätte. Etwa wenn Hope einer Verhaftung oder ähnlich brenzligen Situationen ganz einfach dadurch entgeht, dass sie sich nur für eine Minute allen Blicken entziehen muss, um anschließend unbehelligt direkt an ihren Verfolgern vorbeispazieren zu können. Oder wenn sie ein- und derselben Person immer wieder "zum ersten Mal" begegnet. Sie lebt über Wochen hinweg mit einer zeitweiligen Weggefährtin zusammen, die um Hopes Geheimnis weiß und sich ständig mit Notizen an deren Existenz erinnert. Trotzdem erschrickt diese nach jedem Aufwachen oder auch nur einem Gang aufs Klo immer wieder aufs Neue, wenn da plötzlich eine "fremde Person" bei ihr im Zimmer steht. Hope erträgt es mit stoischer Gelassenheit.
Verbrechen als einzige Überlebenschance
The world forgot me, and I lost interest in the world. Früh erkennt Hope, dass ihr ein normales Leben unmöglich ist. Sie kann weder dauerhaft eine Wohnung mieten noch einer geregelten Arbeit nachgehen. Ja, sie kann nicht einmal im Fall einer schweren Verletzung regulär im Krankenhaus behandelt werden, da sie alle paar Minuten für eine Erstaufnahme gehalten wird. Rasch muss sie daher extreme Selbstständigkeit entwickeln, und dieser Weg führt sie zwangsläufig ins Verbrechen. Mit Hilfe ihrer Beinahe-Unsichtbarkeit wird Hope erst zur Diebin, ist bald versiert in Martial Arts und Waffengebrauch und nach einigen Jahren im Darknet und auf dem Schwarzmarkt ebenso zuhause wie in der Hautevolee. "The Sudden Appearance of Hope" weist einige Grundzüge einer Agentengeschichte auf und spielt sich daher in Edel-Locations von Dubai über Tokio bis Venedig ab wie ein Bond-Film.
Es ist ein durch und durch einsames Leben, das Hope da führt – auch wenn jemand versuchen wird, ihr "You are free" einzureden. Nur wenige Menschen erlangen in diesem Leben Bedeutung: In tragikomischer Weise zum Beispiel Inspector Luca Evard von Interpol, der über Jahre hinweg auf der Spur dieser mysteriösen Frau ist, die alle vergessen ... und der Hope selbst immer wieder vergisst, nachdem sie mit ihm wieder einmal geschlafen hat. Oder die Online-Bekanntschaft Byron14, die ebenso wie die Erfinderin Filipa Pereyra-Conroy noch eine ganz besondere Rolle spielen wird. Und Parker: ein Mann, der dieselbe Eigenschaft hat wie Hope und den sie ebenso vergisst wie er sie.
Sei etwas Besseres
Der Roman blendet von einer Gegenwartsebene aus laufend in sprunghafter Weise zu verschiedenen Vergangenheiten zurück, aus denen wir allmählich Hopes Werdegang rekonstruieren können. Dieser Gegenwartsstrang beginnt mit einem Diamantenraub in Dubai, und hier geschieht es auch, dass sich Hope erstmals bewusst mit etwas beschäftigt, das bald ihr weiteres Leben bestimmen wird. Eine "Perfection" genannte App erobert gerade die Welt. Ganz ähnlich den Apps in Marc Elsbergs Roman "Zero" sammelt "Perfection" sämtliche Daten ihrer BenutzerInnen, um diesen dann via Belohnungsalgorithmen Verhaltensänderungen vorzuschlagen: Kaufe dieses Produkt! Lass dein Gesicht hier und hier operieren! Optimiere dich! In weiterer Folge wird schließlich auch eine direkte Gehirnbehandlung empfohlen ...
Hope sind "Perfection" und die von ihr produzierten Shiny Happy People von Anfang an zuwider: Anfangs aus dem eher diffusen – aber zutreffenden – Gefühl heraus, dass die App Menschen als Individuen genauso auslöscht, wie auch Hope ausgelöscht wurde. Sie beginnt ihr Interesse auf den Konzern zu richten, der "Perfection" vertreibt – und radikalisiert sich, nachdem sie die kompromisslose Aktivistin Byron24 und schließlich die Erfinderin der App selbst kennengelernt hat. Die wollte eigentlich Menschen mit seelischen Nöten helfen – die kommerzielle Anwendung jedoch ist ihr ein Graus: "I killed humanity. I gave people the tool to suck out everything that was flawed, ugly and bitter, and it turns out that all that is left is a piece of marketing." Allerdings wird Hope auch zu ihrer Überraschung feststellen, dass "Perfection" der Weg wäre, dem Vergessenwerden zu entgehen. Und so dürfen wir gespannt abwarten, auf welcher Seite sie beim finalen Showdown stehen wird.
Gedankenströme
Der Roman ist in einem vergleichsweise kühlen, fast traumwandlerischen Stil gehalten – entsprechend der distanzierten Sicht von einer, die aus der Welt gerückt wurde. Zugleich ist er um einiges experimenteller gehalten als das leicht zugängliche "Harry August". Der Text wimmelt nur so von Assoziationsketten und mentalen Listen, die mitten in der laufenden Erzählung aufpoppen; vor allem im letzten Teil wird das bis zu einem waschechten Stream of Consciousness weitergetrieben. Diese Gedankenketten wirken manchmal ärgerlich beliebig, es sind aber auch echte Perlen darunter. Etwa wenn Hope die Hintergrundmusik bilanziert, mit der auf japanischen Toiletten Pinkelgeräusche übertönt werden sollen: The music the toilet could perform from a tiny speaker above the cistern was of five sorts – traditional Japanese, girl-band, boy-band, the sounds of birds chirruping, or Rod Stewart.
Natürlich war das keine willkürliche stilistische Entscheidung. Sowohl das App- als auch das Vergessenwerden-Motiv führen zum selben Grundthema hin: den Mechanismen und Prozessen, auf denen unser Verstand basiert. Die Bewusstseinsstromtechnik spiegelt dies stilistisch wider. Es geht um Dekonstruktion – und Versuche der Rekonstruktion: Dass Hope im Geiste ständig Punkt-für-Punkt-Aufzählungen und lexikalische Definitionen von Wörtern durchgeht, wirkt, als wollte sie sich anhand von Fakten eine Struktur schaffen und sich letztlich ihrer eigenen Existenz versichern. Zweimal richtet sie einen direkten Appell an die LeserInnen: Whoever you are: these are my words. This is my truth. Listen, and remember me.
Das kleinliche Nachwort
Nach all dem Gesagten wird das jetzt vermutlich etwas billig klingen, aber ich komme nicht dran vorbei: Der Roman ist zu lang. "Perfection" hätte Claire North sicher dazu geraten, zumindest ein Viertel herauszustreichen, denn bei weitem nicht jede Assoziationskette hier ist von Belang. Zudem kommt es in Worten und Werken der ProtagonistInnen immer wieder zu Redundanzen – ein großer Unterschied zur oben zitierten Ökonomie, mit der Hope den Beginn ihres Vergessenwerdens beschrieben hatte. Aber gut: Wer oder was ist schon perfekt?
Kurz zusammengefasst: "The Sudden Appearance of Hope" ist ein ordentlich schwerer Brocken – aber auch ein beeindruckendes Stück Phantastik im besten Sinne.

James P. Hogan: "Das Erbe der Sterne"
Broschiert, 346 Seiten, € 10,30, Heyne 2016 (Original: "Inherit the Stars", 1977)
Super-Ötzi hält die Welt in Atem! Wissenschafter streiten über Mann vom Mond!! Ursprung der Menschheit ins Zwielicht gerückt!!! Sind wir alle Aliens??? So in etwa dürften die begleitenden Schlagzeilen zu den Ereignissen in James P. Hogans Roman "Das Erbe der Sterne" lauten. Die Ereignisse selbst hingegen sind überaus sachlich gehalten: Hier geht es rein um den wissenschaftlichen Prozess, mit dem neue Erkenntnisse verarbeitet werden – selbst so umwälzende wie diese hier.
Zur Handlung
Victor Hunt ist ein britischer Physiker, der in der Forschungsabteilung eines Privatunternehmens arbeitet. Eines Tages wird er aus London in die US-Zentrale des Konzerns zitiert. Und seinen jüngsten Prototypen, das Trimagniskop, das zur sanften Durchleuchtung von Objekten mittels Neutrinos dient, möge er bitte auch gleich mit einpacken. Mit seiner Fähigkeit querzudenken und Verbindungen herzustellen, avanciert Hunt rasch zum Leiter einer von der UNO eingerichteten Expertengruppe mit ganz besonderem Forschungsgegenstand: "Charlie".
So hat man den in einen Raumanzug gehüllten mumifizierten Leichnam eines Mannes getauft, den man in einer Höhle auf dem Mond gefunden hatte. Und er ist 50.000 Jahre alt. Biologisch betrachtet, handelt es sich eindeutig um einen Menschen – er muss also von der Erde stammen. Gleichzeitig gibt es inmitten des altsteinzeitlichen Fossilienbefunds aber nirgendwo auch nur den kleinsten Hinweis auf eine versunkene Hochzivilisation. Aus diesem scheinbar unauflöslichen Paradoxon – zusätzlich befeuert durch weitere, ebenso widersprüchliche Funde – wird sich eine wissenschaftliche Debatte entspinnen, die sich über den gesamten Roman erstreckt.
Ein paarmal wird das "Erbe der Sterne" um herkömmliche SF-Vorgänge angereichert: die Erkundung eines uralten Raumschiffs, ein Marsch über die Mondoberfläche und der Start einer interplanetaren Expedition. Aber das sind nur kurze Einsprengsel. Im Wesentlichen läuft die Handlung in Konferenzen und kleinen Meetings ab, zwischen Untersuchungen, Datensammlung und -auswertung und dem wissenschaftlichen Diskurs, der sich daraus entspinnt. Soll aber keiner sagen, das könne nicht spannend sein: "Haben Sie jemals versucht, eine Kuh aus einer Wagenladung Hamburger zu rekonstruieren?"
Zur Geschichte
Der Roman ist in den späten 2020er Jahren angesiedelt – in einer Zukunft, die bei der Erstveröffentlichung des Romans 1977 plausibel erschienen sein mag (oder zumindest so erhofft wurde), aber an irgendeiner Stelle eine andere Abzweigung genommen hat als unsere Welt: Links ging's zu unseren Handys und iPads, rechts zu den Flugautos des Romans. Rechts zu einer aufgeklärten, friedlich zusammengewachsenen Welt – links ... naja, darüber braucht man keine Worte verlieren. Dass Hogans Zukunft angenehm religionsbefreit ist, erklärt auch, warum die Wissenschafter hier so ungestört über Fakten diskutieren können, die jedes bisherige Weltbild ins Wanken bringen. Die obligatorischen Motive von Demos und religiösen Irren, die das Forschungsprojekt gefährden, kommen in diesem Roman schlicht nicht vor.
Auch an anderer Stelle merkt man dem Roman sein Alter an: Nicht nur dass allenthalben auf Teufel komm raus geraucht wird und keine weibliche Randfigur ohne Anmerkung über ihre Attraktivität davonkommt. Ausführlich beschreibt Hogan an mehreren Stellen, wie Bordcomputer, Satelliten und Rechenanlagen untereinander kommunizieren. Vernetzung zeichnete sich damals als das große kommende Ding von morgen ab, und Hogan, der stets Wert auf die wissenschaftliche Verankerung seiner Werke legte, griff dies mit Gespür für den technologischen Trend freudig auf.
Unter den gut zwei Dutzend Romanen, die der in England aufgewachsene und später in die USA emigrierte James P. Hogan verfasste, ist sein Debütwerk "Inherit the Stars" sein bekanntestes geblieben. Zusätzlich zur Neuauflage, die Heyne nun in der Reihe "Meisterwerke der Science Fiction" herausgegeben hat, bietet der Verlag auch zwei der vier darauf aufbauenden Romane als E-Books an, "Die Riesen von Ganymed" (1978) und "Stern der Riesen" (1981). Nur auf Englisch gibt es die letzten Teile "Entoverse" (1991) und "Mission to Minerva", das Hogan 2005, fünf Jahre vor seinem Tod, nachschob.
Es war einmal
"Das Erbe der Sterne" bietet keine Action im engeren Sinne und ist doch überaus spannend. Im Grunde funktioniert das ähnlich wie bei einem Krimi: Obwohl die Zahl der Lösungsmöglichkeiten – hier die Erklärung des Rätsels um "Charlie", dort die Täterauswahl – begrenzt ist, will man's dann natürlich doch wissen. Dass Hogans Lösung mit dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht vereinbar ist, passt ironischerweise dazu, dass der Autor in späteren Jahren einige äußerst befremdliche Standpunkte vertrat: vom Ablauf des Holocausts bis zum Ursprung von Aids. Was den Roman betrifft, lag es aber schlicht und einfach daran, dass in den 40 Jahren seither viele neue Erkenntnisse gewonnen wurden, von denen Hogan damals noch nichts ahnen konnte. Aber so ist das ja immer mit der Science Fiction: Sie hält immer nur so lange, bis neue Science Facts ins Spiel kommen.
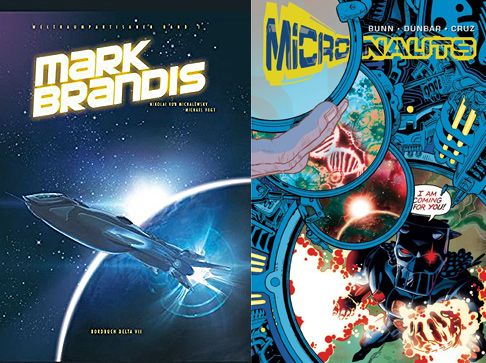
Michael Vogt & Nikolai von Michalewsky: "Mark Brandis: Bordbuch Delta VII"
Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 64 Seiten, € 17,50, Panini 2016
Cullen Bunn, Max Dunbar & David Garcia-Cruz: "Micronauts Volume 1: Entropy"
Graphic Novel, broschiert, 152 Seiten, IDW Publishing 2016/17
Nostalgie-Doppelpack für die Kinder der 70er und 80er! Mit der Reihe "Mark Brandis" schuf Nikolai von Michalewsky das neben "Perry Rhodan" zweite große deutschsprachige SF-Franchise. Unzählige Fans werden noch heute unmittelbar in die Vergangenheit gebeamt, wenn sie Worte wie Kaltes Licht und Homo factus oder Titel wie "Unternehmen Delphin", "Pilgrim 2000", "Salomon 76" oder "Testakte Kolibri" hören. Die Romane erschienen von 1970 bis 1987, seit 2008 werden sie beim Wurdack-Verlag neu aufgelegt. Und jetzt gibt's das Ganze auch als Comic.
Zurück in die EAAU
Nur ganz kurz skizziert, falls jemand die Reihe nicht kennt: Im späten 21. Jahrhundert hat die Menschheit Teile des Sonnensystems kolonisiert, einig ist sie sich aber noch nicht geworden. Mit der EAAU (Europäisch-Amerikanisch-Afrikanische Union) und den VOR (Vereinigte Orientalische Republiken) stehen einander zwei verfeindete Machtblöcke gegenüber. Eine bittere Ironie ist, dass die Serie heute, in Zeiten der schleichenden Rückkehr des Kalten Krieges, aktueller wirkt, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre. Zu dem Eindruck trägt nicht zu knapp auch der Auftritt von General Gordon B. Smith bei, der sich mit seiner Bewegung der Reinigenden Flamme in der EAAU an die Macht putscht und ein faschistisches Regime etabliert.
Doch die guten Kräfte sammeln sich, allen voran natürlich Captain (zunächst noch nicht Commander) Mark Brandis: ein Querdenker, den sein Eigensinn karrieremäßig etwas behindert hat – aber jetzt werden solche Typen mehr denn je gebraucht. Mit einer kleinen und ähnlich der "Enterprise" multinational zusammengesetzten Crew wird Brandis zum Dorn in Smiths Seite werden. Hier im ersten Band noch mit dem superschnellen Raumschiff-Prototyp "Delta VII" unterwegs, später werden andere Flitzer folgen.
Die optische Umsetzung
Comiczeichner Michael Vogt, der zum Aufwärmen vor ein paar Jahren schon mal ein Jugendabenteuer des Serienhelden ins graphische Format übertragen hatte, musste für die hiermit gestartete Reihe von Graphic Novels einige Balanceakte bewältigen. Allen voran natürlich den, dass wir uns hier in der Zukunft einer Vergangenheit befinden. Geschickt tänzelt Vogts Look an der Trennlinie von modern und retro entlang wie "Caprica". Wo es durch den seit den 70ern veränderten Wissensstand nötig wurde, hat er auch in sanfter Weise Michalewsky korrigiert. So wurde etwa die – optisch sehr ansprechend gestaltete – Venus-Kolonie in die Wolkenschichten unserer leider gar nicht attraktiven Nachbarwelt verlegt.
Klare Linien und sehr viel Blau ergänzen sich in "Bordbuch Delta VII" zu einem unterschwelligen Eindruck von Sauberkeit – passend für einen SF-Entwurf aus präzynischen Zeiten. In der Dynamik eines Weltraumflugs kann Vogt schon mal zu schrägen Panels greifen. Es überwiegen aber kleine, regelmäßige Kästchen (sauber und geordnet eben), ergänzt um das eine oder andere Panoramabild: sehr schön etwa die Doppelseite, auf der Brandis mit seinem Jetpack über dem nächtlichen Metropolis schwebt. Insgesamt eine gelungene Rückkehr: Möge die Comicserie so lange laufen wie die Romanausgabe!
P. S.: Steinigt mich, aber ich sage immer noch "Brääääändis".
Makroerfolg im Mikroversum
Komplementär zu Mark Brandis nun ein ähnlich altes Franchise, das so ungefähr überall außer dem deutschsprachigen Tal der Ahnungslosen extrem populär war. Wer in den späten 70ern und frühen 80ern Teile seiner Kindheit in Japan, den USA, Frankreich oder – am wahrscheinlichsten – im bemerkenswert roboterverliebten Italien verbracht hat, wird sich aber noch gut an die "Micronauts" erinnern können.
Die Urquelle befand sich natürlich in Japan, wo sich spätestens in den frühen 70ern die Synergie von SF-Animes und entsprechendem Spielzeug-Merchandising eingespielt hatte. In der Regel gab es erst mal das Anime (also die Geschichten) und dann die Produkte. Das änderte sich, als 1976 das US-amerikanische Unternehmen Mego auf den Plan trat und die "Microman"-Reihe des legendären japanischen Spielzeugkonzerns Takara zusammen mit einigen anderen Produkten international als "Micronauts" vermarktete.
Vom Spielzeug zu Comics
Ihre Kennzeichen: Untereinander kompatible und damit umbaubare Action-Figuren (ein bis zwei Spielzeuggenerationen vor den Transformers) und ein gewisser Science-Fantasy-Look, wie er damals gerade modern war – siehe etwa die "New Gods"-Comics ... oder natürlich auch "Star Wars". Die "Micronauts"-Figur Baron Karza beispielsweise präsentierte sich in schwarzer Cyborg-Ritterrüstung wie Darth Vader – wer hier von wem abgekupfert hat, muss aber offen bleiben: Beide erblickten im selben Jahr das Licht der Welt. Damals lag wohl grade was in der Luft; beziehungsweise im Vakuum.
Passende Geschichten, um all die fantastischen Figuren und Vehikel zu verbinden, musste sich jedes Kind erst mal selbst ausdenken. Erst 1979 strickte Marvel aus der Spielzeuglinie eine erste Comicreihe, die bis Mitte der 80er lief und einige kurzlebige Nachfolger zeugte. Die jüngste und in gelungener Weise modernisierte Fassung kommt vom Comicverlag IDW respektive einem Team aus Autor Cullen Bunn ("Uncanny X-Men", "Deadpool") und Hauptillustrator Max Dunbar ("Dungeons & Dragons" und Diverses von Marvel).
And here we are
Zum Hintergrund: Das mikronautische Universum – Microspace – wird gerade Planet für Planet von einer möglicherweise intelligenten "Entropie-Wolke" verschlungen. Der Abwehrkampf gestaltet sich aber schwierig, weil zwischen dem Wissenschafts- und dem Verteidigungsministerium der dominierenden Zivilisation ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Was uns schon zur ersten Modernisierung bringt: Kaum jemand ist hier wirklich gut oder böse (nicht einmal Karza), sondern nur Diener einer Seite.
Auch unser Heldenteam hat einen wenig hehren Hintergrund: Sie sind – "Firefly" lässt grüßen – im Grunde nur eine Schmugglerbande in Diensten eines schmierigen Geschäftsmanns, dessen Gorillas Wetten darauf abschließen, welcher Planet als nächster krachen geht. Aber sie erkennen zumindest eine gute Sache, wenn sie sie in den Hintern beißt, und verschreiben sich ihr. An ihrer Spitze der pazifistische Oz (ein Pharoid), gefolgt von der Jetflügel tragenden Phenolo-Phi (Typ Space Glider) und einem gentechnisch erzeugten namenlosen Supersoldaten aus der Acroyear-Baureihe.
.. womit schon einige klassische Produktnamen gefallen wären. Das Team wird ergänzt um den geschwätzigen Roboter Microtron und den frankensteinesken Mecha Biotron. Plus irgendeine Neuerfundene ohne Mego-Historie, weil zum Update natürlich auch ein höherer Anteil an weiblichen Figuren gehört. (Was allerdings auch nötig war, ursprünglich lag er bei null.)
Next: "Micronauts, Vol. 2: Earthbound"
Die erste Ausgabe des Reboots präsentiert sich als ausgesprochen unterhaltsamer Mix: Da wirbeln die Energieschwerter, Raketen, Raumschiffe und wie Projektile abfeuerbaren Körperteile nur so durcheinander, während am Hofe des Imperators eifrig intrigiert wird. Kombiniert wird die Action mit Witz und einem Zeitreise-Mysterium, das der Handlung einen weitergespannten Rahmen verleiht.
Das lässt sich als SF-/Superhelden-Comic auch ohne mikronautisches Vorwissen genießen. Den Hauptspaß haben aber natürlich "Micronauts"-Fans, die ihr ehemaliges Spielzeug hier mal in Aktion sehen können. Ob Red Falcon oder Membros, die Zeitreise-Sarkophage oder die Hornetroid-Flugmaschinen: vom klassischen "Microman" bis zu den obskuren, nur noch für den italienischen Markt produzierten Figuren der Spätphase – hier kehren sie alle wieder. Und wenn noch nicht in diesem Band, dann im zweiten, der im Mai erscheinen soll. Ist schon vorbestellt.

Daryl Gregory: "Afterparty"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Fischer Tor 2017 (Original: "Afterparty", 2014)
Daryl Gregory: "Uns geht's allen total gut"
E-Book, 137 Seiten, € 4,90, Fischer Tor 2017 (Original: "We Are All Completely Fine", 2014)
Robert Charles Wilson: "Kontrolle"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Heyne 2017 (Original: "Burning Paradise", 2013)
Kommen wir abschließend noch zu deutschen Ausgaben von Büchern, die hier schon im Original besprochen wurden. Da wird sich heuer ja so einiges Erfreuliche tun. Den Anfang machen diese drei Jänner-Titel (die Links führen zu den Rezensionen der Originalausgaben).
Eeeeeendlich!
Seit Jahren rede ich mir den Mund fusselig, dass sich doch bitte endlich mal ein deutschsprachiger Verlag Daryl Gregorys annehmen möge. Er ist einer der spannendsten Phantastikautoren unserer Tage – kann doch nicht sein, dass man von ihm auf Deutsch nur die "Planet der Affen"-Comics bei Cross Cult bekommt; die nebenbei bemerkt hervorragend sind. Aber jetzt ist es so weit: Fischer Tor hat Gregory für sich entdeckt und bringt als erstes – durchaus verständlich – denjenigen Roman heraus, der sich am ehesten innerhalb wohldefinierter Genregrenzen bewegt.
"Afterparty" von 2014 ist ein ebenso spannender wie vergnüglicher Roadtrip durch eine Welt der nahen Zukunft, in der jedermann Designerdrogen unterschiedlichster Art produzieren kann. Die haben teilweise erstaunliche Wirkungen – die für die Handlung wichtigste ist jene, die uns Gott sehen lässt. In echt.
Mehr Gregory
Zeitgleich mit "Afterparty" hat Fischer die Novelle "Uns geht's allen total gut" ("We Are All Completely Fine") als E-Book herausgegeben. Die sich durch das auszeichnet, was für Gregory so typisch ist: originelle Ideen. In diesem Fall geht es um eine Selbsthilfegruppe von Menschen, die durch die Begegnungen mit verschiedenen Monstern traumatisiert wurden. Während wir ihren Therapiesitzungen beiwohnen, stellen wir fest, dass all diese Monster wohlbekannte Archetypen des Horror-Genres sind.
"Uns geht's allen total gut" ist ein raffinierter Streifzug durch die Genregeschichte, zugleich auch ein möglicher Ankerpunkt für weitere Erzählungen, in denen genauer auf die einzelnen Figuren eingegangen werden kann. Einen solchen Ableger gibt es auf Englisch bereits, nämlich "Harrison Squared". Gregorys nächster Roman wird allerdings einen anderen Hintergrund haben: "Spoonbenders" wird sich um eine Familie drehen, die mit ihren psychokinetischen Kräften im Fernsehen Karriere gemacht hat; die Originalausgabe ist für Juni angekündigt.
The Great Wilson
Längst etabliert auch in der deutschsprachigen Leserschaft ist Robert Charles Wilson. Nach einem kleinen Päuschen kommt es bei Heyne nun zu einem neuen Übersetzungsschub. Frisch veröffentlicht ist "Kontrolle", Wilsons Roman "Burning Paradise" von 2013. Die Geschichte weist einige Parallelen zur Wilsons populärstem Roman "Spin" auf – allen voran die Existenz eines Kollektivs intelligenter Maschinen, das die ganze Erde verändert hat. In diesem Fall manipulieren sie die menschliche Gesellschaft, ohne dass diese davon wüsste, und haben die Zivilisation sanft in eine entschleunigte, friedliche Richtung geführt.
Ein paar Faktoren verhindern, dass man den Roman unter Wilsons beste Werke reihen könnte. Allerdings ist es immer noch ein Wilson und wohnt damit automatisch im Oberhaus der gegenwärtigen Science Fiction. Und ein rundum gelungenes Werk folgt ja schon bald: Etwas später im Jahr wird Heyne nämlich "Netzwerk" herausbringen, die Übersetzung von "The Affinities". Uneingeschränkte Empfehlung.
Bye-bye!
Und ich empfehle mich jetzt auch, Urlaub ist angesagt. Da bin ich notorisch lesefaul, eine neue Rundschau wird es daher frühestens in der zweiten Märzhälfte geben. Unter anderem mit Laird Barron und dem aus Gewichtsgründen wie ein Betonklotz liegengebliebenen Kim Stanley Robinson. Und wem vor lauter Kälte die Haut noch nicht genug juckt, für den gibt's Schwärme angriffslustiger Ameisen. (Josefson, 4. 2. 2017)