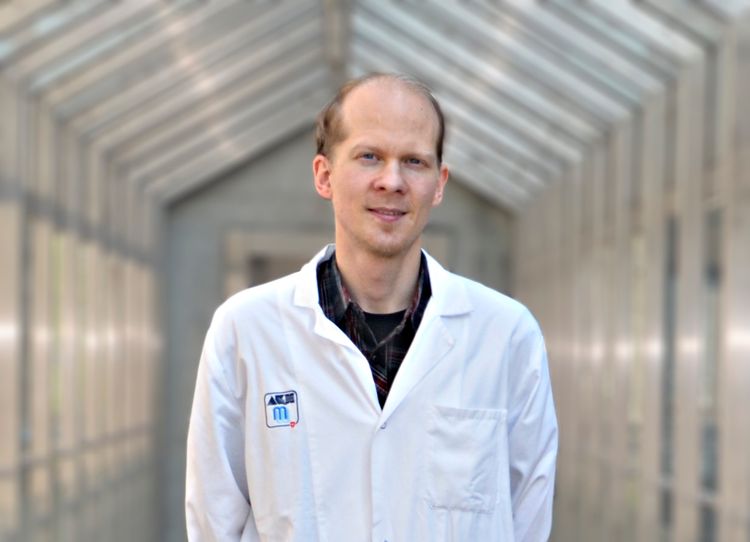STANDARD: Sie beschäftigen sich mit einer sehr seltenen Augenerkrankung. Wie kamen Sie dazu?
Pemp: In den letzten zehn bis 15 Jahren haben wir eine Reihe von Patienten feststellen können, die an der Leberschen Hereditären Optikus-Neuropathie (LHON) erkrankt waren und bis Dezember 2015 gab es keine Behandlungsmöglichkeit. Dann wurde ein Medikament zugelassen, dass zur Therapie dieser Erkrankung dient – das war der Anlass dafür, dass ich mich persönlich damit beschäftigt habe, Patienten zu kontaktieren und das Medikament zu verordnen. Im Folgenden sind dann bei uns klinische Studien zur weiteren Überprüfung der Wirksamkeit der Medikation angelaufen und dadurch wurden auch mehr Patienten von anderen Zentren zu uns überwiesen.
STANDARD: Wie viele Menschen sind in Österreich insgesamt davon betroffen?
Pemp: Es wird in Österreich vielleicht 40 Erkrankte geben, von denen man es weiß. Aber es gibt sicher eine noch größere Anzahl, die nicht diagnostiziert ist. Dazu kommen Leute, die zum Beispiel vor etwa 30-40 Jahren von einem Arzt gesehen und diagnostiziert wurden. Das war aber dann quasi auch der Abschluss für diese Patienten, denn die Versorgung ging früher nicht über Lupen oder später digitale Sehhilfen hinaus.
STANDARD: Können Sie erklären, worum es sich bei der Krankheit handelt?
Pemp: LHON ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Die Ursache ist eine Mutation in den Genen der Mitochondrien, die die Energieproduktion in den Zellen steuern. Liegt diese Veränderung vor, ist der Energiehaushalt in den Zellen im ganzen Körper gestört. Auswirkungen hat das in der Regel aber nur auf Zellen, die sehr viel Energie benötigen, wie die retinalen Ganglienzellen – also jene Nervenzellen, die die Sinnesinformation an das Gehirn weiterleiten. Durch die Störung kann es zu einem Kippen des Energiehaushalts in den Zellen kommen und dadurch zu einem Funktionsverlust.
STANDARD: Wie äußert sich das?
Pemp: Dieser Funktionsverlust bedingt dann entzündliche und degenerative Prozesse in den Zellen, was in kurzer Zeit zu einer fortlaufenden Schädigung führt. Innerhalb von Wochen oder Monaten kommt es zum Absterben vieler Ganglienzellen, die dann nicht mehr funktionieren und dadurch zu einer bleibenden Beeinträchtigung der Sehleistung und des Gesichtsfeldes.
STANDARD: Erkranken alle, die die Mutation tragen?
Pemp: Die Erkrankung tritt vorwiegend bei Männern auf, meist im jungen Erwachsenenalter. Warum das so ist, weiß man eigentlich nicht genau. Vermutet wird eine hormonelle Ursache. Das Risiko als Mutationsträger auch tatsächlich zu erkranken, beträgt bei Männern ungefähr 50, bei Frauen zehn Prozent. Es laufen also einige Menschen mit der Mutation herum, ohne es zu wissen und ohne zu erkranken.
Weitergegeben wird die Mutation nur von der Mutter an ihre Kinder. Daher sind bestimmte Verwandtschaftsverhältnisse ganz typisch für die Erkrankung, beispielsweise Onkel und Neffe oder Mutter und Tochter oder Sohn, aber nie Vater und Sohn.
STANDARD: Welche Symptome treten auf?
Pemp: Das einzige Symptom, das der Patient selbst merkt, ist eine rasche Sehverschlechterung. Meistens zunächst an einem Auge und dann meist innerhalb einiger Wochen auch am anderen. Die Sehschärfe nimmt ab, Farbsehstörungen können auftreten und es kommt zu einem Ausfall des zentralen Gesichtsfeldes, weswegen auch die Orientierung beeinträchtigt sein kann. Es treten weder Schmerzen, noch irgendwelche neurologischen Begleiterscheinungen auf.
STANDARD: Wie entwickelt sich die Krankheit weiter?
Pemp: Nach dieser einmaligen akuten Phase, die mehrere Monate andauern kann, geht die Krankheit in eine chronische Phase über, während der sich das Sehvermögen wiederum leicht verbessern kann. Die Möglichkeit, eine abgelaufene Schädigung wieder zu heilen, gibt es jedoch nicht, da Nervenzellen – wenn sie einmal abgestorben sind – nicht wiederhergestellt werden können. Je mehr Nervenzellen abgestorben sind, desto schlechter ist auch die Sehleistung, das habe ich auch selbst an meinen Patienten gesehen. Viele Patienten bleiben funktionell erblindet.
STANDARD: Sie haben am Anfang erwähnt, dass es inzwischen ein Medikament gibt. Wie wirkt es?
Pemp: Das Medikament, das zur Verfügung steht, heißt Raxone – Idebenon in Tablettenform – und wirkt auf zwei Arten: Einerseits fängt es Sauerstoffradikale ab, die beim Ausfall der Mitochondrien vermehrt anfallen und die Nervenzellen schädigen. Die Therapie sollte also möglichst früh begonnen werden, um einen maximalen Schutz vor dem Absterben der Nervenzellen zu erreichen. Das funktioniert leider nicht bei jedem gleich gut.
Andererseits kann Raxone direkt in den Energiehaushalt der Nervenzellen eingreifen und defekte Strukturen überbrücken. Die Nervenzellen, die noch nicht abgestorben sind, werden dazu angeregt, wieder genügend Energie zu produzieren. Dieser Vorgang scheint die Ursache dafür zu sein, dass auch bei Patienten, die schon lange erkrankt sind, eine Verbesserung der Sehfunktion eintritt. Eine Normalisierung des Sehens ist jedoch dennoch nicht abzusehen. Derzeit gibt es in Österreich noch Abrechnungsschwierigkeiten. Einzelne Krankenkassen bewilligen das Medikament nicht, weil es zu teuer sein dürfte.
STANDARD: Was muss passieren, damit sich das ändert?
Pemp: Wir wollen Awareness für die Erkrankung und die Behandlung schaffen. Ärzte, die einen Patienten mit der entsprechenden Symptomatik sehen, sollten LHON als Diagnose im Hinterkopf haben und wenn sie es nicht selbst abklären können, den Patienten an ein entsprechendes Zentrum weiterleiten. Ich nehme nicht an, dass ein niedergelassener Augenarzt mehr als einen Patienten in seiner Laufbahn sieht. Deshalb ist es eben auch schwierig, die Erkrankung dauerhaft im Gedächtnis zu verankern.
STANDARD: Welche Anlaufstellen gibt es in Österreich?
Pemp: An den drei Universitätskliniken in Wien, Graz und Innsbruck gibt es Neuroophthalmologische Ambulanzen, die sich mit Sehnerverkrankungen beschäftigen und auch die Möglichkeit zur genetischen Analyse haben. Auch in Salzburg gibt es ein Zentrum, das sich mit LHON beschäftigt, aber vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen. Die Erkrankung tritt eben auch bei Minderjährigen auf und liegt damit an der Schnittstelle zwischen Kinderheilkunde, Augenheilkunde und Neurologie. In Wien läuft momentan eine Studie, für die wir noch Teilnehmer suchen – vielleicht finden wir in Österreich noch Patienten. (Winnie Wendelin, 18.4.2017)