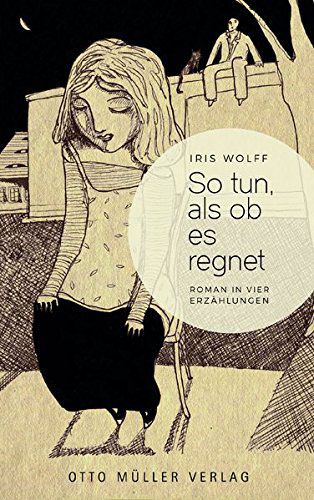Eine Familiengeschichte: Ein orientierungsloser deutscher Student landet als Soldat im Ersten Weltkrieg in den Karpaten und wird bei einer siebenbürgischen Bauernfamilie einquartiert, ein Moment von Idylle im Schrecken ringsum. Später – inzwischen herrscht die Mangelwirtschaft der Zwischenkriegszeit – tauscht die jüngste Tochter dieser Familie mit einer Fremden heimlich Nahrungsmittel gegen einen Ring und lernt so die reizvolle Einsamkeit kennen, die mit Geheimnissen einhergeht.
Im Jahr 1969 muss wiederum ihr Sohn damit fertigwerden, dass seine Mutter ihn und die Heimat verlassen will. Auch unter der Diktatur könne man frei leben, hält er ihr entgegen, meistens jedenfalls; sie fährt trotzdem. Seine Tochter wird es ihr, eine Generation später, gleichtun. Sie lässt ihr Leben hinter sich, oder besser: pausiert es, und lebt inzwischen auf La Gomera vor sich hin. Einzig über ein verschollenes Touristenpärchen muss sie sich hier noch den Kopf zerbrechen, bis sie ein Anruf von zu Hause erreicht.
In vier Momentaufnahmen liefert Iris Wolff einen Familienroman und einen historischen Roman, zugleich private Geschichte und Erzählung des 20. Jahrhunderts. Nun gibt es zwar keinerlei verbindliche Maßstäbe, aber jedes Unterfangen stellt sich doch selbst vor ein paar Probleme, und in Iris Wolffs Fall wären es in etwa die folgenden: Im traditionellen realistischen Erzählen – und darum handelt es sich hier im Großen und Ganzen – ist da vor allem die Schwierigkeit, dass Geschichte ja pausenlos stattfindet, sich aber nicht alle Beteiligten dafür zuständig fühlen (sondern beispielsweise gerade erwachsen werden oder gerade sterben).
Die Nagelprobe in diesem Genre ist dann, diese beiden Seiten, die Geschichte im Großen und die vielen kleinen Geschichten, unter einen Hut zu bringen. Dazu gehören Figuren, die den genau richtig bemessenen Ausschnitt der Welt erleben, ohne dass die erzählerische Absicht dahinter allzu deutlich wird, es braucht plastisch, aber idealerweise wiederum wie nebenbei umrissene Charaktere und natürlich wohldosierte Details, die dem Text die nötige realistische Körnung geben. Um es kurz zu machen: Alles das gelingt Iris Wolff ganz hervorragend.
Wolffs Figuren bewähren sich nicht an irgendwelchen historischen Wendepunkten, sie entsprechen weder dem Helden- noch sonstigen Typen. Über das Stück Geschichte, an dem sie teilhaben, sind sie meist nicht besonders gut informiert, oft nicht einmal wirklich interessiert daran.
Da kann es schon vorkommen, dass jemand wie mit Scheuklappen privatem Freud und Leid nacheilt, während rundum Freunde in den Gefängnissen des Regimes verschwinden, da wird im Kreis der Nachbarn ganz nebenbei der neue Reichskanzler in Deutschland erwähnt und was man sich davon auch im fernen Rumänien erhoffen könne, und gleich darauf redet man wieder über das Wetter.
Die vier Figuren schaffen sich ihre Enklaven im Weltgeschehen und eignen sich paradoxerweise gerade deshalb dazu, vier Momente des 20. Jahrhunderts vignettenhaft abzubilden. Eine Art unkonzentrierter Fatalismus im Ersten Weltkrieg, die unheimliche Sachlichkeit der Zwischenkriegszeit, das vom Terror ausgehöhlte Biedermeier unter Ceausescu und später, im Westen, eine Freiheit, die in Unverbindlichkeit und Einsamkeit umschlägt – alles das zeigen die Geschichten auf, ohne dafür einen Strich an der Individualität der Figuren zu opfern oder ihr persönliches Erleben, das Leben im ländlichen Siebenbürgen zur Nebensache werden zu lassen.
Parallel zur Weltgeschichte läuft die innerfamiliäre Vererbung von Erlebnissen, Redeweisen, auch Versehrungen; in kleinen Gesten finden sich ganze Familienporträts. Vor allem auf ein Erbstück trifft man bei Wolffs Figuren immer wieder, eine für Augenblicke einsetzende, starke ästhetische Empfindungsgabe, die für die schönsten Passagen des Romans verantwortlich ist: Flüchtige Momente werden in der Wahrnehmung der Figuren verlangsamt, stillgestellt, optische und visuelle Eindrücke erstarren zu fast greifbaren Miniaturen – wie die Lichtung beim ersten Schuss ihr Gesicht verändert beispielsweise oder am Strand, wenn die Rhythmen von Meer und Musik plötzlich zugleich innehalten.
Anklänge großer Mythen
Wo geschossen, gestorben, geschmuggelt, verheimlicht wird, ist ein gewisser Level an Melodrama wohl unvermeidlich, auch liest man: "Die Kastanien wussten es immer als Erstes", oder: "Der Tod hatte seine eigene Meinung". Das sind jedoch Nebenbefunde. Bei näherer Betrachtung wird das hochverdichtete Gewebe von Wolffs Erzählungen sichtbar. Zahlreiche Passagen haben irgendwo im Text ihre heimlichen Entsprechungen. Sparsam, aber wirkungsvoll gesetzt sind auch die Anklänge großer Mythen: Die Nibelungen, die Metamorphosen finden im Text ein leises Echo. Wolffs Buch ist im besten Sinne handwerklich geglückt.
Ein wenig sind die Texte dabei wie die vielbesprochenen Flusskiesel: glattgeschliffen, wohlproportioniert, ohne Ecken und Kanten. So könnte auch ein Einwand gegen Wolffs Erzählkunst lauten: dass hier wenig riskiert würde. Dann wiederum nimmt ihr Buch ja das Risiko gerade dieses Vorwurfs bewusst auf sich. (Bernhard Oberreither, Album, 2.8.2017)