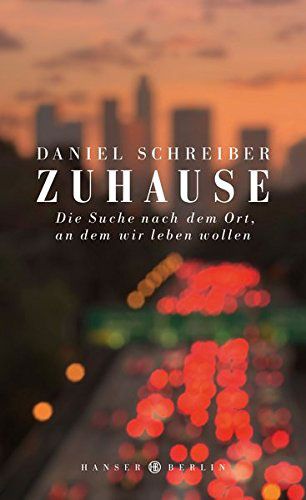
Daniel Schreiber, "Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen". € 18,- / 144 Seiten. Rowohlt, Berlin 2017
Wie wichtig ist es, ein Zuhause zu haben? Gar nicht, behauptete einst der von den Nazis in die USA vertriebene Philosoph Theodor W. Adorno. Denn mit diesem überkommenen Konzept versuche man sich nur über die Katastrophen dieser Welt hinwegzutäuschen. Auch der ungarische Autor und Auschwitz-Überlebende Imre Kertész notierte nur lapidar: "Daheim? Zuhause? Heimatland? – Von all dem wird man vielleicht auch einmal anders sprechen können. Oder wir sprechen überhaupt nicht mehr davon."
Daniel Schreiber, Jahrgang 1977, fühlte sich einer solchen Reaktion auf traumatische Verlusterfahrungen lange Zeit wahlverwandt. In seinem neuen Buch erinnert der Journalist und Susan-Sontag-Biograf eindrücklich, wie er als heranwachsender Homosexueller in der mecklenburgischen Provinz noch den Psychoterror der DDR-Pädagogik durchleiden musste. Nach der Wende habe er sich daher umgehend in die Verheißungen urbaner Freiheit gestürzt, erst in Hamburg, dann in New York und London. Erst Jahre später, nach dem Ende einer Beziehung, sei ihm die "Leerstelle" in seinem Nomadenleben bewusst geworden, so Schreiber.
Schon 2014 machte der Autor in Nüchtern seine Alkoholkrankheit zum Thema eines persönlichen Essays, und ein solcher ist auch sein neues Buch. Zuhause ist eine elegant geschriebene, anregende Meditation über einen schwierigen Begriff in einer für viele Menschen immer unheimlicher werdenden Welt. Und zugleich die Rekonstruktion von Schreibers eigener Suche nach einem Ort, der für ihn so etwas wie Stabilität und Bindung bedeuten könnte. Beides in Auseinandersetzung mit Philosophen, Soziologen oder Psychoanalytikern, aber auch mit den eigenen Vorfahren. Denn wie so viele deutsche Familiengeschichten ist auch die der Schreibers geprägt von Vertreibungen und Neuanfängen.
Heute, in Zeiten von Globalisierung und Flüchtlingskrise, werde Zuhause immer mehr zu einem "imaginären Ort", "gleichermaßen ein realer wie ein innerer, spiritueller oder sozialer Ort". Entsprechend vielfältig sind die Fragen, die sein Essay aufwirft: Kann eine fremde Sprache ein Zuhause bieten? Wie lange dauert es, bis man einen neuen Ort Zuhause nennen kann? Gibt es so etwas wie ein "zuhauseloses Zuhausesein"?
Verklärenden Sehnsüchten erteilt Schreiber eine Absage: Das Zuhause sei kein Paradies, aus dem wir einst vertrieben wurden, weil dieses nie existiert habe. "Sich ein Zuhause zu suchen bedeutet nicht, nach einer besseren Stadt Ausschau zu halten, (...) einem anderen Land. Sich ein Zuhause zu suchen bedeutet, einen Ort in der Welt zu finden, an dem wir ankommen – und dieser Ort wird zuallererst ein innerer Ort sein, ein Ort, den wir uns erarbeiten müssen." Wofür die Lektüre von Schreibers Essay ein guter Anfang wäre. (Oliver Pfohlmann, Album, 14.8.2017)