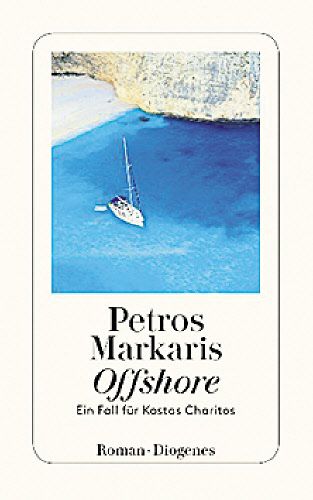STANDARD: Wir sitzen im Café Poems and Crimes, das Sie zum Schauplatz eines Mordes gemacht habe. Ganz schön makaber.
Markaris: Das ist gleichzeitig das Gebäude meines Verlages. Sehen Sie, mein Verleger fand einmal, was ich geschrieben hatte, sei zu kurz. Wir können das Buch nicht verkaufen, rief er. Ich solle mehr schreiben. Also rächte ich mich, indem ich den Mord in den Hinterhof des Cafés verlegte.
STANDARD: Das war für den Erzählband "Der Tod des Odysseus". Haben Sie ihn im Café geschrieben?
Markaris: Nein, so ein moderner Mensch bin ich nicht. Ich schreibe zu Hause, doch nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe, muss ich abends die Wohnung verlassen. Oft komme ich hierher, im Winter habe ich meinen Stammtisch gleich links am Eingang, im Sommer sitze ich auf der Terrasse unter dem Sonnenschirm links auf der Bank.
STANDARD: Da können Sie den Verfall des Gebäudes gegenüber beobachten, nur noch die Außenmauern stehen, von einigen Stahlträgern zusammengehalten. Ein Sinnbild für das ganze Land?
Markaris: Eine Katastrophe, dass sich die Stadt darum nicht kümmert! Das Gebäude gehört ihr, sie hat die Fassade erhalten, weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, das Innere wurde vor Jahren entkernt. Seitdem verfällt das Haus.
STANDARD: Urteilt da der Ausländer, als den Sie sich einmal bezeichnet haben?
Markaris: Nein, nicht mehr. Ich bin ein griechischer Autor, schreibe Romane, die in Athen spielen, wohne mit meiner griechischen Kommissarfamilie zusammen.
STANDARD: Die Bücher um den Polizisten Kostas Charitos sind enorm erfolgreich. Gerade ist der neue Band "Offshore" erschienen. Charitos nennt Athen seine Heimat, Sie jedoch nicht.
Markaris: Ich habe ein Problem mit dem Wort. Wo ist meine Heimat? In Istanbul bin ich aufgewachsen, dort habe ich am österreichischen Gymnasium Matura gemacht.
STANDARD: Weil Ihre Familie nicht türkisch war, musste sie letztlich das Land verlassen.
Markaris: Die Türkei ist wegen des furchtbaren Nationalismus nicht meine Heimat geworden. Griechenland ist meine sprachliche Heimat, ansonsten habe ich nichts miterlebt, was das Land ausmacht. Nicht die deutsche Besatzungszeit, nicht den Bürgerkrieg. Ich kann mich nicht hinsetzen und behaupten, ich sei ein Grieche wie die anderen. Mir fehlen bestimmte kollektive Erfahrungen.
STANDARD: Warum haben Sie sich dann für Athen entschieden?
Markaris: Erstens bin ich ein Stadtmensch. Der zweite Grund war meine Einsamkeit. Lassen Sie mich ausholen: Ich bin auf einer der Prinzeninseln im Marmarameer aufgewachsen, auf Chalki. Meinen Vater hat die berüchtigte Vermögenssteuer 1942 total ruiniert. Wir mussten unsere Mietwohnung in Istanbul verlassen und zogen in unser Sommerhaus auf die Insel. Das war keine leichte Zeit. Im Juli und August kamen die Familien in die Sommerfrische, ich hatte viele Freunde, doch ab September waren alle verschwunden. Ich war allein mit meinem Fahrrad. In Istanbul ging ich aufs Gymnasium, musste jeden Morgen eineinhalb Stunden mit dem Schiff in die Stadt fahren und nachmittags zurück. Es war schlimm, wenn Schulfreunde am Freitag Pläne schmiedeten, in welches Kino sie gehen würden – und ich wusste, ich muss auf meine Insel zurück.
STANDARD: Nach der Matura begannen Sie ein Wirtschaftsstudium in Wien.
Markaris: Damals gab es dort nicht so viele ausländische Studenten wie heute. Ich kannte Istanbul, wo bis Mitternacht Leute auf der Straße waren. In Wien hörte das Leben um sieben Uhr auf. Die Stadt hatte nur ein Nachmittagsleben. Heute, höre ich, gibt es sogar eines in der Nacht. Ohne Familie und Freunde fühlte ich mich einsam. Ich verbrachte viel Zeit allein in meinem Zimmer. Obwohl mein Deutsch damals besser als mein Griechisch war, beschloss ich, nach Athen zu gehen und in meiner Muttersprache zu arbeiten.
STANDARD: Hat die Einsamkeit in Athen nachgelassen?
Markaris: Ja. Eines kann man in Athen sehr leicht Freunde finden.
STANDARD: Wie geht das?
Markaris: Man sitzt im Café, am Nebentisch trinkt ein Fremder Kaffee, man kommt ins Plaudern, am Ende geht man zusammen ins Restaurant.
STANDARD: Kommt daher Ihr Ausspruch "Nachts liebe ich die Stadt"?
Markaris: Ich war immer ein Spaziergänger. Monatelang habe ich die Stadt zu Fuß erkundet, tagsüber wie nachts. In der Nacht wurde Athen schöner, menschlicher. Dieser viele verbaute Beton, die Dunkelheit verschluckte ihn. Ich machte es mir zur Routine, alle sechs Jahre umzuziehen, wollte die Stadt immer wieder neu entdecken. Jetzt wohne ich seit mehr als zehn Jahren an einer Fußgängerzone in Kypseli, in einer Mietwohnung. Für meine Tochter habe ich eine Wohnung gekauft, ich brauche keine.
STANDARD: Nicht sehr griechisch. Griechen wollen Immobilien.
Markaris: Ich bin ja kein typischer Grieche, ich bin ein Gemisch von einem armenischen Vater und einer Istanbuler Griechin und am Ende ein griechischer Schriftsteller mit einer deutschsprachigen Kultur.
STANDARD: Wozu macht Sie das?
Markaris: Zu einem Bastard.
STANDARD: Dem die Gerüche eines Ortes immer wichtig waren, wie Sie einmal sagten.
Markaris: Als ich Wien verlassen habe, um nach Athen zu ziehen, hatte ich die Hoffnung, ich würde dieselben Gerüche wie in Istanbul finden, diesen Duft orientalischer Gewürze. Das habe ich nur in der Altstadt gefunden, auf dem Fisch- und Fleischmarkt. Aber ansonsten gab es nur Abgase in der Stadt.
STANDARD: Waren Sie enttäuscht?
Markaris: Nein. Man muss jede Stadt für sich entdecken. Was ich in Athen interessant fand, waren die Widersprüche. Istanbul war früher eine multiethnische Stadt, Wien war in den 1960er-Jahren keine multiethnische Stadt, abgesehen von einigen Ungarn und Tschechen, jedenfalls eine total westliche Stadt. Athen war keines von beidem, sondern ein Gemisch aus altertümlich und modern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Athen haben wir zwei berühmte Hügel: die Akropolis und den Lykabettus. So monumental die Akropolis aussieht, so bescheiden ist die Sankt-Georg-Kapelle.
STANDARD: Weil die Moderne ...
Markaris: ... im Schatten der Antike stand. Die Antike war in der Altstadt präsent, aber sie musste mit einer bescheidenen Gegenwart zusammenleben. Als Ausländer habe ich mir die Frage gestellt, wieso die modernen Griechen nicht schätzen wollen, dass sie zusammen mit der Antike leben.
STANDARD: Haben Sie die Antwort?
Markaris: Weil Griechenland 450 Jahre Osmanisches Reich mehr geprägt haben als die Antike.
STANDARD: Glauben Sie, das gilt noch heute?
Markaris: Seit der Krise müssen die Leute hin- und herpendeln, zwischen Europa, wo sie hingehören, und dem Osmanisches Reich und der Antike, wo sie geschichtlich standen. Das ist die Schwierigkeit, sie finden keinen klaren Weg. Es gibt einen starken Nationalismus – wie überall auf dem Balkan -, aber keine Identität. Man verwechselt beides miteinander, das ist ein großes Problem.
STANDARD: Was hat sich in den vergangenen 50 Jahren in Griechenland noch verändert?
Markaris: In den 1960er-Jahren waren die Griechen ärmer als heute. Bettelarme Menschen, die einen Weg gefunden hatten, anständig zu leben und nach vorn zu schauen. Es waren schlechte Bedingungen, doch jeder sagte: Morgen wird es besser gehen. Heute leben die Griechen mit der Sehnsucht nach der Zeit vor der Krise: Wann bekommen wir noch einen Jeep? Wann bauen wir ein Sommerhaus? Ich sage immer: Das ist vorbei.
STANDARD: Sie halten Armut für das bessere Übel?
Markaris: Nein, aber damals war Griechenland arm, die Menschen hatten trotzdem ein kulturelles Niveau. Mit dem Reichtum später konnten sie nicht umgehen.
STANDARD: Was meinen Sie damit?
Markaris: Schon seit der Renaissance hat das europäische Bürgertum in Kultur investiert. Denken Sie an Mäzene. So etwas gab es in Griechenland nie. Dass man sein Geld nicht nur ausgibt, sondern etwas für die Gemeinschaft tut. Als die Griechen den Zuschlag für die Olympiade 2004 bekommen haben, sagte ich: Das wird schlecht enden, das Land ist überfordert, alles wird auf Pump gebaut, die Griechen arbeiten auf ihren Ruin zu! Kurz vor den Spielen kam jemand vom Nationalen Olympischen Komitee aus Deutschland zu mir. Er wusste, dass ich dagegen war. Er sagte, er habe alle olympischen Stätten besucht, ich hätte recht, es gebe aber noch ein Problem. Was denn noch, fragte ich. Die Griechen bauen so groß, sagte er, dass es in der Zukunft nicht benutzbar sein wird. Er hatte recht. Seit den Spielen verrosten die Sportkomplexe.
STANDARD: Sie haben einmal gesagt: Athen ist eine Stadt, in der sich viel bewegt, aber nichts passiert.
Markaris: Das hat sich negativ verändert. Verbrechen haben zugenommen. In den Straßen linker Hand, wo kriminelle Migranten wohnen, haben die Griechen ein schwieriges Leben. Nigerianer, Somalis, Afghanen, die machen alles Mögliche. Bei mir im Viertel sind die Schwarzen anständig. Vor ein paar Jahren gab es im Sommer eine Hitzewelle ohnegleichen. Nachts war es so heiß, dass ich nicht schlafen konnte. Auf einmal gab es unten in der Fußgängerzone Krach. Ich stehe auf, laufe in Unterhose auf den Balkon und rufe: Leute, um Gottes willen, es ist drei Uhr morgens und höllenheiß, warum habt ihr Lust zu streiten? Plötzlich ist es still, ich sehe ein schwarzes Gesicht, zwei glänzende Augen, die zu mir hinaufschauen und ganz höflich bitten: Excusez-moi, Monsieur. In solchen Momenten liebe ich Athen. (Ulf Lippitz, 9.9.2017)