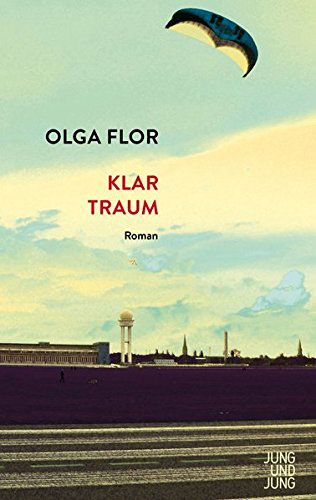
Olga Flor, "Klartraum". € 23 / 282 Seiten. Jung und Jung, Salzburg 2017.
Man liebt, wird verlassen und leidet. Eines der großen, ewigen Themen – und damit, könnte man zynischerweise ergänzen, ein Plot, so gut durchgekaut und wohlbekannt wie kaum ein anderer.
Literatur nimmt es immer wieder mit solchem Zynismus auf. Olga Flor hat den Roman einer Verlassenen geschrieben, unverwechselbar, präzise, auf der Höhe der Zeit. Ihr Unterfangen ist riskant, fast monomanisch – ein Roman, der sich ausschließlich der seelischen Verarbeitung einer Trennung widmet. Das äußere Geschehen bleibt dabei minimal, das Buch findet im Kopf, in den Aufzeichnungen und der Korrespondenz der Heldin statt.
Diese kreist gedanklich um den Moment der Trennung, analysiert von dort aus die zerbrochene Beziehung, durchlebt sie erneut, führt inzwischen reale und imaginäre Streitgespräche, sitzt mit ihrem Verflossenen und sich selbst zu Gericht, lotst ihre Tagesverfassung aus und misst den Fortschritt ihrer Heilung, sondiert akribisch jeden Moment der gemeinsamen Zeit. Ihr Vorteil ist ein scharfer Verstand und ein starker Selbstbehauptungs- und Überlebenswille (sie ist das Gegenteil aller Emma Bovarys des Genres); ihr Nachteil: Das Gegenüber, der ehemals "Allergeliebteste", bleibt meist stumm, weicht aus, gibt nichts preis.
Namen gibt es keine; stattdessen Initialen, P und A, für die der Roman mehrere Auflösungen bietet: Passiv/Aktiv, Protagonistin/Antagonist, Pünktchen und Anton. Zwischen ihr und ihm steht die Tatsache, dass sie beide anderweitig verheiratet sind und Kinder haben; sie sind nüchtern genug, aus ihrer Affäre nie mehr machen zu wollen als eben das. Außerdem gibt es da ein krasses Prestige- und Einkommensgefälle. Sie ist eine von Projektförderungen (und das heißt auch: vom Ehemann) abhängige Akademikerin, er ein sogenanntes ‚großes Tier‘ in der Finanzwelt, und diese Diskrepanz lässt auch ihr Liebesleben nicht unberührt.
Durchkapitalisierung unserer Gegenwart
Denn Flor schreibt ihren Roman über das vermeintlich Private dicht entlang der politischen und ökonomischen Wirklichkeit. Die Sphären sind nicht zu trennen, die dominierende Sprache ist auch im Liebesleben die der Ökonomie und der Krise: ‚Projektmanagerin‘ und ‚Abwickler‘, auch so werden die Initialen der beiden Hauptfiguren einmal aufgelöst. Er und seinesgleichen betreiben die Durchkapitalisierung unserer Gegenwart (eine Vereinfachung, der sich die Protagonistin wohl bewusst ist), und wir alle müssen nun in einer Welt leben, in der noch das Intimste durch den Jargon der Rentabilität gefiltert wird.
Die Metaphorik in Flors Roman ist also eine vorwiegend ökonomische; die Gespreiztheit und die Pseudoobjektivität dieses Registers werden von der Heldin mit masochistischem Vergnügen übernommen und schmerzhaft passgenau aufs Liebesleben angewendet. Schon der "Lustgewinn" hatte früher wohl einen anderen Klang, und der Wille zur Selbstreflexion klingt nun wie ein firmeninternes Memo: "Befrage dich selbst!, fordert die innere Kontrollinstanz, die integrierte Abteilung für dynamische Qualitätssicherung." Verrechenbarkeit ist überall – um das zu demonstrieren (und zu unterlaufen) werden die Kapitel des Romans in eine leicht absurde (aber eben nur leicht absurde) thematische Sortierung gebracht und durchnummeriert. "Verlust 1 – 13" steht etwa "Glück 1 – 15" gegenüber, anstelle eines Schlusses steht in diesem Roman konsequenterweise ein Mengenverhältnis.
Das ist die eine Seite. Denn Flor lässt ihre Heldin gegen diesen ernüchternden Befund anrennen. Entgegen dem Objektivitäts- und Rationalisierungsgebot der Stunde betreibt diese stur die Wiedereroberung des Irrationalen, des Unermesslichen, des Sinnlichen. Ihre Verausgabung in der Liebe steht im direkten Widerspruch zum Bonitätsdenken des Zeitgeists; der verliebte Körper, das verliebte Gehirn widerspricht jeder Ratio (und, nebenbei, auch der einen oder anderen feministischen Überzeugung).
Analytisch präzise und hochpoetisch
Die Nominierung für den österreichischen Buchpreis ist mehr als gerechtfertigt; Flors Text ist analytisch präzise und zugleich hochpoetisch. Er geht der Möglichkeit der Liebe in einer durchökonomisierten Welt nach, und zieht dabei die offene Frage sichtlich jeder begütigenden Phantasie vor.
Der Anspruch dieses Buchs ist, kein Vehikel der Weltflucht, sondern ein Instrument der literarischen Gegenwartsanalyse zu sein. Für die Lektüre heißt das, ganz programmatisch: Genuss entspringt hier aus metaphorischer Treffsicherheit und gewitzten Analogien, Absatz für Absatz, nicht etwa aus einem durch die üblichen Kurven gejagten Handlungsverlauf, gar einer sentimentalen Wunscherfüllung. Eine Folge davon ist wohl, dass sich im Text kein nennenswerter Sog nach vorne ergibt. Mit der Kategorie ‚Plot‘, so lässt sich das verstehen, wird man der Komplexität der Wirklichkeit nicht gerecht.
Diese Positionsbehauptung findet sich übrigens auch im Roman selbst: Zwischendurch taucht eine zweite Protagonistin auf, Paketbotin von Beruf, die gutgelaunt und im Einklang mit dem Effizienzdenken der Zeit auf ihr unkritisches, angepasstes Happy End zusteuert. Sie ist eine polemische Gegenfigur zur Heldin und zu diesem Zweck recht grob gezeichnet. Man kann durchaus fragen, wie das zum sonst so skrupulösen Ton des Texts passt. Ihrer Feder jedenfalls entspringt nun ein zweites, ein Buch im Buch: eine im Slang des Zeitgeists gepitchte Fantasy-Schnulze, die hinterrücks alle gegenwärtigen Ressentiments von Antimodernismus bis Antiislamismus bedient, algorithmisch auf ein Massenpublikum zugeschnitten; und dieses Genre-Bashing wiederum ist sehr komisch, ätzend und anspielungsreich, nicht zuletzt sprachlich furios. (Bernhard Oberreither, 7.11.2017)