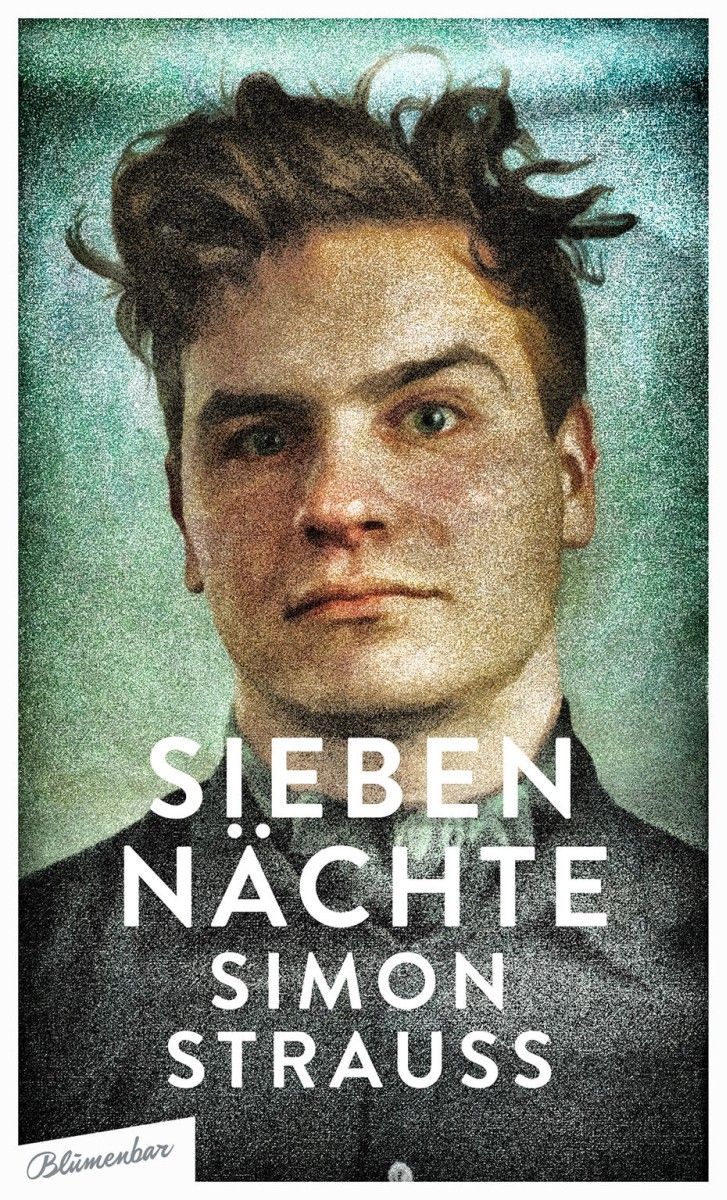Berlin, Friedrichstraße. Grau ist dieser Samstagmorgen, als Simon Strauß das hellerleuchtete Café betritt. Der Debütroman Sieben Nächte des jungen Theaterkritikers hat in den vergangenen Wochen hohe Welle geschlagen. Er ist gutgelaunt, er sprudelt vor Ideen und Gedanken. Schon sind wir mitten im Gespräch.
STANDARD: In Rezensionen wird vermutet, Sie hätten ein Buch über Ihre Generation geschrieben. Ist dem so?
Strauß: Ja und nein. Eigentlich habe ich ein radikal persönliches Buch geschrieben, in dem es um eine gewisse Energielosigkeit und Revolutionsmüdigkeit geht, die ich empfinde, eine Angst davor, Dinge nicht anzupacken, nichts verändern zu wollen – aber das hat offensichtlich etwas mit meiner "Generation" zu tun, die zum Großteil im gemachten Bett des Wohlstands aufgewachsen ist. Positiv kann man sagen, dass es eine Generation ist, die sich nicht mehr ideologisch verbohrt an politischen und moralischen Maßstäben abarbeitet, sondern an ihren eigenen psychologischen Haltungen feilt. Meine Generation zeichnet sich durch ein stark selbstkritisches Reflexionsvermögen aus. Das bedeutet aber auch, dass sie sehr individualistisch ist. Die Zeit, in der man eine Generation mit Slogans wie "Generation Golf" oder "Generation Anpassung" bezeichnen konnte, ist vorbei. Für solche Schablonen ist meine Generation zu vielseitig.
STANDARD: Sie selbst reiben sich an der Generation, die zu Beginn der 1970er-Jahre in Westdeutschland geboren wurde, und nicht so sehr an den sogenannten 68ern, richtig?
Strauß: Genau. Meine Gegner sind die coolen Ironiker, nicht die emphatischen Ideologen. Ich lehne mich auf gegen eine Generation, die sich aus der Erfahrung der Wendezeit und des Zusammenbruchs des Kommunismus, dem Aus der ideologischen Träume sozusagen, ganz dem Zynismus verschrieben hat. Die jede Hoffnung auf eine bessere, schönere Welt als naiv verachtet und alle Ansätze gesellschaftspolitischer oder ästhetischer Utopien mit beißender Ironie behandelt. Wir Jungen lassen uns davon viel zu leicht anstecken, sodass auch wir eben vieles schulterzuckend hinnehmen, anstatt uns offen mit dieser Generation, zu der etwa Leute wie der Kolumnist Maxim Biller oder der Theaterregisseur Nicolas Stemann gehören, anzulegen.
STANDARD: Wo sehen Sie Möglichkeiten des Widerstands?
Strauß: Bei vielen meiner Altersgenossen gibt es, glaube ich, wieder eine Sehnsucht nach Ernsthaftigkeit und Verantwortung, nach Gefühl, nach einer Weltsicht, die sich von der "Alles-egal-Haltung" abwendet. Gerade in der Literatur, in der Essayistik, dem Theater, aber auch in der politischen Gemeinschaftsbildung und Unternehmenskultur schimmert diese Sehnsucht immer stärker durch.
STANDARD: Sie brechen mit der Ironie der Vorgängergeneration?
Strauß: Ich will Mut machen für eine Weltsicht, in der das Gefühl wichtiger ist als die zynische Ironie. Außerdem will ich die Frage aufwerfen, wie wir wieder zu einer Gemeinschaft werden, nach der wir uns in unserem Hyperindividualismus insgeheim sehnen. Dieser Kollektivgedanke ist mir wichtig, aber er ist auch ein aktuelles Thema unserer Zeit: Die rein rationalistische, auf Effizienz getrimmte Weltsicht, die für unsere westlichen Gesellschaften so bestimmend geworden ist, fordert ein Gegenmodell doch geradezu heraus. Das drückt sich in der romantischen Attitüde des Buches aus: Ein Plädoyer für das Wunderbare, das Geheimnisvolle, darum geht es mir auch. Als Theaterkritiker sehe ich in immer mehr Inszenierungen, dass man langsam wegkommt von der Idee, alles superauthentisch, realistisch darstellen zu wollen, und dass Elemente des Dada und des Surrealen wieder eine Rolle spielen. Auch in der Literatur, etwa bei neuen Gruppen wie den Rich Kids Of Literature oder dem Europäischen Salon, schimmert die Sehnsucht nach Gefühl und Neoromantik durch. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir merken: Mehr Realität, mehr Gegenwart geht eigentlich nicht.
STANDARD: Die Todsünden, denen sich der Protagonist des Buches aussetzt, wirken zahm. Wollten Sie Ihren Helden nicht in etwas härtere Mutproben schicken, damit er seine lähmende Lebensangst überwinden kann?
Strauß: Mir ging es nicht darum, besonders krasse, moderne Äquivalente zu den alten Todsünden zu finden, sondern den autofiktionalen Protagonisten S dazu zu bringen, radikal ehrlich zu sein – und zu schreiben. Die sieben Sündenerfahrungen fungierten gewissermaßen als Schlüssel, um sein Inneres aufzuschließen. Er ist eine Figur, die damit kämpft, schwach zu sein, die es ja gerade nicht schafft, das, was sie einfordert, umzusetzen- also keine Angst zu haben, nicht bequem zu sein, sondern zu kämpfen und sich dem Drang und der Gefahr auszusetzen. Die gewisse Softheit der Sünden sollten auch etwas über das Lebensgefühl dieser Figur aussagen. Man hat diese Sehnsucht nach Ausbruch und Exzess, aber letzten Endes bleibt man doch in der eigenen mittelständischen und bildungsbürgerlichen Komfortzone.
STANDARD: Es gäbe für Ihre Generation sicher genug zu tun. Die liberale Demokratie steht europaweit unter Beschuss. Wie sehen Sie die Rolle Ihrer Altersgenossen?
Strauß: Ich bin noch nicht ganz 30, eben von der Uni weg, habe meine erste Arbeitsstelle eingenommen und frage mich, wofür man eigentlich – jenseits des Privaten – Verantwortung übernehmen will. Worin meine Pflicht als – im Marx'schen Sinne – "historisches Subjekt" liegt. Die linksliberale Geisteshaltung, die in den vergangenen Jahrzehnten dominierend war, hat eigentlich alles erreicht, wozu sie angetreten war. Der symbolische Höhepunkt dieses Erfolgs ist vielleicht die "Ehe für alle", die in Deutschland von einer konservativen Kanzlerin durchgesetzt wurde. Wir, die wir mit dem Glauben aufgewachsen sind, dass eine Liberalisierung in allen Bereichen per se gut zu finden ist, sind von der moralisch-politischen Korrektheit und Fortschrittlichkeit unserer Elterngeneration dermaßen eingeschüchtert, dass wir am besten gar nichts sagen. Dabei könnte man gerade mit Rekurs auf die "Klasse" durchaus etwas gegen die momentane Fixierung auf "Identität" und "Geschlecht" einwenden.
STANDARD: Ist es nicht gefährlich, über das Gefühl wieder zu einer neuen Idee der Gemeinschaft zu kommen?
Strauß: Ich finde die Hyperindividualisierung viel gefährlicher. Viele sehnen sich nach einer neuen Form der Ansprache, nach Zusammenhalt, auch nach Vertrauen und Empathie. Die Rechtspopulisten nutzen diese Leerstelle aus und bündeln ihre Anhänger durch die Schaffung von Feindbildern. Ich glaube, dass man dem Schlachtruf des "Identitären", der ja von überallher, nicht nur von rechts, erschallt, offensiv begegnen muss. Wer die Frage nach der Identität stellt, nur über sein Geschlecht oder seinen Wohnblock nachdenkt, spricht nur über das Eigene. Dabei gerät der Blick für das Gesamte aus dem Blick und die Frage, wie wir als Gemeinschaft mit all unseren individualistischen Hintergründen zueinanderfinden können.
STANDARD: Was ist Ihre Idee?
Strauß: Unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen könnten über den allzu leichtfertig diffamierten Begriff der Tradition zusammenfinden. Denn offensichtlich sind Themen wie Glaube, Familie, Herkunft ja wieder gefragt – und zwar nicht nur bei denen, die sich selbst "konservativ" nennen, sondern beispielsweise auch bei jenen, die oft in Opposition zu ihnen gedacht werden: den vielen geflüchteten Menschen. Für sie, die sich ja in der Tat als "historische Subjekte" behaupten müssen, sind solche Fragen offenkundig ganz zentral. Michel Houellebecq hat die Verbindung zwischen europäischen Konservativen und muslimischen Einwanderern in seinem Roman Unterwerfung als Bedrohungsszenarium skizziert. Aber warum kann man das nicht auch konstruktiv aufgreifen? Junge Leute, für die das klassische Rechts-links-Schema ohnehin keine große Rolle mehr spielt, müssten politisch in der Lage sein, das Erfahrungspotenzial derjenigen, die zu uns kommen, für ein Modell zu nutzen, in dem es um Tradition, Familie, auch Herkunftsstolz geht – aber eben in einem integrativen und progressiven Sinn. Dazu gehört, dass man sich endlich damit beschäftigt, Wohnraum und Städte so zu gestalten, dass Zusammenkommen möglich ist und nicht das soziale und emotionale Auseinanderdriften gefördert wird.
STANDARD: Das klingt optimistisch.
Strauß: Wir sind mit einigen Dingen an einem Ende angekommen: mit dem Rechts-links-Schema, mit dem Primat der Ökonomie über die Politik, mit der allumfassenden Liberalisierung. Wir müssen uns mit denjenigen auseinandersetzen, für die Liberalität eben keine Verheißung war und ist. Hier müssen wir von dem rein intellektuell-rationalistischen Weltbild wegkommen, das ja sehr elitär und überheblich sein kann. Nichts gegen die Glanzleistungen der Vernunft, aber das Experten- und Lobbyistentum allein reicht eben nicht, um Menschen zu berühren und zu binden. Wir müssen uns wieder trauen, die Stimme zu heben und von einer anderen Welt zu träumen. (Ingo Petz, Album, 9.12.2017)