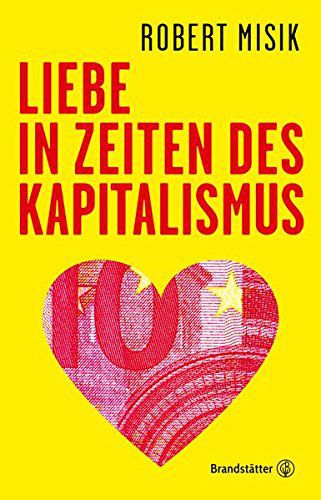Liebe scheint uns als das nachgerade Gegenteil des Kapitalismus. Es ist wohl jedenfalls keine allzu gewagte Unterstellung, wenn man behauptet, dass die allermeisten Menschen in Zusammenhang mit der romantischen Liebe von sich sagen würden, dass sie da keineswegs nüchterner Kosten-Nutzen-Rechnung oder kühler Nutzenmaximierung folgen, auch nicht der banalen Logik von Sensation und Attraktion wie etwa in der Konsumwelt, sondern dass es bei der Liebe nun einmal um das Echte, das Tiefe ginge, um das wahre Interesse, nicht nur um das oberflächliche Begehren. Deswegen hält sie etwa auch der Philosoph Alain Badiou für das anti-kapitalistische Gefühl schlechthin, da es für uns in der Liebe nie um den kühl kalkulierten Nutzen geht, sondern um das Echte, um Passion statt Rationalität.
Es ist aber ebenso wahrscheinlich keine allzu gewagte Unterstellung, wenn man behauptet, dass an sehr vielen Menschen der Verdacht nagt, ob das denn wirklich so sei, denn schließlich seien wir doch alle, das haben wir gelernt, Produkte der Zeit, unserer Kultur, unserer Umwelt, von Mama und Papa neurotisiert, von den Medien ummontiert, von Pornos und Tinder versaut, sodass noch dem, der sich am Echtesten dünkt, die Ahnung anpirscht, er oder sie könnte vielleicht doch auch in diesem privatesten, intimsten Revier der Liebe weniger Herr seiner oder Frau ihrer Selbst sein, als man hoffen würde.
Möglicherweise kommt alles noch dicker, wenn man beginnt, die Dinge ein wenig durchzudenken. Gefühle, Romantik und unsere Vorstellungen von Liebe, die Bilder, die wir im Kopf haben, sind von der Warenästhetik, der Konsumwelt und den damit verbundenen medialen Apparaturen nur schwer zu trennen. Diese verstörende Tatsache hat uns die israelische Soziologin Eva Illouz in einigen spektakulären Büchern enthüllt. "Der Konsum der Romantik. Liebe und die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus", heißt eines davon. "Gefühle in Zeiten des Kapitalismus", ein anderes. "Warum Liebe weh tut", ein drittes. "Der Kapitalismus ist unerbittlich in die privatesten Nischen unseres zwischenmenschlichen und emotionalen Lebens eingedrungen", schreibt sie. Das gilt schon für die unverfänglichsten Bilder, die vor unserem Kopf ablaufen, wenn wir uns eine romantische Situation vorstellen.
Nehmen wir an, Sie haben von sich das Selbstbild, ein "romantischer Typ" zu sein. Das heißt, sie mögen Candle-Light-Dinners, oder Sie schenken, wenn Sie ein Mann sind, ihrer Freundin gern eine rote Rose oder Sie träumen davon, mit ihrem Lover nach Venedig zu fahren. Oder nach Paris. Oder von einer gemeinsamen zärtlichen halben Stunde in der Badewanne mit Schimmerlicht und Rosenblättern am Wannenrand. Was auch immer. Aber woher wissen Sie eigentlich, dass Candle-Light-Dinners, Rosen und Venedig Träger des Attributs Romantik sind? Kommt diese Idee aus Ihrem Inneren? Oder kommt sie aus den Filmen, die Sie gesehen haben, haben Sie das irgendwo gelesen, oder schöne Fotos davon in Hochglanzmagazinen gesehen? Fotos, ohne die Sie nicht einmal wüssten, dass es so etwas wie Romantik gibt. Erschreckend, oder? Andererseits: Das romantische Abendessen kann trotzdem schön sein, auch wenn sie nicht einmal wüssten, dass es Candle-Light-Dinners gibt und diese Romantik repräsentieren, hätte die Kulturindustrie es Ihnen nicht eingeredet. Wir tun alle dauernd Dinge, die wir uns nicht selbst ausgedacht haben, wir folgen bis in die kleinste Alltagsgeste hinein kulturellen Skripts. Trotzdem trübt das doch keineswegs unsere Freude am Leben.
Diese Vorstellungen von romantischer Liebe, die durch kulturindustriell produzierte Bilder geformt sind, verbinden die Liebe mit Schönheit, Jugend, Charme, Glanz und verführerischer Kraft. Die Werbung arbeitet damit und "assoziiert Liebesromantik ... systematisch mit den Motiven Jugend und Schönheit, Kreativität und Spontanität", so Illouz. Liebe und Romantik sind also eng mit einer Ästhetik verbunden, die aus der Konsumkultur stammt. Oder auch mit Intensität, eine Intensität, die sich im aufregendsten Leben schwer im Alltag durchhalten lässt, nicht einmal beim zugekokstesten Rockstar. Das etabliert wiederum eine Fallhöhe zwischen kulturell modellierten Ansprüchen und der Wirklichkeit, die stets ein wenig grauer ist, die Quelle leiserer oder stärkerer Unzufriedenheit sein kann. Damit nicht genug, wird natürlich eine bestimmte Form der Romantik zu einem Rollenmodell: Fast immer die der weißen Upper- und Mittelklasse des Westens. Diejenigen, die dieser Kultur angehören, erkennen sich in diesen Phantasiebildern wieder, aber auch alle anderen wachsen in dieser Bilderwelt auf, ohne in ihr repräsentiert zu sein. Natürlich gibt es auch andere Bildsprachen (etwa die der Bollywood-Filme in Indien), aber die dominante Bildsprache des globalen Kulturkapitalismus ist schon die der weißen Upperclass des Westens.
Sex sells – das ist eine Wahrheit, die längst so banal ist, dass man sie kaum auszusprechen wagt. Willst du ein Auto verkaufen, pappe eine halbnackte Frau auf den Katalog. Aber das sind nur die Oberflächenphänomene. Im Kulturkapitalismus gehen zeitgenössische ökonomische Muster und jahrtausendealtes Patriarchat die verwirrendsten Bündnisse ein. Mädchen bekommen von früh an eingeimpft, dass ihr sozialer Status mit ihrer sexuellen Attraktivität zusammenhängt. "Der Spätkapitalismus brandet ziemlich buchstäblich die Körper von Frauen", schreibt Laurie Penny, die junge britische Pop-Feministin in ihrem Buch "Fleischmarkt". "Feminität selbst wurde zu so einer Marke, eine enge Formel von Warenidentität." Feminität kann man kaufen, mit Hilfe der Waren und sonstiger Dienstleistungen, die der unendliche Markt bietet, von der Kosmetikindustrie angefangen. Rollenbildern ist nachzueifern, bei Strafe des Untergangs im Wettbewerb.
Geschlechterrollen, die älter als der Kapitalismus sind, werden gleichsam neu durchkodiert und kapitalistisch eingefärbt. Wenn soziale Beziehungen generell mit dem Ungeist der Konkurrenz vergiftet werden, bleiben auch die Geschlechterrollen davon nicht unberührt. Macht und Prestige haben immer noch in der Mehrzahl Männer, und daher gibt es kaum irgendwelchen gesellschaftlichen Verkehr, der nicht von diesem Umstand mitgeprägt ist, genauso wie die Selbstwahrnehmung von Männern und Frauen. Frauen müssen dafür kämpfen, gehört zu werden, Männer gehen oft wie selbstverständlich davon aus, dass ihnen Aufmerksamkeit zusteht. Das beste Beispiel sind die Heerscharen völlig uninteressanter Manager, die, als Folge aufgeblasenen Egos, gleich glauben, jeder müsse sich für ihre Meinungen zur modernen Kunst und zur Quantenphysik interessieren. Dieser weitverbreitete Charakter wird in Fachkreisen "SABTA"-Typ genannt: sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit.
Die Männerklüngel bilden ihre eigene Kultur, Mädchen und Frauen machen die Erfahrung, dass sie eher wahrgenommen werden, wenn sie den Bildern femininer Attraktivität entsprechen und nach den Regeln des Spiels spielen. "Sexuelle Performance" als ein wesentliches Element des Arbeitslebens, nennt das Laurie Penny, stets begleitet vom Versuch der Selbstperfektionierung. Und natürlich gibt es dagegen Rebellionen, und erst recht gegen die ärgsten Auswirkungen, wie zuletzt bei der #metoo-Bewegung, aber sie sind doch im Augenblick noch Auflehnungen gegen ein dominantes Setting – und nicht die Aufhebung dieses Settings.
Aber auch dieses Konzept "sexueller Performance" ist selbst schon von den Mustern der Konsumkultur infiziert. Denn mit der Moderne kommt nicht nur die "Wahl" ins Beziehungsleben – also die Idee, dass eigentlich jeder und jede eine denkbare Partnerin, ein denkbarer Partner ist -, es kommt sehr bald auch noch etwas anderes hinzu: nämlich eine hedonistische Ethik des Konsums, des Vergnügens. Der Kapitalismus brauchte nicht nur emsige Arbeitsameisen, sondern schnell auch Konsumenten, die sich so manchen Spaß erlauben, denn die kaufen die angepriesenen Güter eher als geizige Sparefrohs. Diese neue Ethik des Spätkapitalismus ermunterte nicht nur den Erwerb von Konsumartikeln, sondern begünstigte ganz generell "auch eine wachsende Akzeptanz von Vergnügen, Wunscherfüllung und persönlicher Zufriedenheit, eine Perspektive, die sich leicht auf den Bereich des Sexuellen übertragen lässt", so Eva Illouz, und: Es wird "die Auffassung befördert, Begierden seien ein legitimer Grund für Entscheidungen." So ist das Begehren im Feld des Sexuellen immer schon auch infiziert von den Mustern der Konsumkultur, und umgekehrt auch ist die "sexuelle Performance", die zu einer eigenen Art von Leistung wird, nicht ohne Auswirkung auf Status und Prestige und somit auch auf die Rollen, die wir im Berufsleben spielen. Sexuelle Attraktivität ist heute ein diffuses Statusmerkmal, und ist auf vielfältige Weise von Bedeutung am Arbeitsmarkt. Beispielsweise, weil begehrt zu werden (oder begehrt zu sein) den Selbstwert hebt, und wer selbstbewußt Erfolg ausstrahlt, wird er zugeschrieben und dem oder der fliegt er auch zu. Für Männer sind Beziehungen oder "Erfolg bei Frauen" Quelle des Status, bei Frauen ist es eher der Umstand des "Begehrt-Seins". Wie auch immer, wir könnten noch eine Reihe von solchen subtilen oder weniger subtilen Beispielen aufzählen, die allesamt gemeinsam haben, dass sie eine selten exakt zu messende, aber immer ungefähr bekannte "erotische Rangordnung" (Illouz) etablieren, die nicht nur auf die Partnerwahl ausstrahlen, sondern auch auf vielen anderen Feldern Reputationsgewinne entfalten.
Aber noch in manch anderer Hinsicht infizieren die Muster der Konsumkultur unser Beziehungsleben. Man denke nur an die Gier nach Neuem. Es ist nicht schwer, die strukturelle Ähnlichkeit zwischen der Sucht nach immer neuen Produkten und dem Hunger etwa nach Liebeserlebnissen auszumachen, beruht doch, wie Illouz weiter schreibt, der "Konsum auf dem Drang nach Erregung, denn der Kauf und die Erfahrung neuer Waren sind eine Quelle der Freude, und die Affäre befriedigt mit all der Erregung eines neuen Liebhabers diesen Drang ebenso". Das Neueste schlägt das Neue. Das klingt jetzt etwas erschreckend, ist es aber nur zu einem gewissen Grad. Dass die Neuheit selbst schon eine Attraktivität hat, ist nicht die schlechteste Charaktereigenschaft des modernen Menschen, denn die Neugierde ist sicherlich ein sympathischerer Zug als die Ignoranz oder das Desinteresse an Veränderung.
Aber die (kommerz-)kulturellen Umstände prägen unseren emotionalen Stil und es ist anzunehmen, dass sie ihn, wenn sie sich selbst ändern, auch verändern. Der zeitgenössische Kapitalismus zeichnet sich dadurch aus, dass er von grenzenloser Auswahl geprägt ist. Und die Praxen der Liebe gleichen sich dem an. Es fällt uns schwer, uns zu entscheiden. Partnerschaften schieben wir auf, oder zumindest eine tiefe Verbindlichkeit wird gerne durch das Ungefähre ersetzt. Es fällt ja schwer, sich im Ozean der Auswahl zu entscheiden, und wer mag sich schon zu einem Partner bekennen, wenn übermorgen um die nächste Ecke ein noch besserer Partner kommen könnte.
Gewiss, kaum jemand behandelt potentielle Partnerschaften so instrumentell wie eine Ware, die man erwerben kann oder auch nicht und wegwirft, wenn sie einem langweilen. Aber gerade, weil die Entscheidung eine so viel wichtigere und eminentere ist, weil also einerseits alles möglich ist, andererseits aber nie so recht klar ist, ob denn nur Begierde lockt oder doch so etwas wie die Perspektive elementarer Zusammengehörigkeit, gerade deshalb also müssen die Entscheidungen wohl erwogen werden. Und das ohne einen klaren Maßstab, was denn nun richtig und was denn nun falsch ist. Kurzum: Es müssen Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich nicht getroffen werden können.
Die Unentschiedenheit scheint manchen schon als der eigentliche Charakterzug einer ganzen Generation, deswegen wurde auch der Roman "Unentschlossen" des amerikanischen Schriftstellers Benjamin Kunkel seinerzeit so gefeiert. Die Hauptperson, Dwight Wilmerding, ist ein zielloser 28-Jähriger, der sein Philosophiestudium geschmissen hat und beim Medikamentenmulti Pfitzer im technischen Support arbeitet. Gelegentlich wirft er sich Ecstasy ein, er steckt so halb in einer Beziehung und leidet an chronischer Unentschlossenheit. Im Alltag kann er kaum eine Detailentscheidung treffen, durch das Leben driftet er so generell. Der Job geht flöten, das Erwachsenwerden verschiebt er erst einmal. Ein typischer Subkultursoftie eben: "Du bist ein wandelndes Klischee", sagt seine Freundin einmal, "und noch nicht einmal ein neues". Er ist eine Art extra unglücklicher Holden Caulfield, weil er einer Generation angehört, der das Haulden-Caulfield-hafte von den Vorgängergenerationen nur als zerschlissener Lifestyle, der im Second-Hand-Laden längst von der Stange zu haben ist, überlassen wurde. Was Dwight von anderen literarischen Figuren dieses Zuschnitts unterscheidet: Er sieht das als Problem. Als ihm einer seiner Wohngemeinschaftskumpels eröffnet, die chronische Unentschlossenheit habe einen Namen – Abulie –, und könne mit Tabletten behandelt werden, greift er sofort zu. Fest entschlossen, was er freilich zu verbergen versucht, aus Angst, "der entschlossen ausgedrückte Wunsch, von Unentschlossenheit geheilt zu werden, könnte einen Probanden womöglich von vornherein disqualifizieren". Er besucht eine Schulfreundin in Ecuador, die ihn dann aber mit ihrer Freundin Brigid sitzen lässt. Mit der, einer Kämpferin gegen Unrecht jeder Art, macht Dwight einen Trip in den Dschungel, wo er eine Art Damaskus-Erlebnis hat: als zielloser Twentysomething fährt er in den Busch, als "demokratischer Sozialist", als verknallter und beziehungsfähiger noch dazu, kommt er heraus.
Wo unbegrenzte Auswahl herrscht, stehen alle zur Wahl. Das ist auch eine stets riskante Position, Wert und Selbstwert stehen permanent auf Messers Schneide. Man kann zurückgewiesen werden, und die Schläge, denen man ausgesetzt ist, gehen ins Mark. Eva Illouz zitiert eine Gesprächspartnerin aus ihren Recherchegesprächen, die die Sache nach einer schiefgegangenen Affäre so formuliert: "Am schlimmsten ist der Gedanke, dass er einen ausprobiert hat, um einem am Ende doch nur den Stempel ABGELEHNT aufzudrücken." Dass die Grenzenlosigkeit potentieller Erlebnisse, die Technologietools von Parship bis Tinder versprechen, hier noch einiges dazu tun, versteht sich von selbst. In diesen Technologien wird der Geist des Konsumismus eklatant, der in unserem sozialen Verkehr längst drinnen steckt, den wir aber zugleich peinlich berührt zu ignorieren versuchen. Die Auswahl ist grenzenlos. Der oder die Bessere ist nur einen Klick weit entfernt. Man kann auch sagen: Hier wird der Gemütszustand, dass man niemals mit dem, was man hat, zufrieden ist, zu Technologie für Sozialverkehr. Willhaben, mit Menschen im Angebot. Die Technologie drapiert das Beziehungsangebot endgültig wie am Büffet, eine Form der Wahl, "die aus der ökonomischen Sphäre abgeleitet ist" (Illouz). Tinder ist nicht der Ursprung davon. Tinder und andere Apps sind Resultat eines neuen Mindsets und zugleich dessen Verschärfung. Sie hacken unser Leben.
Der zeitgenössische Kapitalismus zeichnet sich durch die Eigenart aus, dass wir immer und permanent eine Auswahl haben, die uns tendenziell überfordert. Man kann das auch die Tinderisierung des Alltags und jedweden Sozialverkehrs nennen. Das war keineswegs immer so. Natürlich hatte eine dezentralisierte, warenproduzierende Gesellschaft immer schon eine große Güterauswahl im Angebot. Aber vor 120 Jahren war bei den Gütern, die die normalen Leute konsumierten, im Wesentlichen ihre funktionale Seite von Bedeutung. Man kaufte keine Marke, man kaufte Mehl. Und Hosen. Und Hemden. Die Positionsgüter, die sich durch Warenästhetik unterschieden und damit Stil, Status oder ästhetische Vorliebe des Konsumenten ausdrückten, waren einer schmalen Oberschicht vorbehalten. Das hat sich auch bis in jüngste Zeit nicht total verändert. Die Mode erlebte ab den Fünfzigerjahren ihren Siegeszug und als die Fernseher und Autos auch für die breite Masse erschwinglich wurden, konnte man nach Design und Marke unterscheiden. Aber viele Dinge des täglichen Konsums waren nicht gerade von grandioser Auswahl gekennzeichnet. Brot war eben Brot. Und Telefon, Strom und sonstiges wurden zu Fixpreisen von staatlichen Monopolisten angeboten. Dass man sich zwischen hundert verschiedenen Strom- oder Telefontarifen entscheiden müsse, auf diese Idee wäre man damals nicht gekommen.
Heute ist praktisch jeder Tag mit Entscheidungen gepflastert und oft sind es überfordernde Entscheidungen, weil die Komplexität der Fragestellungen unseren Informationsstand übersteigt. Man hat Auswahl wie nie und nichts ist fix. Radikale Freiheit. Nur folgt aus dieser radikalen Freiheit auch zugleich Unfreiheit. Man lebt im Ungefähren und in der Unentschiedenheit. Der amerikanische Psychologe Barry Schwartz nennt das "the Paradox of Choice" – die Auswahl, die unglücklich macht. Damit ist nicht nur gemeint, dass wir sofort unglücklicher würden, sobald wir wählen können. Nicht einmal, dass uns die Auswahl ab einer bestimmten Menge der Möglichkeiten unglücklich macht. Sondern es gibt ja bei vielen Wahlmöglichkeiten Aspekte des Unabwägbaren, was eine vernünftige Auswahl verhindert. Bei der Partnerwahl weiß man nicht, ob nach dem Sensationalismus der ersten Wochen genug an Beständigkeit zurückbleiben wird, bei der Auswahl zwischen 5.000 verschiedenen Smart-Phone-Modellen kann man unmöglich ausreichende Informationen haben, die die Entscheidung stützen, und bei vielen elementareren Dingen würden wir eigentlich am Liebsten bevormundet. Wenn ich eine lebensgefährliche Krankheit habe, will ich nicht, dass der Arzt mich fragt, welche Therapie ich nun vorziehen würde – ich will einfach, dass er die eine, die beste Therapie beginnt. Und zwar pronto. Der Fluch der Auswahl besteht also oft auch darin, dass die Entscheidung von kompetenten Leuten auf inkompetente Leute – also Kunden wie Sie und mich – übergewälzt wird, die von dieser Entscheidung schon deshalb überfordert sind, weil ihnen für eine Wahl wesentliche Informationen fehlen.
"Eines der Paradoxien der Auswahl ist, dass sie paralysiert statt befreit", sagt Schwartz. "Bei so vielen Entscheidungsmöglichkeiten finden es die Menschen schwierig, sich überhaupt zu entscheiden." Und noch etwas hat Schwartz in seinen Studien herausgefunden: "Selbst wenn wir es dann schaffen, eine Entscheidung zu treffen, sind wir unzufriedener, als wenn wir aus weniger Möglichkeiten auswählen." Es gibt dafür eine Reihe von Gründen. Etwa: Je mehr Alternativen wir ausschlagen, umso wahrscheinlicher ist, dass wir eine der ausgeschlagenen Alternativen unbewusst später für besser halten als die, für die wir uns entschieden haben.
Ein anderer Grund: Eskalation der Erwartungen. Je mehr wir uns an grenzenlose Auswahl gewöhnen, umso eher werden wir uns nur mit den superoptimalen Möglichkeiten zufrieden geben: soll heißen: wir werden nie zufrieden sein. "Das Geheimnis des Glücks ist: niedrige Erwartungen", lacht Schwartz.
Grenzenlose Auswahl bei Unwägbarkeit und begrenzten Informationen produziert Entscheidungsschwäche. Entscheidungsstark nennt man heute daher nicht unbedingt Leute, die gut darin sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern Leute, die gut darin sind, eine Entscheidung zu treffen, obwohl sie nicht die Spur einer Ahnung haben, ob es die richtige Entscheidung ist. Solche Leute nennt man Vorstandsdirektoren oder neudeutsch CEOs.
Der Manager muss nichts wissen, er muss nur zwischen den Auswahlmöglichkeiten entscheiden, die jene zusammentragen, die so viel wissen, dass sie nicht mehr entscheiden können.
In der hedonistischen Vergnügungsgesellschaft ist die Liebe befreit und neu eingekerkert zugleich. Niemand soll, was hier beschrieben wurde, nur negativ lesen. Nichts ist nur grau und nichts ist nur rosarot. Echte Liebe sträubt sich auch immer gegen ihre konsumistischen Verkrüppelungen. Sie ist gewiss, wie Badiou oder auch Strecko Horvat ("Die Radikalität der Liebe") meinen, der Einbruch, das Ereignis schlechthin, das den Trott der Welt aufbricht, "ein Riss in der Welt, im gewohnten Ablauf der Dinge" (Horvat). Noch das konsumistische Bewußtsein träumt von den schicksalshaften Begegnungen, den Blicken, dem einen Augenkontakt, der das Leben verändert. Dem Risiko, das mit dem Sich-Verlieben verbunden ist, denn es gibt keine existenziellen Begegnungen, die ohne Risiko sind. Liebe ist gewissermaßen die private Revolution, die die Welt aus den Angeln hebt und keinen Stein auf den anderen lässt. Kapitalistisch versaut, gewissermaßen, und doch auch potentiell das Andere des Kapitalismus. "Fall in Love", wie es im englischen heißt, in die Liebe stürzen, ein Absturz, ohne Netz und sicherem Grund.
"Wenn uns aus dem Nichts heraus eine wahre Begegnung widerfährt, müssen wir die Chance um jeden Preis ergreifen", schreibt der Revolutionär Horvat, und:
"Brenne durch mit dem Fremden." (Robert Misik, 16.2.2018)