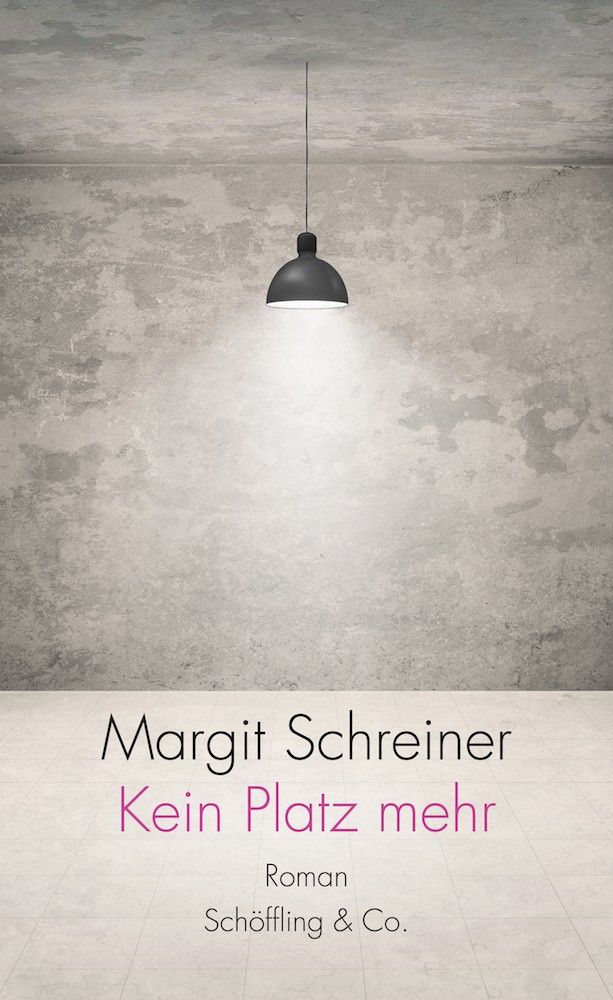Schon auf Seite 15 steht der zentrale Satz ihres neuen Buchs: "Wahrscheinlich ist es der Sinn des Todes, endlich Platz zu machen." Äußerst lebendig sitzt Margit Schreiner auf ihrem Sofa in ihrer Linzer Dachwohnung, das Rot des Samtstoffs und das Rot ihrer Haare leuchten um die Wette. Nein, sagt sie und rückt gleich einmal eine Mutmaßung zurecht, es wäre für sie nicht um das Ordnen letzter Dinge gegangen, das sei noch keine Motivation für sie gewesen, das Buch Kein Platz mehr zu schreiben, in dem es zunächst stark ums Ansammeln von Hausrat geht und damit auch ums Ausmisten. Sich reduzieren im Leben, das musste sie immer schon, erzählt die Autorin, Jahrgang 1953, allein durch die Umzüge, die sie hinter sich hat: von Linz nach Salzburg zum Studieren, es folgen vier Jahre in Tokio, wieder zurück nach Salzburg, dann Paris, später neun Jahre in Berlin, weiter nach Italien und irgendwann wieder zurück nach Linz.
Aber das Ausmisten, weiß sie heute, vollzieht sich bei ihr ohnehin am allermeisten beim Schreiben. Sämtliche ihrer Gedanken werden so durchforstet – und geordnet. Und der Platz, an dem dieser Prozess regelmäßig stattfinden darf, liegt noch einmal einen Stock über dem Samtsofa, Schreiner deutet zur Holztreppe mit Geländer, ihren Nikotininhalator vor sich auf dem kleinen Tisch, während draußen auf der Terrasse in der Februarkälte ein Packerl Zigaretten auf sie wartet, das sie aber nur kauft, wenn sie, wie sie sagt, "Buchpräsentationen und Lesungen hat". Margit Schreiner ist nicht die Art von Schriftstellerin, in deren Umfeld sich alles stapelt, sie muss aufräumen, bevor sie sich morgens mit einem Kaffee an den Schreibtisch setzt: "Erst dann ist die Welt in Ordnung."
Da oben in dieser mittelgroßen, gemütlichen Wohnung entstand auch Kein Platz mehr. Ein Roman? Manche würden meinen: Nein. Laut Schreiners eigener, von Karl Ove Knausgård übernommener Definition aber schon: "Einen Roman zu schreiben heißt einen Innenraum zu schaffen, in dem man möglichst alles, was man sagen will, sagen kann." Und obwohl die Pressefrau ihres Verlags noch gesagt hat, dass Schreiner da ein lustiges Buch geschrieben hat, und man beim Lesen mancher Stellen tatsächlich laut auflachen muss, geht es darin um nichts weniger als um ein eigentlich erschreckendes Panorama zivilisatorischer Beschwerden westlicher Gesellschaften.
Mein nächster Umzug
Es gibt keinerlei Kapiteleinteilungen, so als würde uns die Autorin sagen wollen, dass alles mit allem verbunden ist: eine Art Bewusstseinsstrom zu Fragestellungen, wie man im Hier und Heute sein Leben führen soll oder kann: "Zwischen Naturschutz, Tierschutz, Biokost, Katastrophenhilfe, Spendenaktionen, Patenschaften (...) hin- und hergerissen, würden wir doch die Schuld nie ganz los, dass unser Wohlstand auf dem Verrecken ganzer Völker beruhe", bekommen wir da zu lesen. Durchdekliniert werden sämtliche himmelschreiende Zu- und Umstände anhand verschiedener, in die Jahre gekommener befreundeter Paare.
Es geht also – und Schreiner hat ihre Bücher stets autobiografisch geschrieben – nicht nur um Alterswehwehchen, das auch, sondern um die Frage, wie man so ein Leben übersteht – beziehungstechnisch, berufstechnisch, einstellungstechnisch und natürlich auch platztechnisch. Der Platz, den man finden, sich erobern, verteidigen, meiden oder einnehmen muss, als Frau, als Mann, als alter Mensch, als Reisender, letztendlich als Mensch mit oder ohne Gewissen, zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Buch.
Und wie immer gibt die Autorin einiges von sich preis. "Das Schöne ist ja", erklärt sie lachend, "dass man beim Schreiben den Leser vollkommen vergisst." Die Grenzen, die es für Schreiner gibt, zieht am ehesten ihre erwachsene Tochter, die für sich klar beschlossen hat, aus den Geschichten der Mutter draußen bleiben zu wollen, und die dennoch überrascht war, dass diese Schriftstellermutter das sofort akzeptiert hat.
Durchhaltevermögen
Diese Mutter, die zwar ihren Platz als Schriftstellerin spätestens bei ihrer ersten Bachmannpreislesung 1990 in Klagenfurt gefunden hatte, von dem sie mit ihrem Beitrag Mein erster Neger aber gleich einmal disqualifiziert wurde (weil der Text schon veröffentlicht war), was ihr wiederum eine Menge Aufmerksamkeit verschafft hat, hat dennoch wie andere Autoren ihr Geld nicht nur mit dem Verkauf von Büchern verdient, sondern auch mit dem Abhalten von Schreibseminaren. Auch am Arbeitsplatz machen sich also Platzfragen auf: In Kein Platz mehr wird auch sehr kurzweilig beschrieben, wie sich dieses Heranzüchten der eigenen Konkurrenz dann anfühlen kann: "Der einzige Trost, den der starke Schriftstellercharakter finden kann, ist, dass das Schreibtalent selbst in einem Schriftstellerleben gar nichts nützt, sondern ausschließlich das Durchhaltevermögen, das Sitzfleisch (...)."
Und es ist auch so: "Viele verschwinden wieder!", sagt Schreiner, bevor wir hinaufsteigen in ihre Schreibstube unter dem Dach mit dem heimeligen Holzverbau und den vielen Bildern und Fotos an den Wänden. "Ich habe mich hier immer wohlgefühlt", sagt Schreiner über den Platz, an dem sie ganze 13 Jahre gelebt hat. Mit den vier Jahren in Urfahr sind das insgesamt 17 Jahre in Linz – länger als irgendwo sonst. "Es wird Zeit", ruft sie vergnügt und schaut über die benachbarten Hochhäuser – und meint damit Zeit dafür, wieder umzuziehen.
Die Oberösterreicherin wird mit ihrem Mann bald ins Waldviertel ziehen und die Wohnung, in der sie das kundtut, bald verkauft sein. Und kein Zweifel, sagt sie, sei dieser Umzug in eine renovierte Mühle aus dem 15. Jahrhundert ein Ergebnis der Arbeit an diesem Buch gewesen. Sie hatte nie wie andere den Wunsch, aufs Land zu ziehen, hatte eher die Vorstellung, dass sie im Alter viel reisen würde. Aber die Tatsache, "dass die einen um viel Geld auf seeuntüchtigen Booten vom Süden in den Norden zu reisen versuchen und ihr Leben riskieren und wir mit Billigfliegern vom Norden in den Süden reisen", bezeichnet sie als absurd und eigentlich nicht tragbar. Zum Glück interessieren sie heute "Nahebereiche" viel mehr, und Schreiner wirkt tatsächlich gespannt wie ein kleines Kind, welche Erfahrungen sie als Paar mit dem neuen Landleben machen werden und welchen Zündstoff das für ihr Schreiben liefern wird.
Verbrennen oder vergraben?
Sie wird sicher auch auf dem Land nicht garteln, sagt sie scherzend, meint das aber sichtlich ernst, und auch bei der Frage nach dem neuen, einfachen Leben auf dem Land winkt sie sehr offen und ehrlich ab. "Nein, nein", sagt sie, "im Alter, wo sich alle reduzieren und kleiner machen, vergrößern wir uns enorm. Eigentlich ein Wahnsinn!", lacht Schreiner entwaffnend, lässt aber keinen Zweifel daran, dass sie ganz und gar hinter ihrem Vorhaben steht. Also von "kein Platz mehr" zu "endlich Platz!" – irgendwie so. Die Kisten ihrer Tochter, die zurzeit im Ausland lebt, aus deren Linzer Atelier sind schon in dem großen Lager- und Atelierraum in der Mühle eingelagert, quasi als Vorboten und Versicherung, dass alles und alle anderen folgen werden: "Mir ist wichtig, dass sie bei uns einen Platz hat, auch wenn sie den gar nicht mehr braucht."
Margit Schreiner lässt keinen Zweifel daran, dass sie noch viel vorhat, gerade ist sie an ihrem nächsten Projekt – über Paradiese – dran. Zum Schreiben wird sie sicher erst im Frühsommer kommen, nach der "ganzen Umzieherei!" Erst einmal gehen wir eine rauchen. Schrecklich, sagt sie darüber, dass sie das immer wieder tun muss, schließlich geht es schon langsam doch auch um die Ökonomie der Kräfte. Der japanische Schriftsteller Murakami ist sowieso davon überzeugt, dass ein Schriftsteller, der Fett ansetzt, eigentlich am Ende sei. Dagegen schwimmt Schreiner beherzt an, am meisten im Sommer im Wallersee und hoffentlich bald auch im Waldviertel, wo sie, wenn ihr die Stille und Einsamkeit zu viel werden würden, in irgendein überfülltes Thermal-, Sole- oder Sonstwiebad abtauchen kann. "Stella, die jetzt Platz hat", Schreiners Hund, dem das aktuelle Buch gewidmet ist, wird das Waldviertel nicht mehr erleben. Sie wurde nach ihrem Tod verbrannt, das Säckchen mit ihren Überresten – winzig kleine Knöchelchen und Nagelsplitter – hält Schreiner manchmal in den Händen. Sie selbst geht gern auf Friedhöfen spazieren. Diese letzten Plätze sagen auch viel über eine jeweilige Gesellschaft aus. Ihr ist die Vorstellung von einem Grab fast lieber als die, in eine Urne gequetscht zu werden, wo kein Platz ist. Wie schreibt sie so treffend am Ende ihres neuen Buchs: "Wir alle, die wir uns in Kämmerchen, Verschlägen, Bibliotheken zurückziehen, üben das Sterben."
In ihrer Waldviertler Mühle ist erst einmal richtig viel Platz. (Mia Eidlhuber, Album, 17.2.2018)