Wenn US-amerikanische Medien über Stammzellforschung berichten, bilden sie oft Blastozysten ab, ein frühes Entwicklungsstadium des Embryos. Europäische Zeitungen zeigen ein spätes Entwicklungsstadium. Schon durch diesen simplen Vergleich lasse sich der von unterschiedlichen Kulturen geprägte Zugang zu biomedizinischen Forschungsarbeiten darstellen, sagte kürzlich Jürgen Knoblich, Koordinator der Stammzellinitiative am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).
In Europa denkt man offenbar an die "Nutzung" eines Embryos für diese Forschungen, in den USA fokussiert man sich wahrheitsgemäß auf das frühe Entwicklungsstadium des Embryos, in dem 200 bis 300 Zellen die Blastozyste bilden. Knoblich ergänzte, dass er ethische Bedenken im Zusammenhang mit dieser Forschung selbstverständlich respektiere.
Aus erwachsenen Zellen hergestellt
Die Wissenschaft ist längst über das Stadium hinaus, nur aus frühen Stadien der Embryoentwicklung Zellen gewinnen zu können, die sich zu allen Körperzellen ausdifferenzieren lassen und daher auch Heilungschancen bei unterschiedlichsten Erkrankungen deutlich erhöhen. Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) ähneln den embryonalen Stammzellen, werden aber aus erwachsenen Zellen hergestellt, die man "reprogrammieren" kann. Die relativ neuartige Technik ist derzeit nur in der Theorie anwendbar. Im Jahr 2012 gab es dafür den Nobelpreis.
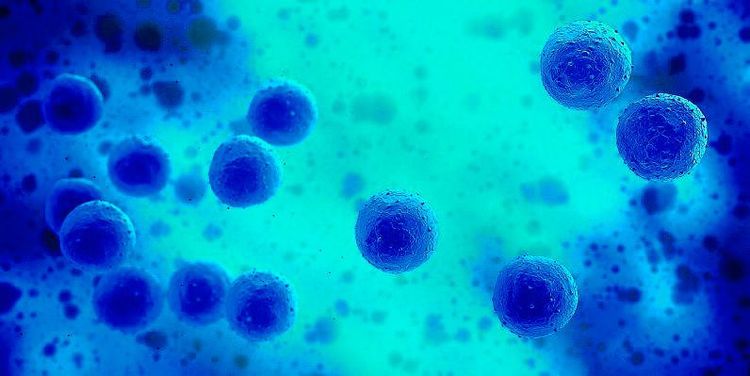
Knoblich erklärte diese Basics der Stammzellforschung im Zuge der Vorstellung aller Gruppen, die am IMBA mit Stammzellen arbeiten. Es sind ja immerhin fünf mit insgesamt 43 Wissenschaftern. Außerdem gibt es eine Stammzellen-Facility mit elf Mitarbeitern, wo Dienstleistungen für Forschergruppen auch außerhalb des IMBA angeboten werden.
Prunkstück der Einheit ist eine Bank mit nicht weniger als 17.000 verschiedenen Stammzellklonen, die jeweils eine Mutation in einem Gen tragen. Finanziert wird die Initiative seit 2016 von jenen 22,5 Millionen Euro, die Wissenschaftsministerium und Stadt Wien einst zur Verfügung stellten, um IMBA-Direktor Josef Penninger in Wien zu halten. Damals hatte der Wittgenstein-Preisträger von 2014 ein Angebot, das Max-Delbrück-Centrum in Berlin zu leiten. Mittlerweile hat er, wie berichtet, ein weiteres angenommen, und zwar die Leitung des Life Sciences Institute (LSI) der University of British Columbia in Vancouver zu übernehmen.
Die Finanzierung für fünf Jahre ist fixiert, danach, hoffen Knoblich und seine Forscherkollegen, sollte die Politik die Bedeutung der Stammzellforschung erkannt haben. Die Fördersituation bezeichnen die Wissenschafter als ausbaufähig. Knoblich betont: "Wir stehen am Rande einer Revolution in der biomedizinischen Forschung." In spätestens 20 Jahren würde jeder Mensch sein Genom nach einer Routineuntersuchung kennen.
Vernetzung der Forschung
Das bestätigte auch Frank Edenhofer vom Institut für Molekulare Biologie an der Uni Innsbruck. Die Stammzellforschung sei eines der am stärksten expandierenden Forschungsgebiete der Biomedizin und beinhalte große Chancen für eine nachhaltige Entwicklung der Wissensgesellschaft, sagte er im Rahmen eines Pressegesprächs. Er kündigte auch die Gründung der österreichischen Gesellschaft für Stammzellforschung an. Die Forschungsaktivitäten seien nämlich zerklüftet, eine Vernetzung könne daher nur von Vorteil sein.
Edenhofer erregte erst kürzlich mit einer Stammzellstudie zum Thema multiple Sklerose Aufsehen. Das im Magazin "Cell Stem Cell" publizierte Paper von den Unis Innsbruck und Cambridge zeigte auf, wie man dank Stammzelltransplantation die Gefahr einer Entzündung bei der Autoimmunerkrankung abschwächen könnte.
Eine Entwicklung der Stammzellforschung gilt als größter Hoffnungsträger für die Medizin: Man versucht bereits seit einigen Jahren Organoide im Labor zu züchten. Einer ehemaligen Postdoktorandin bei Knoblich, Madeline Lancaster, gelang 2013 die aufsehenerregende Züchtung des Minigehirns. Daraus entstand letztlich eine Zusammenarbeit mit der Med-Uni Wien.
Frühkindliche Formen der Epilepsie
Die Kinderneurologin Martha Feucht, Leiterin der Ambulanz für Erweiterte Epilepsiediagnostik, will gemeinsam mit dem IMBA mehr über die Ursachen und mögliche Behandlungsansätze bei zwei frühkindlichen Formen von Epilepsie erfahren, bei der Tuberösen Sklerose und beim Dravet-Syndrom.
Diese Erkrankungen gelten derzeit als nicht heilbar, sind aber verhältnismäßig gut charakterisiert und eignen sich daher als Modelle für die Entstehung von Epilepsien im Allgemeinen. Für Tuberöse Sklerose und das Drave-Syndrom konnten am AKH von jeweils drei Patienten Blutproben entnommen werden, die nun am IMBA zu Minigehirnen heranwachsen, um künftig mehr über die Ursache der Epilepsie bei diesen Patienten zu erfahren. (Peter Illetschko, 5.3.2018)