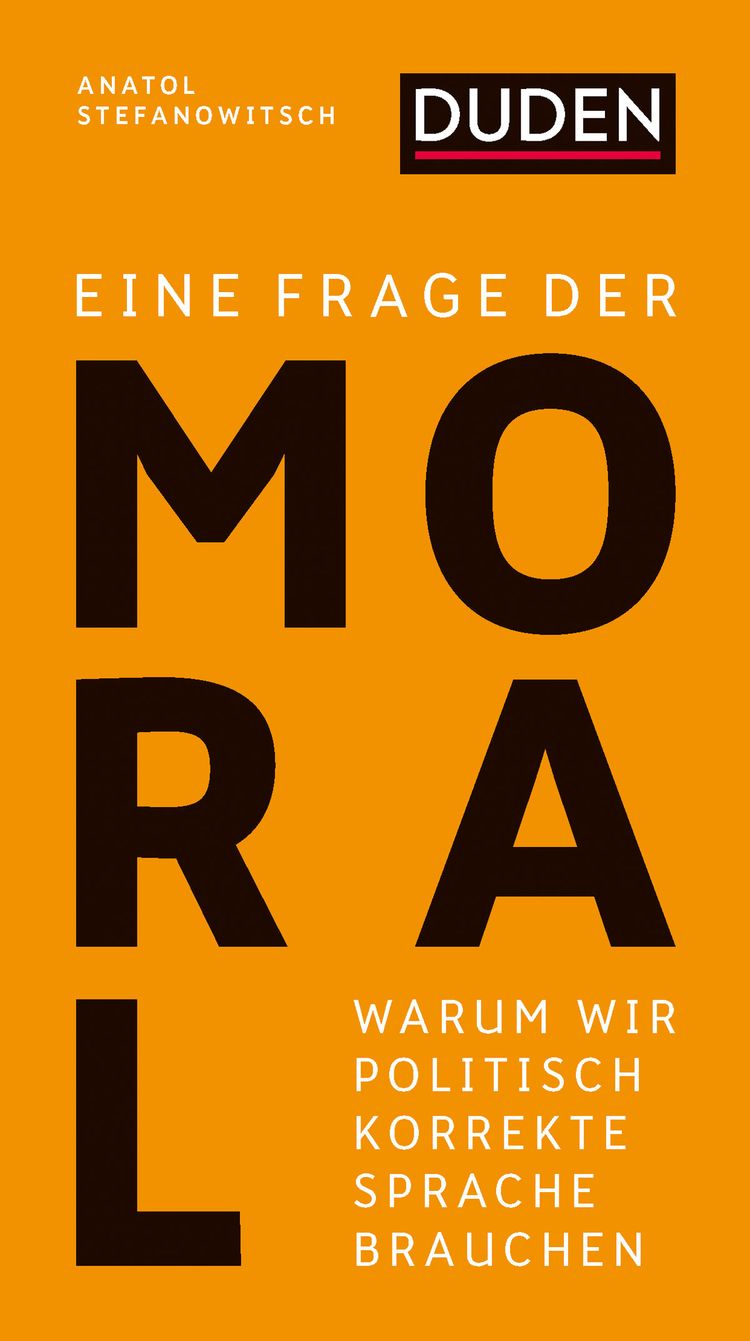Es geht um nichts Geringeres als Moral. Anatol Stefanowitsch hat keine Angst davor, sein neues Buch mit genau jenen Begriffen zu betiteln, die dank rechtspopulistischer Parteien und des konservativen Feuilletons fast schon Schimpfwort-Charakter haben: "Eine Frage der Moral. Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen" heißt das soeben erschienene Buch des deutschen Sprachwissenschafters. Darin seziert und erklärt er sowohl die Bestrebungen, eine halbwegs diskriminierungsfreie Sprache umzusetzen, als auch sämtliche Widerstände dagegen.
Wobei sich die meisten einig zu sein scheinen, dass Sprache nicht verhetzen soll. Trotzdem gibt es seit vielen Jahren eine enorm aufgeregte Diskussion, wo diese sprachlichen Verhetzungen und Verletzungen beginnen und welche davon wie schwer wiegen. Während die meisten darin übereinstimmen, dass etwa die Rede von "völkisch" oder "Schuldkult" um den Holocaust ein klares Zeichen eines verrohten Sprachgebrauchs ist, gibt es gleichzeitig heftigen Widerstand gegen Vorschläge, doch bitte andere Begriffe für den "Mohrenkrapfen" in der Konditorei oder den "N~könig" in Kinderbüchern zu finden – und auch noch jegliche rassistische Bedeutungsgeschichte verleugnet wird. Wer hier Änderungen vorschlägt, betreibe "sprachliche Bildstürmerei", beschreibt Stefanowitsch die empörten Reaktionen, etwa auf Änderungsvorschläge in literarischen Werken. In ein Gesamtkunstwerk dürfe nicht eingegriffen werden, schließlich entsprächen die Formulierungen der damaligen Zeit und wären somit auch wichtige Zeitdokumente.
Der "Walkman" darf verschwinden
Doch die vielen anderen Eingriffe, etwa in Kinderbüchern, lassen an diesen Motiven zweifeln. Zum Beispiel als Enid Blytons 1941 erschienenes Kinderbuch "The Adventurous Four" im Jahr 1969 verändert wurde: In der Geschichte von 1941 tauchten noch deutsche Soldaten mit Hakenkreuz-Binde auf, die später zu unpolitischen Waffenschmugglern wurden. Oder als in Thomas Brezinas "Rätsel um das Schneemonster" aus einem "Walkman" später ein "MP3-Player" wurde, schlug das öffentliche Interesse keine hohen Wellen, während bei sprachlichen Neuerungen im Sinne diskriminierter Gruppen die Empörung stets groß ist.
Auch den Einwand, politisch korrekte Sprache sei "hässlich", hält Stefanowitsch für verfehlt, denn "in der Sprache geht es – außerhalb der Poesie – nicht um Ästhetik, sondern um Kommunikation". Ebenso die überbordende Sorge um die Traditionen des christlichen Abendlandes, wenn aus einem "Weihnachtsmarkt" ein "Striezelmarkt" werden soll wie etwa in Dresden, der allerdings schon im 15. Jahrhundert Striezelmarkt hieß, weiß Stefanowitsch. So viel also zur Tradition.
Es sind viele interessante Beispiele, die Pseudoargumente gegen politisch korrekte Sprache als solche entlarven. Ins Zentrum des Buches rückt Stefanowitsch aber eine einfache "goldene Regel", über die sich im Grunde alle einig sein müssten und die auch moralphilosophisch fest im Sattel sitzt: "Stelle andere sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstellt." Und das erfordert einen Perspektivenwechsel: Wie wäre es, zum Beispiel, für Männer, wenn sie in einem Großteil der gesprochenen und geschriebenen Sprache im Femininum angesprochen werden würden, also als Bürgerinnen, Mitarbeiterinnen, Patientinnen. Im Sinne der "goldenen Sprachregel" sollten also diejenigen, die den Vorschlag unerträglich finden, doch mal selbst nur "mitgemeint" zu werden, es anderen nicht zumuten, sich ständig "mitgemeint" fühlen zu müssen.
Lange Listen abfälliger Ausdrücke
Denn beleidigende oder die eigene Existenz verschleiernde Sprache bemerken jene freilich nicht, die in der Sprache ständig präsent sind und für die es auch wenig diffamierende Ausdrücke gibt. Stefanowitsch schlägt etwa folgendes Gedankenexperiment vor: Wie viel abfällige und verletzende Ausdrücke fallen Ihnen für Frauen, schwarze Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, homosexuellen Menschen, Muslimas und Muslime, Menschen mit Behinderungen oder bildungsfernen Menschen ein? Und wie viele sind es für österreich- oder deutschstämmige weiße Männer, heterosexuell, mit Zugang zu Bildung und mit finanziellen Möglichkeiten? "Chauvi", "Bonze" oder die zuletzt öfter formulierte Beschreibung als "mächtige alte weiße Männer" klingt wohl im Vergleich zu der grausigen und langen Liste für die erstgenannten Gruppen eher nach Ponyhof denn nach tiefgreifender sprachlicher Diskriminierung.
Wer sogenannten Minderheiten oder Frauen gegenüber Hass empfindet, kann also ganz nebenbei aus einer Fülle von Begriffen (für Frauen von der Rabenmutter bis zur Schlampe oder für Menschen mit Migrationshintergrund vom Kopftuchmädchen bis zum Kameltreiber) schöpfen. Die Ideen, dem etwas entgegenhalten zu wollen, sind weder Sprachverbote noch Zensur, wie das vorliegende Buch klarmacht. Sie sind aber Ausdruck einer moralischen Haltung. Denn, schreibt Stefanowitsch, es hat sich in der Geschichte gezeigt, dass abwertender Sprache schnell abwertende Handlungen folgen, eine "Geschichte, die dazu verpflichtet, abwertende Sprache zu bekämpfen, bevor es so weit kommt". Ein wirklich guter Grund für politisch korrekte Sprache. Und wem der noch immer nicht reicht, dem hilft dieses zurückgelehnt argumentierende und gleichzeitig engagierte Plädoyer für politisch korrekte Sprache sicher weiter. (Beate Hausbichler, 29.3.2018)