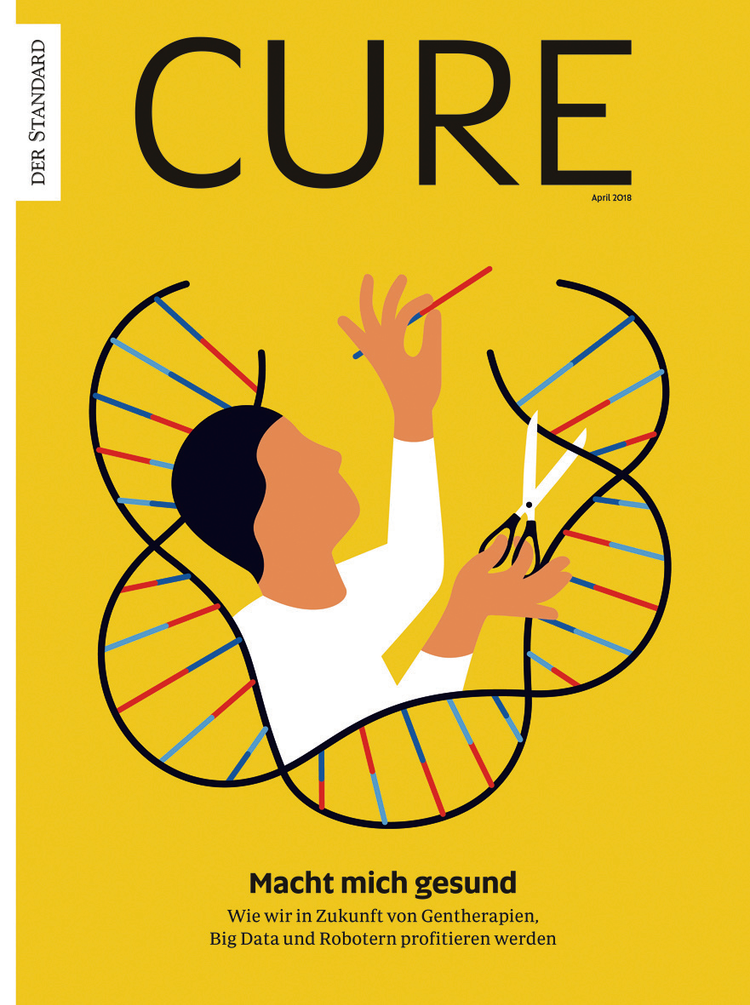Als der Patient das Behandlungszimmer betritt, hat der Arzt mit einigen Mausklicks alles vor sich: Die komplette Krankengeschichte seines Klienten – sein genetisches Profil zeigt, welche Krankheitsrisiken er hat. Zudem hat der Mediziner Einblick in das Leben des Patienten: wie viel er sich bewegt, was er isst, wie er schläft – Daten, minutiös aufgezeichnet durch Wearables und Gesundheitsapps. Um daraus etwas abzuleiten, nutzt er auch die künstliche Intelligenz dieser Systeme, Algorithmen, die die Symptome und Messwerte mit neuesten Studien und Therapien verknüpfen.
Ein solches Szenario ist heute noch Zukunftsmusik, doch Unternehmen wie IBM arbeiten daran. Mit "Watson" will man aus einem Wust an Daten Patientenrelevantes herausfiltern. "Künstliche Intelligenzsysteme werden in Zukunft die Medizin massiv beeinflussen", sagt Gerald Gartlehner, Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin an der Donau-Uni Krems. Jährlich werden in der Medizin über zwei Millionen wissenschaftliche Artikel publiziert. "Durch diese Flut an Informationen ist es für Ärzte unmöglich, auf dem Laufenden zu bleiben", so Gartlehner. Dadurch gehe Wissen verloren. KI-Systeme könnten zur Filterung der Datenflut dienen und die Ärzte unterstützen, das beste verfügbare Wissen einzusetzen. "Als Unterstützung, nicht als Ersatz", betont Gartlehner, das Einfühlungsvermögen des Arztes wird weiter eine wichtige Rolle spielen.
App als Diagnosetool
Potenzial sieht der Mediziner aber nicht nur in Sachen Diagnostik. Big Data in der Medizin könnte vermutlich auch helfen, Patienten gezieltere und präzisere Behandlungen zukommen zu lassen. "Einfach deshalb, weil dadurch große Datensätze, die genetische Marker und Vorerkrankungen umfassen, viel besser ausgewertet werden können."
Eine gezielte statt pauschale Prävention ist die große Vision von Jun Wang. Zu diesem Zweck hat der Biologe und Computerspezialist das Start-up iCarbonX in Südchina mitgegründet. Wang will alle möglichen Daten sammeln. Tragbare Geräte wie Fitnesstracker sollen Schritte zählen, Herzfrequenz und Schlafmuster der Patienten messen. Mit regelmäßigen Bluttests will er verschiedene Proteine und Enzyme kontrollieren. Antikörper im Blut etwa könnten schon in einem frühen Stadium Hinweise auf Krebs oder Autoimmunerkrankungen liefern, die Behandlung könnte früher als bisher einsetzen. Auch die DNA lässt sich immer billiger sequenzieren, und so lassen sich tausende von biologischen Stoffen und Prozessen erfassen.
Auch in Österreich arbeiten Forscher daran, über die Auswertung großer Datenmengen die Behandlung und Prävention zu verbessern. Peter Klimek von der Med-Uni Wien zum Beispiel. "Im Vergleich zu herkömmlicher klinischer Forschung können wir mit Daten arbeiten, die fast die komplette Bevölkerung Österreichs abdecken", sagt er.
Anhand von Daten aus dem österreichischen Abrechnungssystem konnten er und Kollegen ermitteln, dass Menschen, die etwa 1918 im Burgenland geboren wurden, ein erhöhtes Diabetesrisiko haben. Klimek machte sich auf die Suche nach der Ursache: Die Mütter dieser Diabetiker waren während der Schwangerschaft Hungersnöten ausgesetzt. "Das hat zu Stoffwechselanpassungen im ungeborenen Kind geführt, das im späteren Leben als Erwachsener Stoffwechselerkrankungen entwickelt."
Erkenntnis und Ethik
Klimek hat sich zudem die epidemiologischen Daten zu chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeschaut, die aufgrund der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung ein immer größeres Problem darstellen. Was ihm dabei auffiel: Chronische Erkrankungen treten meist gemeinsam auf, Diabetes in Kombination mit Bluthochdruck zum Beispiel, oft in Verbindung mit depressiven Erkrankungen. Solche Wechselwirkungen könne man in herkömmlichen klinischen Studien mit kleinen Probandenzahlen kaum erkennen. Auch die Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, die Patienten einnehmen, hat Klimek im Visier, ein Wissen, das man für die Prävention nutzen könnte.
Hier lauert aber auch eine große Gefahr von Big Data. Erkrankungen sind durch verschiedene Faktoren bedingt. "Und nur weil man ein erhöhtes genetisches Risiko hat, eine Krankheit zu bekommen, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Erkrankung ausbricht", sagt Gerald Gartlehner. Es kann also leicht zu falsch-positiven Befunden, also Fehlalarmen kommen, die die Patienten stark und unnötig verunsichern. "Eine weitere Gefahr besteht darin, dass man in Studien mit extrem großen Datensätzen aus statistischen Gründen ganz leicht statistisch signifikante Ergebnisse erhalten kann, auch wenn diese oft gar nicht klinisch relevant sind."
Die Digitalisierung der Medizin birgt aber noch andere Herausforderungen. Beim internationalen EU-Projekt Harmony etwa werden Daten aus klinischen Studien zu bösartigen Erkrankungen des Blutsystems wie etwa Leukämie zusammengetragen und mit Big-Data-Methoden ausgewertet. Das soll neue Herangehensweisen zur Therapie von Blutkrebs ermöglichen. Die Juristin und Bioethikerin Christiane Druml von der Med-Uni Wien entwickelt im Rahmen des Projekts ethische und rechtliche Richtlinien zum Umgang mit sensiblen Patientendaten. "Aus bioethischer Sicht gilt es, die Datensicherheit zu wahren", sagt sie. Wenn der Patient nicht nur für die ursprüngliche klinische Studie seine Zustimmung gegeben habe, sondern auch für die Zweitauswertung, sei es unproblematisch. "Der Patient weiß, worum es geht, er sieht für sich und andere einen Sinn."
Langfristige Perspektiven
Problematischer ist, so Druml, wenn Patienten nur zur ursprünglichen Studie zugestimmt haben, und etwa mittlerweile aufgrund der Erkrankung verstorben sind. "Wenn sein Einverständnis nicht vorliegt, müssen die Daten jedenfalls anonymisiert werden." Dafür sorgen letztlich die strengen Datenschutzvorgaben in der EU und Österreich.
Trotz all dieser wichtigen Bedenken haben Big-Data-Analysen und künstliche Intelligenz großes Potenzial. "Watson von IBM könnte etwa dazu dienen, die elektronische Krankenakte Elga auszuwerten", sagt Gartlehner. Das System könnte die Krankengeschichten aufarbeiten, sich parallel den aktuellen Wissensstand anschauen und etwa in einem konkreten Fall nachschauen, was die Leitlinien bei einer 80-jährigen Patientin mit Hypertonie und Diabetes empfehlen. "Das könnte vor allem Ärzte unterstützen, die nicht in einem Spital arbeiten, sondern in Einzelpraxen im ländlichen Raum." (Christian Wolf, 2.4.2018)