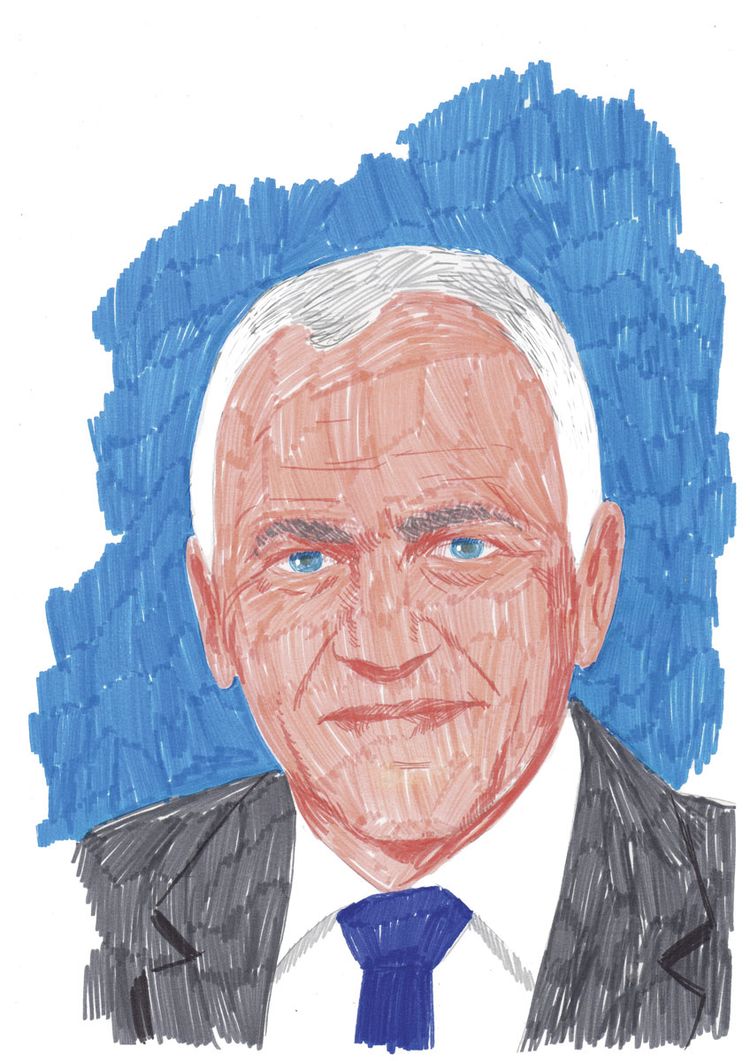
Vytenis Andriukaitis: "Ziel ist, dass kein EU-Bürger eigene Mittel für medizinische Behandlungen aufbringen muss."
STANDARD: Jedes europäische Land in Europa ist anders, auch hinsichtlich der Gesundheitssysteme. Wo ist das Gemeinsame?
Vytenis Andriukaitis: Wir sehen Gesundheit in der Europäischen Union auf zwei Ebenen. Zum einen geht es um die Versorgung von Patienten. Da hat jedes Mitgliedsland seine eigenen gewachsenen Strukturen, also Primärversorgung, Spitäler, Pflegeheime. Dort soll allen die bestmögliche Therapie zur Verfügung stehen. Zum anderen geht es aber um viel Grundsätzlicheres, nämlich die Frage, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben notwendig sind.
STANDARD: Die WHO definiert Gesundheit als soziales, geistiges und physisches Wohlbefinden.
Andriukaitis: Genau. Es sind auch die zentralen Fragen von Public Health, die nie allein im Gesundheitsressort gelöst werden. Denken wir an Alkohol, Tabak, Zucker, Transfette: Es sind Faktoren, die erwiesenermaßen Ursachen für viele chronische Krankheiten sind, die viele Menschen in allen EU-Staaten zukünftig betreffen werden. Ihre Produktion, ihre Bewerbung und ihr Vertrieb umfassen viele Branchen. Mit paneuropäischen Regulierungssystemen können wir gesundheitsfördernde Voraussetzungen schaffen. Bei Gesundheit geht es darum, immer den Blick auf das große Ganze zu haben.
STANDARD: Was meinen Sie damit genau?
Andriukaitis: Gesundheit betrifft viele Bereiche. Im April haben wir ein Grundsatzpapier mit dem Titel "European Pillar of Social Rights" verabschiedet. Es sind 20 Schlüsselprinzipien zum Erhalt eines funktionierenden Arbeitsmarktes und eines intakten Wohlfahrtsstaates. Das soll sicherstellen, dass kein EU-Bürger mit seinen eigenen Mitteln für eine medizinische Therapie aufkommen muss.
STANDARD: Also der Gegenentwurf zum amerikanischen System?
Andriukaitis: Es geht uns darum, Europa durch seine sozialen Werte zu definieren. Soziale Werte sind zentrale europäische Werte, von denen alle profitieren. Wir von der Kommission geben für diese Idee einen Rahmen vor. Es ist dann Sache der Mitgliedsstaaten, sich daran zu orientieren. "Health in all policies" wäre der beste Weg. Dazu brauchen wir Politiker aus allen Bereichen, die Entscheidungen im Sinne der öffentlichen Gesundheit treffen. Dafür würden wir uns derzeit ein paar mehr Fürsprecher wünschen.
STANDARD: Wo sehen Sie die Stärken für die Gesundheit in Europa?
Andriukaitis: In der Vielfalt. Wir haben in den Gesundheitssystemen der Mitgliedsstaaten viele interessante Modelle. Die Herausforderung ist es, die besten Lösungen herauszufiltern. Health-Technology-Assessment ist eine interessante wissenschaftliche Methode für die Evaluierung der besten Lösung. Im Endeffekt geht es dann aber darum, etwas, das gut funktioniert, auch grenzüberschreitend umzusetzen. Damit sollte es langfristig gelingen, noch bestehende Ungleichheiten zwischen den Mitgliedsstaaten auszugleichen.
STANDARD: Funktioniert diese Zusammenarbeit denn?
Andriukaitis: Wir haben bereits 24 Europäische Referenznetzwerke. Sie sind wunderbare Beispiele dafür, dass die Expertise von 300 Gesundheitsanbietern in 900 Spitälern europaweit funktioniert, um die Behandlung und Erforschung von seltenen Erkrankungen zu verbessern. Diese Art von Zusammenarbeit soll noch intensiviert werden. Wir brauchen Biobanken und Big-Data-Cluster auch für die Genomforschung und damit die Präzisionsmedizin, die versucht, Krankheiten viel zielgerichteter als bisher auf genetischer Basis zu behandeln.
STANDARD: Dabei geht es aber auch um Datenaustausch im weitesten Sinne?
Andriukaitis: Wir haben das E-Health-Network begründet. Daten sind heute eine Ressource für den medizinischen Fortschritt. Auch da setzen wir auf die Vielfalt und die vereinten Kräfte in Europa.
STANDARD: Wo gibt es Verbesserungspotenzial?
Andriukaitis: Ich denke, wir sollten auch neue ökonomische Modelle als Incentive für die medizinische Forschung finden. Das gilt gerade auch für die Antibiotika-Resistenzen. Wir brauchen neue Antibiotika, die wir nur im Notfall einsetzen, also sehr selten. Für die pharmazeutische Industrie ist das nicht rentabel, hier müssen wir neue Ideen entwickeln.
STANDARD: Welche neuen Ideen haben Sie zur Bewältigung der wachsenden Zahl chronischer Krankheiten?
Andriukaitis: Wir setzen uns massiv für Prävention, also die Vermeidung von Erkrankungen durch einen gesunden Lebensstil und eine saubere Umwelt, ein. Wenn wir nichts machen, werden wir schon sehr bald mit vielen Patienten konfrontiert sein. Ein Beispiel: Wir wissen, wie wichtig gesundes Essen ist. Gesundes Essen zu sozial verträglichen Preisen muss also das Ziel sein, und dafür müssen wir viele Stakeholder aus dem Lebensmittelbereich an Bord holen. Ähnliches gilt für die immer älter werdende Gesellschaft. Wir Europäer bewegen uns immer weniger. Auch in dieser Hinsicht brauchen wir eine paneuropäische Mobilisierung.(Karin Pollack, CURE, 15.11.2018)