Mittlerweile baut fast jeder Hobbysportler sein Training auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf. Wer sich gesund ernähren will, hat zumindest eine Ahnung vom aktuellen Forschungsstand. In der Schulpolitik hingegen vertraut man immer noch lieber auf Gefühl als auf Wissenschaft – die ideologischen Scheuklappen hängen tief. In der Bildungspolitik geht es um Stimmungen und Abgrenzung, um Parteipolitik und Vorurteile. Ganztagsschule, Schulautonomie, das Gymnasium, wie es früher einmal war – die Diskussion dreht sich seit Jahren im Kreis, und immer geht es nur um Strukturen. Dabei fehlt genau das, was wirklich wichtig wäre: eine Auseinandersetzung mit dem Lernen und Lehren selbst, mit dem, was in den Klassenzimmern geschieht.
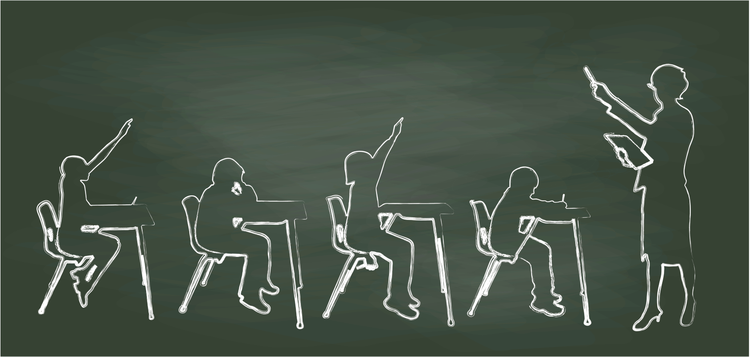
In den vergangenen zehn Jahren hat die wissenschaftliche Forschung enorme Erkenntnisse geliefert, wie man guten Unterricht gestalten kann, wie man Lernprozesse beschleunigen oder Schüler zu einem tieferen Verständnis des Stoffes bringen kann. Es sind Vorschläge, an denen sich weder Linke noch Konservative noch Rechte stören können. Sie würden nicht einmal viel kosten. Man müsste bloß, für einen Moment, die großen Debatten beiseiteschieben und sich auf andere – wesentlichere – Fragen konzentrieren. Stattdessen hören wir Bildungsexperten zu, die das Schulsystem "revolutionieren" wollen, oder geben Nostalgikern Raum, die sich nach der guten, alten Zeit sehnen. Obwohl wir wissen, dass nichts von ihren Vorschlägen realistisch ist oder jemals umgesetzt wird.
Ignoranz gegenüber der Wissenschaft
Vor knapp zehn Jahren veröffentlichte der neuseeländische Wissenschafter John Hattie seine umfassende Metastudie "Visible Learning", in der nahezu alle englischsprachigen Studien über Schulunterricht zusammengefasst wurden. 250 Millionen Schüler hatten an den Studien teilgenommen, über 100 Faktoren wurden isoliert und gruppiert. Und die Erkenntnisse waren eindeutig. Nur: Die Rezeption war spärlich, die wenigen Bildungsexperten und Politiker, die die Studie überhaupt zur Kenntnis nahmen, hörten wieder nur das, was sie hören wollten. Eine sinnvolle Auseinandersetzung blieb aus, und wieder diskutierte man über Schulautonomie, die Revolutionierung der Schule und das Gymnasium.
Auf den Unterricht kommt es an
Dabei zeigt Hatties Studie – und in der Folge eine Reihe anderer Untersuchungen –, dass die Struktur des Schulsystems und der Schule eine weitaus geringere Rolle spielt als bisher angenommen. Entscheidend ist, was in der Unterrichtsstunde passiert. Denn genau dort wird gelernt. Ob in einer Klasse 17 oder 25 Kinder sitzen, ob die Schule groß oder klein ist, ob sie eine Halbtags- oder eine Ganztagsschule ist, das alles macht zwar einen Unterschied. Aber ob die Lehrer wissen, wie sie den Stoff vermitteln, wie sie mit Fehlern umgehen oder wie sie mit der Klasse Lernziele entwickeln – das wiegt um ein Vielfaches schwerer.
Sichtbares Lernen
Wann lernen Schüler nun am besten? Wenn ihnen die Lehrer dabei helfen, ihr Lernen selbst zu beobachten, um dann selbstständig lernen zu können. Wenn die Lernziele klar definiert sind. Wenn sie ein Bewusstsein für ihre Fehler entwickeln und sich nicht vor Fehlern fürchten, sondern an und mit ihnen arbeiten. Wenn sie Strategien entwickeln, mit denen sie ihr Lernen reflektieren. Alles, was die Lernprozesse sichtbar macht, hilft deutlich mehr als ständiges Wiederholen, mehr als Nachhilfe, mehr als kleine Klassen.
Aber dafür braucht es eine neue Kultur der Rückmeldung. Heute schließt die Rückmeldung des Lehrers den Lernprozess ab: Plus und Minus für Hausübungen oder Stundenwiederholungen, Noten für Tests und Schularbeiten. Systematisches Feedback, das die Schüler ständig begleitet, ist die Ausnahme. Aber genau das beschleunigt das Lernen und hilft, Defizite rechtzeitig zu erkennen.
Der Fehler als Ort des Lernens
So brauchen Schüler Kanäle, über die sie nachfragen können. Jeder Lehrer kennt das Phänomen: Man erklärt den Stoff und fragt dann, ob es noch offene Fragen gibt. Und niemand meldet sich. Fordert man Schüler aber auf, mit einem grünen Stift aufzuzeigen, wenn sie alles verstanden haben, mit einem gelben, wenn sie das meiste verstanden haben, und mit einem roten, wenn sie wenig verstanden haben – dann sind auf einmal viele gelbe und rote Stifte in der Luft. Und man kann sich mit denen auseinandersetzen, die die Erklärung noch einmal brauchen. Eine winzige Maßnahme, die viel verändert. Wer den Stoff nicht verstanden hat, hat jetzt eine Schiene, es zu sagen.
Oder: Anstatt bei einer Gleichung in einer Mathematikhausübung den Fehler anzustreichen, könnte der Lehrer in der Zeile, in der der Fehler ist, eine Markierung setzen. Für die Verbesserung müssen die Schüler den Fehler selbst entdecken. Das bringt sie zum Nachdenken und zur Fehleranalyse. Der Umgang mit Fehlern verändert sich. Der Fehler ist nicht mehr einfach der Rotstift, sondern der Ort des Lernens.
Lernziele transparent machen
Lernprozesse werden auch dann sichtbar, wenn man im Detail weiß, was der Lehrer einem vermitteln will. Anstatt die Schüler einfach "drauflosschreiben" zu lassen, wird ein Aufsatz etwa in mehrere Teile zerlegt und Stück für Stück besprochen und geübt. Oder die Schüler erhalten einen Beispielaufsatz und müssen – wie ein Lehrer – selbst ein Feedback verfassen. Ist die Einleitung gelungen? Gibt es einen spannenden Höhepunkt? So entwickeln Schüler ein Gefühl dafür, was einen Text gut oder schlecht macht.
Kleine Veränderungen, die viel verändern
Das alles sind Konzepte, die keine langjährige politische Debatte erfordern. Die Erkenntnisse der Lernforschung sprechen eine deutliche Sprache. Werden in der Schule diese Methoden eingesetzt, lernen Schüler nachweislich schneller und entwickeln ein tieferes Verständnis. Setzt man konsequent auf Feedback, sind die Lerneffekte bis zu doppelt so hoch wie in durchschnittlichen Klassen. Es sind kleine, unspektakuläre Veränderungen. Aber sie bewirken viel.
Die Verantwortung dafür, dass diese Ideen in den Klassenzimmern ankommen, liegt bei der Bildungspolitik. In erster Linie müsste man sich dafür einsetzen, dass diese didaktischen Modelle in der Aus- und Weiterbildung gebührenden Raum bekommen. Das ist weder eine Mammutaufgabe, noch wird es großen politischen Widerstand geben. Damit kann man keine Schlagzeilen machen oder Kampagnen führen. Aber es würde unserem Schulsystem weit mehr bringen als eine Reform der Reform der Reform der Neuen Oberstufe. (Fabian Steinschaden, 6.9.2018)