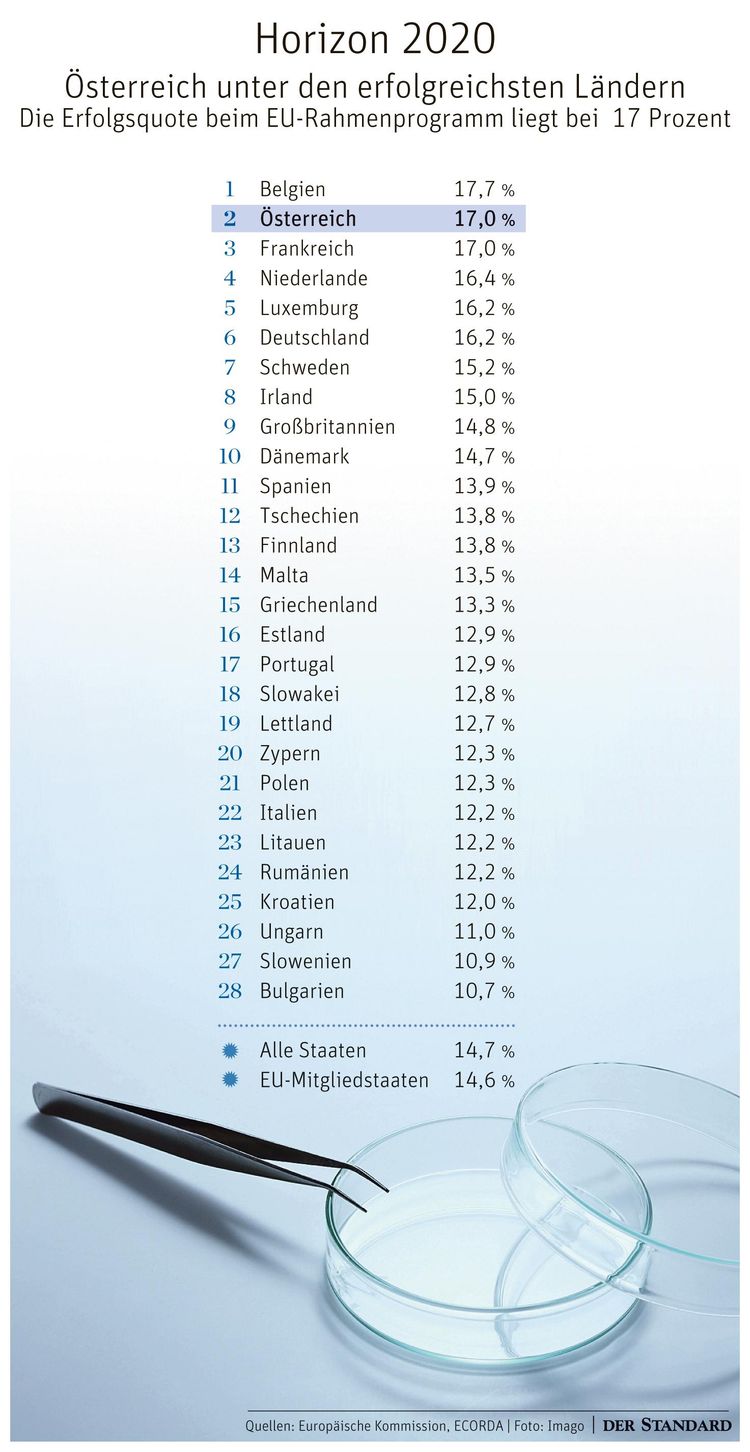
Die Verhandlungen im EU-Parlament und in den EU-Mitgliedstaaten zum neuen europäischen Forschungsrahmenprogramm laufen auf Hochtouren: "Horizon Europe" wird das derzeitige Rahmenprogramm "Horizon 2020" im Jahr 2021 ablösen und sieht bis 2027 Investitionen in der Höhe von 100 Milliarden Euro vor. Eine neue Struktur, vereinfachte Vorschriften und die Einrichtung einer überschaubaren Anzahl von vordergründigen "Missionen", etwa im Umweltbereich, sollen die Forschungsaktivitäten in der EU in die Zukunft tragen.
Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass der Nutzen der Rahmenprogramme aber nicht nur in der Schaffung neuen Wissens liegt. "Die Programme haben verschiedene Forschungsteams, und damit das verteilte Wissen innerhalb der EU, zusammengebracht", betont Lena Tsipouri. Die Wirtschaftsprofessorin an der Universität Athen beschäftigt sich mit der ökonomischen Entwicklung und dem technologischen Wandel in Europa und berät EU-Institutionen bei der Implementierung neuer forschungspolitischer Strategien. Vergangene Woche war sie zu Gast beim FFG-Forum. Bei der Veranstaltung der Förderagentur wurde in verschiedenen Panels über österreichische und europäische "Herausforderungen für die angewandte Forschung und Verwertung von Forschungserkenntnissen" gesprochen.
Netzwerkbildung
In ihrer Analyse der EU-Förderstrukturen für Forschung und Entwicklung hebt Tsipouri, die unter anderem auch in Wien studiert hat, aber nicht nur transnationale Synergien hervor, sondern auch die Netzwerkbildung innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten. "Insbesondere in den südlichen und östlichen EU-Staaten war die Zusammenarbeit mehrerer Universitäten und Unternehmen an gemeinsamen Projekten lange Zeit nicht üblich", sagt die Ökonomin. "Es ist ein Verdienst der EU-Rahmenprogramme, dass man hier oft dazugelernt und diese neue Philosophie adaptiert hat."
Die Erfolgsrate der geförderten Projekte ist hoch. Vielleicht zu hoch. Denn Tsipouri sieht darin auch eine problemhafte Entwicklung. "Der Zweck von Zuschüssen liegt darin, Risiken und Unsicherheiten abzufedern. Haben aber alle Projekte Erfolg, ergeben die Förderungen kaum noch Sinn." Letztendlich wird damit auch die technologische Entwicklung gebremst: Wenn man bei der Auswahl der Projekte immer auf Nummer sicher geht, sinkt die Wahrscheinlichkeit disruptiver Entwicklungen.
Ein Beispiel könne man sich hier an Programmen der Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums, Darpa, oder dem auf Energieforschung ausgerichteten Pendant, Arpa-E, nehmen: "Dort will man eine kleine Erfolgsrate haben. Man finanziert zehn risikoreiche Projekte, und nur eines erweist sich schlussendlich als bahnbrechend", beschreibt die Ökonomin, die auch im Rahmen der EU-Förderungen für mutigere Evaluierungen eintritt. "Man könnte beispielsweise Programme aufsplitten und in einem Teil riskantere Projekte fördern, während man im anderen Teil weiterhin auf Sicherheit pocht."
Missionen der EU-Forschung
Ein neues Risikobewusstsein sei gerade auch im Zusammenhang mit den im Rahmen von Horizon Europe vorgesehenen Missionen notwendig. Es ist eine Pionierleistung Europas, dass eine internationale Forschungszusammenarbeit hervorgebracht wurde, die nicht allein auf eine Erhöhung der Produktivität, sondern auch auf die Lösung allgemeiner gesellschaftlicher Probleme ausgerichtet ist – etwa die Abschwächung des Klimawandels oder die Fokussierung auf medizinische Bereiche wie die Ebola-Forschung.
Das Konzept der Missionen in der EU-Forschungsstrategie wurde Anfang 2018 von der italienisch-amerikanische Wirtschaftswissenschafterin Mariana Mazzucato in einer Arbeit vorgestellt. Ein Vorbild, das Mazzucato nennt, ist die 1961 getätigte Vorgabe des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, bis Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen.
Künftige Missionen der EU sollen ebenfalls konkrete, messbare Ziele sowie eine Zeitvorgabe beinhalten. Das Ansinnen der EU-Kommission, bis 2030 eine Recyclingquote von Kunststoffen von 50 Prozent erreichen zu wollen, gibt einen Vorgeschmack.
Eine weitere Neuerung im Rahmen von Horizon Europe ist die Adaptierung des "Start-up-Narrativs". Rasch wachsende Start-ups orientieren sich schnell in Richtung USA und Silicon Valley: "Die Frage ist, wie wir den Start-ups in diesem Kontext am besten helfen können", sagt Tsipouri.
"Soll gefördert werden, dass sie in Europa bleiben, oder soll ihre Internationalisierung unterstützt werden?" Start-up-Beispiele, die gegebenenfalls ihre Unternehmenszentrale in die USA verlagern, die Produktion aber diesseits des Atlantiks belassen, zeigen, wie es aus der Sicht Europas gut laufen könnte. "Förderstrategien zu entwickeln, die richtig mit diesen Phänomenen der Globalisierung umgehen, bleibt eine Herausforderung", sagt Tsipouri. (Alois Pumhösel, 23.9.2018)