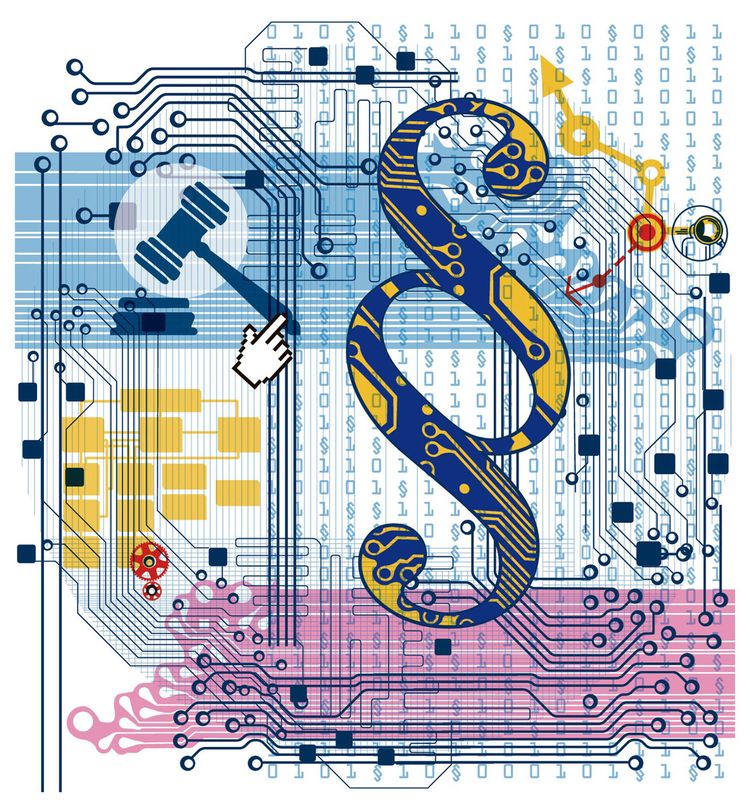Sie sind ein beliebtes Motiv der Pressefotografen: jene Papiertürme an Akten, die den Richtern als Grundlage ihrer Entscheidungen über Schuld oder Unschuld dienen. Allein im Fall Grasser waren es zum Zeitpunkt der Anklageeinbringung über 200 Aktenbände. Wer mit Großverfahren zu tun hat, braucht nicht nur viel Hirnschmalz, sondern auch jede Menge Regalfläche.
Stahlschränke werden jedoch zunehmend von Servern verdrängt. Der Papierakt ist zwar nach wie vor der Normalfall an Österreichs Gerichten, nur das Wiener Handelsgericht und einzelne Abteilungen an den Landesgerichten führen ihre Akten im Rahmen von Pilotprojekten ausschließlich digital, bei den Staatsanwaltschaften werden zudem alle Verfahren gegen unbekannte Täter digital geführt.
Bis 2022 sollen aber alle Verfahren an Gerichten und bei Staatsanwaltschaften auf den digitalen Akt umgerüstet werden. Zwei Jahre früher soll bereits der gesamte Bereich der Zivilverfahren, zu dem unter anderem Scheidungsverfahren und Arbeitsrechtsprozesse zählen, auf den digitalen Akt umgesattelt sein. Ob dieser Plan des Justizministeriums hält, ist allerdings nicht fix: Der Finanzminister muss dem Projekt noch seinen (Geld-)Segen geben.
Österreich als Frühstarter
Dabei gelte Österreich europaweit als Vorreiter in Sachen Digitalisierung, sagt Martin Hackl, Chief Digital Officer im Justizministerium. Bereits Anfang der 1990er-Jahre, lange bevor man über digitale Akten nachgedacht hat, wurde damit begonnen, die Korrespondenz mit Gerichten auf elektronischen Rechtsverkehr umzustellen.
Deshalb findet heute nicht einmal ein Drittel des Schriftverkehrs von Gerichten und Staatsanwaltschaften auf Papier statt – siebzig Prozent der Korrespondenz läuft digital. Seit einiger Zeit sind alle Rechtsanwälte, Notare und Finanzinstitute verpflichtet, ihre Eingaben an Gerichte über ein elektronisches Kommunikationsportal zu machen. Da die Gerichte ihre Akten jedoch weiterhin mehrheitlich auf Papier führen, heißt das für das dortige Kanzleipersonal in vielen Fällen: ausdrucken, ausdrucken, ausdrucken – und wieder einscannen.
Das Umsatteln auf den elektronischen Akt bringt also Einsparungspotenzial und neue Möglichkeiten. Und nicht nur das: Vor allem in Großverfahren erleichtere es Gerichten und Staatsanwaltschaften die Arbeit, wenn sie beispielsweise per Schlagwortsuche direkt auf bestimmte Aktenteile zugreifen können und nicht mehr nur auf die Sortierung nach Ordnungsnummern angewiesen sind. Derzeit herrscht im Match zwischen Staatsanwaltschaften und den großen Anwaltskanzleien nämlich alles andere als Waffengleichheit, was die Ausstattung mit Analysesoftware betrifft.
Anpassung von Arbeitsschritten
Der Umstieg aufs Digitale hat aber nicht nur rosige Seiten. Bis die Anwender die Erleichterungen in der täglichen Arbeit wirklich spüren, braucht es eine Phase der Eingewöhnung, in der gewohnte Arbeitsschritte angepasst und neue Techniken erlernt werden. Das kann anfangs schwerfallen und vorübergehend auch Mehraufwand bedeuten. Später zahle sich der Wandel aber aus, ist Hackl überzeugt.
Bürger könnten dann von unterwegs mobil abfragen, was der aktuelle Stand ihres Verfahrens ist. Auch Richtern eröffne das digitale Format die Möglichkeit, von unterwegs auf ihre Akten zuzugreifen und sich per Knopfdruck nur jene Seiten anzeigen zu lassen, die zuvor als "entscheidungsrelevant" markiert worden sind. Solche Markierungen können händisch vorgenommen werden, nach und nach könnte maschinelles Lernen aber auch dazu führen, dass das System selbst zu unterscheiden weiß, was relevant für die Beweiswürdigung ist und was nicht.
Maschinelles Lernen kann auch in anderen Bereichen Vorteile bringen: So gibt es Werkzeuge, die es schaffen, zum jeweiligen Akt die wichtigsten entscheidungsrelevanten Texte dazu zu suchen – etwa höchstgerichtliche Judikatur.
Die allermeisten der drei Millionen Verfahren, die pro Jahr in der Justiz anfallen, sind aber schnell zu erledigende Fälle. Die Ressourcen, die jetzt dafür verwendet werden, diese Fälle analog zu dokumentieren, können eingespart und in anderen Bereichen verwendet werden, die derzeit unterbeleuchtet sind: etwa in zusätzliche Investitionen in professionelles Dolmetschen vor Gericht.
Papiervariante bleibt
Wird der Briefverkehr also bald völlig aus der Gerichtswelt verschwinden? Nein, sagt Hackl. Das Ziel sei, alle Generationen zu bedienen: sowohl jene meist älteren Bürger, die sich den Umstieg auf die elektronische Korrespondenz nicht antun wollen, als auch jene, die alle sonstigen Geschäfte elektronisch erledigen und nicht verstehen, warum die Justiz hier eine Ausnahme darstellen soll. (Maria Sterkl, 7.11.2018)