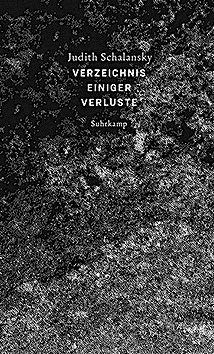Mit dem Vergessen ist das so eine Sache. Glücklich sei, wer vergisst, behaupten manche, aber das stimmt halt auch nur bedingt. In Sachen Gedächtnis gibt es, wie überall anders auch, ein richtiges Maß. Die Frage ist nur, wie genau es aussieht. Judith Schalansky hat in ihrem jüngsten Band Verzeichnis einiger Verluste den vielfältigen Formen der Vernichtung, des Verschwindens und In-Vergessenheit-Geratens ebenso wie der fragilen, oft ihrerseits zerstörerischen Kunst der Erinnerung ein Denkmal gesetzt.
Ihr Verzeichnis des Verlorenen umfasst zwölf Kapitel, in denen etwa der ausgestorbene Kaspische Tiger wieder zum Leben erweckt wird, den Liebesliedern der griechischen Dichterin Sappho, dem Berliner Palast der Republik oder dem ersten, verschollenen Film von Friedrich Wilhelm Murnau nachgespürt wird. Jeder Eintrag beginnt, wie bei Personen im Lexikon, mit sachlichen Informationen zu Geburt und Tod des betreffenden Gegenstandes.
Oft genug wird dabei, etwa beim Palast der Republik, deutlich, wie sich der Mensch in seinem Schaffen und Trachten letztlich nur von einer Form der Selbstzerstörung zur nächsten hangelt: Den Stahl des Gebäudes, in dem (schon damals nur noch durch Ausnahmeregelung möglich) circa 5.000 Tonnen Spritzasbest verbaut worden waren, formte die deutsche Automobilindustrie schließlich zu Motoren. Wie das endete, kann man in der Zeitung lesen.
Wo die herkömmliche Überlieferung endet, versagt oder schlicht nicht vorhanden ist, da beginnt bei Schalansky das Erzählen, die Literatur. So imaginiert sie im Eintrag zum Palast der Republik ein Paar, das irgendwo in der demokratisch deutschen Provinz lebt und für das es Spargel nur gibt, wenn es ihn vom Acker klaut. In die Läden kommt das Gewächs nicht, gerüchteweise geht alles direkt nach Berlin, in ebenjenen asbestverseuchten Prestigebau.
Dort wird schließlich auch der Mann mit seiner Geliebten gesichtet, die Nachbarn berichten es der Ehefrau. Die wechselhafte Geschichte jenes Gebäudes – für diese Menschen schnurrt sie zusammen auf die Erinnerung an Verrat und Lüge. Auch das Kapitel über "Das Schloss der von Behr" hat die Geschichte oder besser die Geschichtslosigkeit der DDR zum Thema. Schalansky selbst lebte als Kind ein Jahr lang in der Nähe des heute unter Denkmalschutz stehenden Landschaftsparks, der zu dem längst nicht mehr existierenden Schloss gehörte.
Sie spürt ihrer ersten Erinnerung nach, versucht Gewesenes festzumachen, verirrt sich in den Schleifen des Gedächtnisses. Was ist Fiktion, was Wahrheit? Was ihr noch lebendig vor Augen steht, das ist ein Kind, das in einem Heute ohne Gestern aufwächst. Den Satz "Die Liebe höret nimmer auf" versteht es nicht, denn er ist ein "Überbleibsel aus einer Vergangenheit, die ein für alle Mal überwunden schien".
Die größere Hoffnung
In vielen Texten begleitet Schalansky Menschen, die wie sie den Bestand der Welt zu ordnen und archivieren versuchen, den Ruinenmaler Hubert Robert etwa oder den Schweizer Armand Schulthess, der einen Wald zur "Bibliothek des Wissens" umgestaltete und erst als Sonderling, schließlich als bedeutender Künstler galt. Aber ob sie über Menschen schreibt oder über Flora und Fauna, Schalansky tut das in einer souveränen und reichen Sprache – mal in den gedrechselten, altertümlichen Sätzen eines Botanikers des 19. Jahrhunderts, mal in der kunstvollen, detailgenauen Beschreibung der Natur.
Im Gedenken an ein verbranntes Gemälde von Caspar David Friedrich, das den Hafen von Greifswald zeigte, folgt sie dem Lauf des Flusses Ryck, der schließlich in die Ostsee mündet. In unfassbar schönen, formvollendeten Sätzen, mit sicherem land- und forstwirtschaftlichen Vokabular bannt sie diese Landschaft auf Papier. Ein paar Seiten, die Hoffnung geben angesichts der fortschreitenden und offenbar unaufhaltsamen Zerstörung der Erde durch Menschenhand. Zumindest in Worten bleibt die Schönheit der Welt aufgehoben, ein sehr kleiner, aber doch: ein Trost.
Spätestens mit diesem Buch ist klar, dass Schalansky zu den ganz Großen der deutschsprachigen Literatur gehört. Ohne in Pathos zu verfallen, lässt sie eine mit diesem im besten Sinne wundersamen (und übrigens von Schalansky selbst auch wunderschön gestalteten) Werk wieder uneingeschränkt an die Kraft des geschriebenen Wortes glauben, an die immense Wichtigkeit von Büchern.
Im letzten Kapitel landet der Mondforscher Kinau auf dem Erdtrabanten, wo alles gesammelt wird, was auf Erden verschwand und wo man (freilich vergeblich) versucht, diese Dinge zu verwalten. Die Menschen, schreibt Kinau, hätten übertrieben, "als sie an jenem Fabelort all das vorzufinden glaubten, was sie selbst insgeheim vermissten: zerronnene Tage ebenso wie untergegangene Imperien, verflossene Lieben und unerhörte Gebete". Dabei gibt es jenen Fabelort auf Erden längst. Es handelt sich dabei um die Literatur. (Andrea Heinz, 18.12.2018)