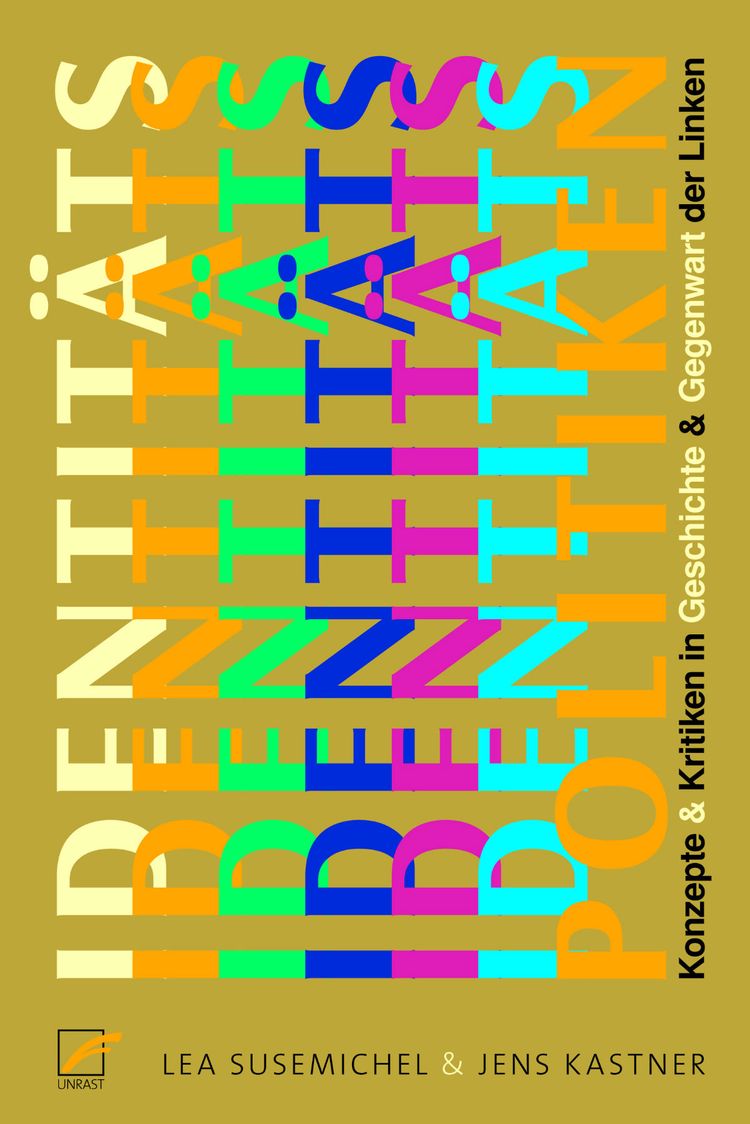
Jens Kastner, Lea Susemichel, "Identitätspolitiken. Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken". 12,80 Euro / 152 Seiten. Unrast Verlag, Berlin 2018
Es gibt viele Erklärungsversuche, wie es dazu kommen konnte. Zu dem Aufwind für rechte Parteien und natürlich zu Trump. Parallel zu dieser Frage wurde heftige Kritik an Identitätspolitik laut. Seitdem hat der schon lange vor sich hin wabernde Anti-Politicial-Correctness-Diskurs neuen Antrieb bekommen, in dem sich Linke, Liberale bis hin zu Ultrarechten in Harmonie treffen.
Und auch in den verschiedenen Emanzipationsbewegungen selber gibt es heftige Auseinandersetzungen darüber, ob eine zu starke Referenz auf Identität kollektives Handeln verunmöglicht, politische Bewegungen zersplittert und eine arg individualisierte Identitätspolitik, in der nur die Erzählung über die Diskriminierungserfahrung des Einzelnen als politisch glaubhaft durchgeht, neoliberale Züge habe.
Denn Identität und kollektiv – das geht tatsächlich manchmal schwer zusammen. Und damit steht man schon mitten im Irrgarten der Identitätspolitik. In dem sollte man sich allerdings gerade jetzt zurechtfinden. Denn das neue Jahr könnte uns gleich in seinen ersten Wochen viel Schelte für linke Identitätspolitik bringen.
Im Februar wird Francis Fukuyamas neues Buch auf Deutsch erscheinen ("Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet"). Die Linke konzentriert ihre Gleichheitsforderungen nicht mehr wie früher auf die Arbeiterklasse, schreibt Fukuyama, sondern auf die Wünsche eines immer größer werdenden "Kreises ausgegrenzter Gruppen". Mit fatalen Folgen, wie der Politikwissenschafter meint: Die heutige linke Identitätspolitik hätte so die rechte Identitätspolitik ausgelöst.
Politisch nutzbar
Der emanzipatorische Bezug auf eine Identität als schwarze, schwule, inter-, transsexuelle Menschen, auf das Frausein – das sei demnach schuld an der heute so oft ungeniert ausgesprochenen Referenz der Rechten auf eine Identität, die auf "Nation", "Kultur", ja sogar "Rasse" fußt. Linke Identitätspolitik habe die Rechte erst so richtig provoziert, ihr Radikalität und Erfolge beschert – das ist eine schallende Ohrfeige für verschiedenste politische Bewegungen, eine, die sich bestimmt gut verkaufen lassen wird.
Genau deshalb ist eine differenzierte Analyse der aktuellen linken Identitätspolitik, ihrer Geschichte und ihrer Fallstricke so wichtig, die sich dieser viel zu einfachen Darstellung entgegenstellt. Das Buch "Identitätspolitiken" liefert wichtige Puzzleteile für die Debatte und eine kritische Auseinandersetzung, die – eine Seltenheit – gänzlich ohne Polemik gegen holpertatschige Versuche der politischen Selbstbehauptung auskommt.
Denn so oder so: Solche Selbstbehauptungen sind unentbehrlich. Diese Haltung bleibt in dem Buch immer aufrecht. Und gerade weil diese Demokratisierungsprozesse so wichtig sind, üben auch Susemichel und Kastner Kritik an ihnen. So greift das Buch etwa die Frage auf, wie unterschiedlichste Diskriminierungserfahrungen politisch nutzbar bleiben, ohne Gräben aufzureißen.
Die Frauenbewegung liefert eine erste explizite Erwähnung linker Identitätspolitik – wenngleich bereits die Schaffung des "Proletariats" identitätspolitische Prozesse brauchte, die schon beim gemeinsamen Bier nach der Arbeit beginnen – inklusive sämtlicher Ausschlüsse, etwa die der Frauen.
Mit Ausschlüssen kennt sich aber eben auch die Frauenbewegung bestens aus. Ein Kollektiv schwarzer, lesbischer Frauen, das Combahee River Collective, hat es 1977 konkret ausgesprochen: "Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer Identität kommt." Sie waren überzeugt, dass ihre spezielle Erfahrung, als schwarze, lesbische Frauen diskriminiert zu werden, Dreh- und Angelpunkt im Kampf gegen Diskriminierung sein muss.
Ein Paradox
So wichtig diese Erkenntnis zweifelsohne ist, bleibt sie dennoch ein Paradox, das auch Probleme bringt: Schließlich muss man sich genau auf jene Merkmale beziehen, derentwegen man überhaupt diskriminiert wurde. Der bewusste Bezug auf Kategorien wie Geschlecht, "race" oder sexuelle Orientierung soll in einem ersten Schritt zeigen, dass Benachteiligung wegen dieser Kategorien passiert – und nicht weil ein Mensch sich nun mal in der Öffentlichkeit dauernd so verhält, dass er ständig von der Polizei kontrolliert wird.
Das passiert schwarzen Menschen, weil sie schwarz sind. Der zweite Schritt sollte demnach sein, dass genau jene Merkmale, auf die man sich wegen der Bewusstmachung struktureller Diskriminierung bezog, irgendwann verschwinden. Dass sie als Merkmale nicht mehr funktionieren, unsichtbar werden. Genau so, wie weiße Männer als Gruppe unsichtbar sind.
Was aber, wenn das heute stärkere Bewusstsein für Diskriminierung zu vereinzelten identitätspolitischen Communities führt, die sich Unterstützung von jenen verbieten, die keine ähnlichen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben?
Was, wenn das das Ende von Solidarität ist? Genau davor warnen Susemichel und Kastner eindringlich. Solidarität sollte vielmehr die Fortsetzung von Identitätspolitik sein, für sie muss das Trennende vorübergehend überwunden werden, das ist ihre Vision. Es ist eine weit bessere als die, hinter die Errungenschaften verschiedenster Emanzipationsbewegungen zurückzugehen. (Beate Hausbichler, 29.12.2018)