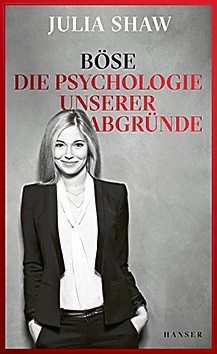War es sehr viel Stress, in einem fast 50-jährigen Akademikerleben 1700 Fachaufsätze, sieben wissenschaftliche Monografien und ebenso viele Bücher zu verfassen, die für ein interessiertes Allgemein- und Laienpublikum gedacht waren? Davor, dazwischen, daneben Vorlesungen zu halten? Und, Grundlage alles dessen, sich durch wahre Lektüregebirge zu fräsen?
Die Lebensleistung des in Wien geborenen, im ungarischen Komárom aufgewachsenen, seit 1931 im kanadischen Montreal ansässigen und lehrenden Hans (János) Selye (1907-1982) lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Stress. Stress – eine Erfindung dieses Endokrinologen.
Kein Leben ohne Stress
Stress. Verunsicherung. Unsicherheit. Das sind jene drei Wörter, die vielleicht am sinnigsten über dem Gegenwartshorizont aufscheinen. Die sofort von allen verstanden und als Leitwortmarkierungen akzeptiert werden.
Dabei ist Stress älter. Mehr als hundert Jahre alt. Der Begriff wurde 1914 von einem US-amerikanischen Physiologen eingeführt. Der k. u. k. Kanadier Selye beschrieb dann 1936 als "Stress" den Zustand des menschlichen Körpers im Stadium der Belastung infolge Anspannung und des Widerstands gegen Stressoren, stressauslösende Bündel äußerer wie innerer Faktoren.
Heute wird ein sehr breites, kaum einhegbares Spektrum identifiziert: von Lärm über Überforderung durch Hyperperfektionismus bis zur Langeweile, von Versagensangst über Mobbing bis zur Überlastung durch zu viele Aufgaben, Unterforderung und Dauerkonflikten in der Paarbeziehung.
Stress ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Und wird völlig gedankenlos verwendet – und ohne jedes ehrende Gedenken an Selye, der 1957 das Buch "Stress beherrscht unser Leben" herausbrachte.
Leben ohne Stress, ohne Reaktion auf Belastung, schreibt Achim Peters in "Unsicherheit", ist schlechterdings nicht vorstellbar. Und nicht möglich. Denn dieses Phänomen ist, so sein treffender Untertitel, das Gefühl unserer Zeit. Stress kann gut sein, Dynamik verleihen, kann antreiben und so kurzfristig ein gutes Selbstwertgefühl bewirken. Im Gegensatz zu tolerierbarer und am Ende toxischer Überlastung, die nicht nur den Selbstwert, sondern auch die Gesundheit einschränkt und unter Umständen letal endet. Stress ist also von großer Komplexität.
Dieser Gemengelage widmet sich der Mediziner und Endokrinologe Achim Peters, der an der Universität Lübeck der Forschungsgruppe "Selfish Brain" vorsteht. So manches über den Brain-Pull und den wissenschaftlich mittlerweile fallengelassenen Brain-Push, die Versorgung des Gehirns mit Glukose und Energie, las man schon 2011 in Peters' "Das egoistische Gehirn. Warum unser Kopf Diäten sabotiert und gegen den eigenen Körper kämpft".
Bereits damals nahm er eine die Adipositas, Fettsucht, betreffende biologisch-physiologische Position ein. Und blendete damals – und macht das noch heute – den Umstand aus, dass auch frühere Generationen Stress hatten, teils existenziellen, Überlebensdruck. Und eben nicht übergewichtig wurden, ganz im Gegenteil. Ernährung in Überflussgesellschaften wird von Peters zugunsten der Sozialmedizin eher ausgeblendet.
Stress erzeugt Unsicherheit. Und er folgt aus Unsicherheit. Veränderungen lassen sich dennoch einleiten, "habituieren", wenn der Anspruch also auf subjektiv erträgliches Niveau gesenkt wird. Das zeigt Peters auf, indem er auf Philosophie und Wahrscheinlichkeitstheorie eingeht, auf Neurologie, Physiologie und Psychotherapie.
Über weite Strecken ist der Band erhellend, auch wenn der Lübecker eine ausgeprägte Vorliebe für Flachheit, fatal verunglückte Bilder und mehr als nur leicht hinkende Vergleiche an den Tag legt. Lediglich im Schlusskapitel, wo er auf die "Dunkle Triade" von Manipulatoren, Lügnern, Scharlatanen eingeht und übers Entrümpeln der Psyche und das Entsorgen der Sorgen schreibt, wird er unverbindlich bis impressionistisch undeutlich.
Hier wünschte man sich entschieden stärkere Gegenwartsbezüge. Desgleichen hätte das Lektorat Peters' Vorliebe für Anglizismen einhegen können. Wenn ausdauernd die Rede von "Updates" des Gehirns und des Verhaltens ist, später unvermutet "likelihood" aufscheint, mutet dies doch gestresst kosmopolitisch an.
Ich, Du, das Trauma
Wer bin Ich? Wohlgemerkt: Ich mit großem Anfangsbuchstaben! Was will Ich, und ich? Was verbindet mich mit den Mitmenschen? Gibt es ein "Wir", das es wert ist, dass ich mich für eine Gemeinschaft einsetze? Scheu vor diesen großen Fragen hat Franz Ruppert, psychologischer Psychotherapeut und Professor an der katholischen Stiftungshochschule in München, sichtlich nicht. Im Gegenteil. Gleich zu Beginn seines Buches liest man ebendiese Fragen. Die übrigens ganz nach der Individualpsychologie des Wieners Alfred Adler klingen, ohne dass Ruppert auf ihn verweist.
Gegenfrage: Gibt es nicht viel mehr Destruktivität heute, Bedrohung, Unsicherheit, viel mehr Konflikte denn jemals zuvor, die die Seelen verheeren? Wenn Menschen traumatisiert sind, wenn viele von ihnen innerlich in Täter-Opfer-Dynamiken feststecken, dann werden auch menschliche Kollektive zu traumatisierten und traumatisierenden Gesellschaften. Erkennungszeichen sind ähnlich wie beim Einzelnen, bei dem sich Traumatisierungen körperlich und psychisch und in Trauma-Überlebensstrategien niederschlagen.
Permanente Ausgesetztheit
Die Symptome sind hinlänglich bekannt: Gewalt, Depressionen, Angst, Stress, Konkurrenzdruck, Verwahrlosung. In kranken Systemen gefangen, finden es Menschen normal, ja akzeptieren es, als Trauma-Täter zu handeln. Die Opfer treiben sich, eine sich bestätigende Regel, selbst mitleidlos an. Ein Lebensgefühl permanenter Ausgesetztheit führt zu Unruhe, Hyperaktivität, Maladie.
Wie ein Ausstieg daraus gelingt – und auch, wie er nicht gelingt -, zeigt Ruppert verständlich auf. Er lädt hie und da zum Dialog ein, auch zum Widerspruch. Ein Band, der Hoffnung macht, ohne blauäugig optimistisch zu sein, ohne sich in künstlichen Welten hybrider Komplexität zu verlaufen: "Unsere Psyche ist in beständiger Entwicklung begriffen. Sie ist selektiv auf unsere Bedürfnisse hin ausgerichtet, sie kann sich gut an äußere Umstände anpassen und sie ist kreativ, das heißt, sie kann auch immer wieder neue Lösungen für praktische Probleme finden. Die Vorstellung, psychische Krankheiten seien nicht zu verändern, weil genetisch bedingt, gehört in das wissenschaftliche Antiquariat."
Böse Fragen lösen
2016 war "Das trügerische Gedächtnis" der deutsch-kanadisch-englischen Rechtspsychologin Julia Shaw, damals 29, ein internationaler Bestseller. Nicht immer aber folgt ein Zweitbuch innerer Logik – stattdessen manchmal den Erwartungen des Buchmarktes.
In acht Kapiteln beleuchtet nun Shaw die Kreise des Bösen. Besser gesagt: Sie flaniert entspannt und schreibt im Plauderton über Serienmörder, Cybertrolle, Zoophilie und Psychopathie, über toxische Männlichkeit und Vergewaltigungskultur, moralische Blindheit und Terrorismus.
Sie plädiert für ein grundsätzliches Verstehenwollen des Bösen. Dafür zitiert sie die einschlägigen Studien von Stanley Milgram bis zu Philip Zimbardo, der mit dem Stanford-Prison-Experiment bis heute am nachhaltigsten vor Augen führte, wie schnell eine Transformation sich vollziehen kann in Richtung Sadismus und ausgelebtes böses Verhalten, wenn es die Umstände ermöglichen und befördern. Man braucht nur einem Einzigen ein wenig Macht über andere verleihen.
Das ist aufschlussreich, phasenweise. Doch vor allem gegen Ende breiten sich intellektuelle Durststrecken aus. Es reckt ein hehrer politischer Aktivismus das Haupt. Bei vielem werden viele widerspruchslos nicken, einige davon, weil sie sanft entschlummert sind. Zu oberflächlich, zu wenig historisch kundig ist es ausgefallen.
Wenn man für den nächsten Smalltalk die Bücher des Leichtphilosophen Richard David Precht nicht bei der Hand hat, dann ersetzen sie ein, zwei Sätze Julia Shaws umstandslos. Fällt am Ende einem doch Manfred Krugs "Optimistisches Lied" auf, in dem es heißt: "Trink zwei Bier / Schnapp Dir 'n Klavier / Lass Dir sagen: Alle Fragen sind zu lösen / Auch die ganz bösen." Getextet und gesungen 1967, vier Jahre nach dem Eichmann-Prozess.
Wie seelische Belastungen bewältigen? Wirklich und richtig? Darüber schreibt Whitney Hugh Missildine sachlich und informativ. Seelischer Druck respektive Überdruck lässt sich korrigieren, wenn man weiß, woher er kommt, wo die Quellen sind. In der Kindheit. Und mitten hinein in die Kinderpädagogik und Kinderpsychotherapie zielt "In dir lebt das Kind, das du warst".
Nachdruck
Doch richtig neu ist Missildines Buch keineswegs. Im Impressum findet sich kein Hinweis darauf, dass die preisgünstige Paperbackedition ein unveränderter Nachdruck der neu übersetzten, überarbeiteten 18. Auflage von 2008 ist. Die ihrerseits die erste deutsche Übertragung von 1976 ersetzte. Da hatte die Monografie schon dreizehn Jahre auf dem Buckel. Die US-amerikanische Ausgabe erschien 1963, als Missildine (1915-1986) schon seit vielen Jahren Professor für Psychiatrie an der Ohio State University in Columbus, Ohio, war.
Nur hat die Innere-Kind-Arbeit in der Therapie in den letzten zehn bis fünfundzwanzig Jahren beträchtliche Fortschritte gemacht. Wäre es eine allzu große seelische Belastung des Verlags gewesen, dem Buch ein Nachwort beizufügen, das den aktuellen Stand umreißt? Oder statt am Ende fünf Seiten mit Verlagswerbung zu füllen, eine Auswahl an Leseempfehlungen jüngeren Datums zusammenzustellen? (Alexander Kluy, 29.12.2018)