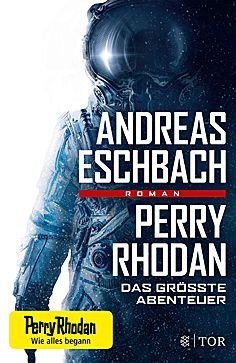
Andreas Eschbach: "Perry Rhodan. Das größte Abenteuer"
Gebundene Ausgabe, 848 Seiten, € 25,70, Fischer Tor 2019
Vor kurzem war es also so weit: Die "Perry Rhodan"-Serie hat ihren 3.000. Roman hervorgebracht. Und da sind Nebenserien und Taschenbücher nicht einmal mitgerechnet, nur das seit 1961 ohne Unterbrechung im Wochentakt erscheinende Fortsetzungsabenteuer der längst zum geflügelten Wort gewordenen "Erstauflage". Aus Anlass des Jubiläums hat sich das monumentalste SF-Franchise im Sektor Literatur etwas Besonderes gegönnt.
Perry – Jungenjahre eines Universalerben
Dass PR-Erzählungen außerhalb des Stammhauses Pabel-Moewig erscheinen, ist per se noch nichts Neues. So wird beispielsweise im April eine neue Taschenbuch-Trilogie bei Bastei Lübbe starten. Andreas Eschbachs ultrafetter – und doch höchst vergnüglich zu lesender – Wälzer "Perry Rhodan. Das größte Abenteuer" fällt jedoch aus dem Rahmen. Er ist keinem Handlungszyklus der Serie entsprungen, sondern gewissermaßen die Vorgeschichte zu allem. Eschbach, der selbst schon einige Gastbeiträge für die Serie geschrieben hat, liefert uns hier die Biographie Rhodans, ehe dieser zum "Erben des Universums" wurde – und schließt damit eine erstaunliche Lücke.
Dem einen oder anderen mag sich da vorab die Frage aufdrängen, wie kanonisch ein solches Werk sein kann. Nun, ich bin nicht der pferdeschwänzige Comicverkäufer der "Simpsons", kann also nicht sagen, ob nicht irgendwo auf Seite XX von Band XXYX eine Anmerkung stand, die sich mit einem Detail Eschbachs beißt. Und möglicherweise habe ich auch mal ein gut verstecktes Easter Egg übersehen. Doch soweit sich die Angaben auf der Perrypedia nachprüfen lassen, hat Eschbach einen äußerst sorgfältigen Job gemacht. Und Hand aufs Herz: Wer will schon der pferdeschwänzige Comicverkäufer der "Simpsons" sein?
Streifzug durch die Zeitgeschichte
Die Biographie geht bis zu Rhodans Geburt im Jahr 1936 in Connecticut zurück, oder genauer gesagt sogar bis zu den Vitae von dessen Großeltern. Wir lesen von Perrys frühem Interesse für Astronomie und Science Fiction – und vom allerersten Titel, den er lange vor solchen wie "Großadministrator" oder "Ritter der Tiefe" erwarb: Klassensprecher. Dass er sich in dieser Zeit mit dem schwarzen Jungen Leroy Washington anfreundet, wird das Thema Rassismus einläuten, das sich durch Eschbachs ganzen Roman zieht. Zwar bei weitem nicht so konsequent wie in Mary Robinette Kowals "The Calculating Stars", und doch finden sich hier bemerkenswerte Parallelen: Denn auch hier verbindet sich der Wunsch nach Gleichstellung aller mit dem Pioniergeist des frühen Weltraumzeitalters – und all das vor dem Hintergrund einer Alternativweltgeschichte, zu der ja auch die PR-Serie mit dem einst für 1971 antizipierten Mondflug Rhodans nachträglich geworden ist.
Da diese Gabelung aber erst relativ weit hinten in Eschbachs Buch auftritt, ist es für lange Zeit auch ein Streifzug durch die Zeitgeschichte. Wir sind – parallel zu Rhodans Karriere von der Militärschule über West Point bis hin zur Ausbildung zum Piloten und schließlich zum Raumfahrer – mit unserer Hauptfigur bei einer ganzen Reihe zentraler Ereignisse des 20. Jahrhunderts dabei. So nimmt Rhodan an Martin Luther Kings Marsch auf Washington teil, wird in den Vietnamkrieg geschickt und mischt sogar bei den Pariser Studentenunruhen von '68 mit. Eschbach rattert aber nicht einfach irgendwelche historischen Daten runter, er gibt uns auch ein Feeling für die Epoche: Sehr schön etwa die Episode, in der Rhodans Vater das erste Rundfunkgeschäft im heimatlichen Kaff aufmacht und sich vor dem Schaufenster flugs Menschentrauben zum "Public Viewing" ansammeln – so sensationell war ein Fernseher 1946 noch.
Der geheimnisvolle Biograph
Eingebettet wird die Erzählung in eine Rahmenhandlung, die noch einmal die Ereignisse schildert, mit denen die PR-Serie 1961 im Roman "Unternehmen Stardust" begann: Nämlich wie Rhodan 1971 zum Mond flog, dort ein Raumschiff von Außerirdischen entdeckte und mit deren Technologie den Atomkrieg verhinderte. Diesmal erleben wir das aber aus einer neuen Perspektive mit – nämlich aus der des launigen Biographen, der Rhodans Lebensweg hier immer wieder mit Gelegenheiten zum Schmunzeln sprenkelt (so lesen wir etwa, dass Rhodans erster Eindruck von seinem jahrtausendelangen Weggefährten Reginald "Bully" Bull der eines rothaarigen Giftzwergs mit Ehrgeizproblem war).
Es ist ein annähernd allwissender Erzähler, der Dialoge, bei denen er nicht dabei war, ebenso wiedergibt, wie er fließend in historische Exkurse überzuleiten versteht. Und natürlich drängt sich rasch die Frage auf, wer es denn sein mag, der da schon bei Rhodans erster Großtat live dabei war und offensichtlich auch Ereignisse, die erst Jahrtausende später stattfinden werden, aus persönlicher Erfahrung kennt. Ich spoilere nicht den Namen, doch jeder, der auch nur irgendwann PR gelesen hat, wird es zügig herausgefunden haben – und nach 200 Seiten offenbart er sich dann auch für die anderen.
Ein nettes Detail übrigens: Unser Erzähler verwendet altbackene Phrasen wie "Verfasser dieser Zeilen" oder "geneigte Leserschaft", die auch im Journalismus gelegentlich noch auftauchen und bei denen ich mich jedesmal vor Schmerzen krümme. Doch sie passen zur Person des Erzählers – sind also kein stilistischer Schwächeanfall Eschbachs, sondern vielmehr eine Bestätigung für dessen Liebe zum Detail.
Empfehlung, nicht nur für PR-Fans!
Stellvertretend für das über die Jahrzehnte stark schwankende Image der PR-Serie an sich, wird auch die Figur Rhodan thematisiert, die je nach Phase und Autorengeneration mal interstellarer Hippie, mal De-facto-Diktator war (aber immer Abenteurer). Eschbach hat dabei einen ziemlichen Seiltanz zu bewältigen. Auf der einen Seite lässt er seinen Erzähler Ansätze zur Entmystifizierung einbringen – etwa wenn er Klein-Perry ein ungewöhnlich gewöhnliches Baby nennt oder später kleine Spitzen in Richtung Rhodans Vaterqualitäten setzt (was Altfans als Nebeneffekt ganze Handlungszyklen vor dem geistigen Auge vorüberziehen lassen dürfte).
Auf der anderen Seite stehen aber auch klare Tendenzen zur Überhöhung: Sei es, dass sich schon früh in Rhodans Leben übernatürliche Wesen manifestieren, die seine spätere "Bestimmung" bereits kennen. Oder sei es seine legendäre Gabe als "Sofortumschalter", die ihm einen offenbar in der ganzen Mächtigkeitsballung von ES einzigartigen Blick hinter die Wirklichkeit ermöglicht. So reihen sich letztlich eine Ruhmestat und eine richtige Entscheidung an die andere – aber so ist das halt mit Helden. Selbst oder gerade mit denen wider Willen.
Als einzige Schwäche bleibt das Ende, das nicht wirklich einen spektakulären Schlusspunkt setzt, sondern eher ausplätschert. Eschbach streift noch überblicksmäßig diverse Geschehnisse aus den frühesten Heftromanen, ehe er ein Ereignis an den Schluss setzt, das epochal zu sein versucht, es aber nicht wirklich schafft. Aber naja, viele große Popsongs enden nicht mit einem Schlussakkord, sondern bloß mit einem Fade-out. Das sollte das Lesevergnügen aber nicht schmälern: Selbst 800+ Seiten können wie im Flug vergehen!
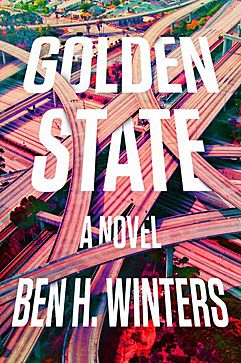
Ben H. Winters: "Golden State"
Gebundene Ausgabe, 324 Seiten, Mulholland Books 2019, Sprache: Englisch
Oft ist es gerade "Science Fiction ohne Spezialeffekte" – etwa China Miévilles "Die Stadt & die Stadt" oder Robert Charles Wilsons "The Affinities" –, die uns die größten Mindfucks beschert. Was einen im Grunde gar nicht überraschen sollte: Anstatt mehr oder weniger fantasievoller Technologien und Aliens sorgt in solchen Erzählungen eine andere Art des Denkens für den Fremdheitsfaktor – und das kann zu mindestens so exotischen Resultaten führen wie jede quantenphysikalische Zauberei.
"Golden State" ist so ein Buch, und es kommt von einem Autor, der sich schon sehr bewährt hat: Von Ben Winters stammen die "Last Policeman"-Trilogie (leider eine der vielen Reihen, von denen nur der erste Teil ins Deutsche übersetzt wurde) und der großartige Alternativweltroman "Underground Airlines". Winters' jüngstes Werk "Golden State" dreht sich um einen Staat, der jede Form von Lüge unter Strafe gestellt hat und seine Bürger zur "objektiven Wahrheit" verpflichtet. "It's not a matter of opinion. It is part of what is Objectively So." (Man beachte die Großbuchstaben.)
Der Wahrheit verpflichtet
Überwachungskameras sind im Golden State, der in etwa dem alten Kalifornien zu entsprechen scheint, nicht nur im öffentlichen Raum omnipräsent, sondern sogar daheim in der Toilette montiert. Jeder Bürger notiert vor dem Schlafengehen penibel alle Interaktionen, die er im Verlauf des Tages mit anderen hatte, sowie sämtliche anderen objektivierbaren Fakten in seinem Day Book. Nach seinem Tod wird das Buch wie das von jedem anderen in ein immer größer werdendes staatliches Archiv überführt, damit nur ja keine Information aus der Welt verschwinden kann. Everybody builds reality together.
Mit den Speculators ist eine Spezialtruppe der Polizei mit dem Aufspüren von Lug und Trug befasst. Und Winters hat damit wie schon im "Last Policeman" die Möglichkeit, einen Gesetzeshüter, der seinen Beruf sehr ernst nimmt, als Hauptfigur zu bringen – im konkreten Fall haben wir es mit dem 54-jährigen Laszlo Ratesic zu tun. Wir lernen ihn kennen, als er in einem Diner eine Dissonanz im Hintergrundrauschen des Stimmengewirrs empfindet, wie ein Spürhund Witterung aufnimmt – und tatsächlich jemanden aufstöbert, der gerade eine Lüge von sich gegeben hat. (Die Wahrnehmungen der Speculators werden uns an mehreren Stellen geradezu übersinnlich anmuten.)
Es folgt eine Verhaftung und die nüchterne Prognose, dass dem Missetäter bis zu neun Jahre Haft drohen – für eine Lüge in rein privatem Kontext, die – um das Maß vollzumachen – sogar gutgemeint war und jemand anderen schützen sollte. Mit diesem Ereignis, das vollkommen unserem Verständnis von falsch oder richtig widerspricht, lernen wir also die fremdartige Philosophie des Golden State kennen und sind von Anfang an gefesselt.
Police Procedural und Science Fiction
Was die Handlung betrifft, stützt sich "Golden State" weitgehend auf das gute alte Police Procedural: Laszlo erhält mit der jungen Aysa Paige eine Partnerin aufs Auge gedrückt, die er anfangs nur widerwillig akzeptiert, deren ermittlerisches Talent er aber bald zu respektieren lernt. Gemeinsam haben sie einem Fall nachzugehen, der auf den ersten Blick nach reiner Routine aussieht – ein Dachdecker ist in den Tod gestürzt –, im Lauf der Zeit aber immer weitere Kreise zieht und schließlich an den Grundfesten der Gesellschaft selbst rütteln wird.
Im Nachlass des Dachdeckers findet Laszlo übrigens einen als Wörterbuch getarnten Roman. Fiktion ist im Golden State verboten – also reagiert Laszlo zunächst erschrocken, erliegt aber schließlich der Faszination und beginnt zu lesen. Natürlich lässt uns das sofort an Guy Montag aus "Fahrenheit 451" denken, doch sollte man die Hommage nicht überbewerten. Winters' Roman bleibt im Polizei-Genre, wenn auch die Ermittlungsmethoden hier oft etwas ungewohnt sind.
Speculators heißen die Wahrheitspolizisten nämlich wegen ihrer zweiten Aufgabe: Hypothesen zu Motiv und Tathergang zu entwickeln ... was sie aber nur hinter verschlossenen Türen quasi unter Laborbedingungen tun dürfen. Schließlich ist der Fantasie freien Lauf lassen ein "Gefahrenjob" wie Giftmüllentsorgung. Winters versteht es also, der Wahrheitsmanie durchaus komische Aspekte zu entlocken – ein anderer wäre das Höflichkeitsritual, mit dem man sich im Golden State anderen Menschen vorstellt: Man sagt einander die Uhrzeit oder rattert apropos of nothing irgendwelche objektiven Wahrheiten runter – die Erde kreise um die Sonne, 10 sei die Hälfte von 20 und so weiter, erst dann beginnt das eigentliche Gespräch.
Der Elefant im Raum
Nichtsdestotrotz haben wir es mit einer Dystopie zu tun. Doch beschreibt sie eine Gesellschaft, die uns bald weniger Angst macht, als sie uns leidtut. Und nicht nur, weil in dieser DDR-grauen Welt nur ausgewählte Bilder von Überwachungskameras im Fernsehen laufen und Buchtitel wie "Flat Facts for Everyday Use" die einzige Lektüre sind. Je mehr wir von dieser Gesellschaft lesen, desto panischer wirkt ihr Festhalten an der Wahrheit auf uns: We have to defend the world, because the world is all we have. We have to keep things good and true because the good and true world is all we have.
Und damit kommen all die Fragen ins Spiel, die den Roman so spannend machen: Was war vor dem Golden State und aus welchem Trauma heraus ist er entstanden? Was liegt in der angeblichen Wildnis außerhalb seiner Grenzen, in die unheilbare Lügner verbannt werden? Ist "State" überhaupt im Sinne von "Staat" gemeint oder bezieht es sich eher auf einen bestimmten (Geistes-)Zustand? Die Bürger scheinen es bis zu einem gewissen Grad zu wissen, doch verdrängen sie es, wie die Bewohner von Besźel und Ul Qoma in "Die Stadt & die Stadt" die jeweils andere Hälfte "nicht sehen". It is not known and not knowable, lautet bei Winters der Stehsatz, mit dem das Verdrängen begründet wird. Da steht ein riesiger Elefant im Raum, und wir Leser rätseln über dessen Natur.
"Golden State" ist ein zu hundert Prozent faszinierender, wenn auch nur zu neunzig Prozent gelungener Roman. Einige zunächst vermeintlich unwichtige Details erlangen im späteren Verlauf plötzlich noch ungeahnte Bedeutung, was immer ein Zeichen für eine gute Konstruktion ist. Umso auffälliger wirkt es dann aber, wenn andere Elemente ohne Erklärung bleiben. Und auch das geschieht hier (ich will sie allerdings nicht spoilern). Darum der zehnprozentige Abzug – aber auch diese kleine Last ändert nichts daran, dass sich "Golden State" ein Ticket für das nächste Jahres-Best-of bereits gesichert hat.

Frank Hebben: "Vampirnovelle"
Broschiert, 240 Seiten, € 15,40, Begedia 2019
1987 brachte Kathryn Bigelow mit ihrem Film "Near Dark" ein etwas anderes Vampir-Bild in den Mainstream ein: Statt Cape-tragender europider Aristokraten waren ihre Blutsauger räudige Outlaws. Das hat im Genre durchaus Vorbildwirkung gehabt – wenn auch leider nicht so prägende wie die bleiche Bettwanze Edward aus dem "Twilight"-Franchise. Nach diesem ... Meilenstein haben Buchhandlungen "Vampire" als eigenes Phantastik-Subgenre neben Fantasy, SF und Horror geführt (was Bram Stoker wohl dazu gesagt hätte?), so übermächtig war die Romantasy-Welle. Bei neutraler Betrachtung muss man allerdings konstatieren, dass auch das irgendwann mal eine innovative Neudenkung des guten alten Vampirmotivs war.
Eine weitere kommt nun von Frank Hebben – was mich anfangs etwas überrascht hat, sogleich gefolgt von der Frage: warum eigentlich? Mit Blick auf die inhaltliche Bandbreite, in der Hebben bisher in der Rundschau vertreten war – zwischen Titeln wie "Prothesengötter", "Der Algorithmus des Meeres" und "Die Fugen einer Stadt" liegt ein weites Land – sollte man das Unerwartete ganz unbedingt erwarten.
Ohne jede Romantik
Hebbens Ansatz läuft kurz gesagt auf Totalentmystifizierung hinaus. Und das bedeutet mehr als nur die offensichtliche Herangehensweise, dem Ganzen eine naturwissenschaftliche Erdung zu geben. Vampirismus ist hier eine Infektionskrankheit, die dem Befallenen zwar einige Vorteile (unter anderem die Lebensverlängerung) beschert. Allerdings löst die Erkrankung auch eine Mangelerscheinung aus, die sich nur in Schach halten lässt, wenn der Betroffene seinem Körper regelmäßig frisches Blut zuführt. Religion und sonstiger Hokuspokus haben in einem solchen Szenario nichts zu suchen. Vampire vergehen auch nicht gleich in einer Waberlohe, sobald ein Sonnenstrahl auf sie trifft, und natürlich haben sie wie jedes andere feststoffliche Objekt ein Spiegelbild.
Das ist so weit noch nichts Neues. Viel mehr als solche Oberflächlichkeiten interessiert Hebben jedoch, was ein potenziell ewiges Dasein – und ewiges Gleichbleiben – mit dem Betroffenen macht. Die Autorin Karla Schmidt fasst eine solche Existenz im Nachwort zu Hebbens "Vampirnovelle" schön nüchtern zusammen, wenn sie schreibt: Letztlich ist es langweilig, und irgendwann fängst du an, nach Sinn zu suchen und gerätst in eine naturgemäß ziemlich ausgedehnte Midlife-Crisis.
Das führt uns Hebben anhand der Hauptfigur Martin, des ungenügenden Sohnes eines Konzernchefs, und seiner kleinen Clique von Freunden vor, die zusammen ein spektakulär unspektakuläres Vampirleben führen. Sie stehen im Stau, hängen in Bars ab, essen Nutellabrote, spülen das Geschirr, werfen Drogen ein und füttern die Vampirkatze. Ein vollkommen banales Durch-die-Tage-Driften, gelegentlich unterbrochen von einem schockierend beiläufig abgewickelten Mord, um an frisches Blut (und übrigens auch Fleisch) zu gelangen.
Alles so egal
Halbherzig hadert Martin mit seinem Dasein. Obwohl an Jahren nicht mehr der Frischeste, hält er sich immer noch für einen jungen Rebellen und mokiert sich über die "stumpfen" Normalbürger – eine ironische Pointe, denn stumpfer als das Dasein von Martin & Co kann ein Leben kaum sein. Ist dir alles so egal, was? – Dir etwa nicht? Martin ist sich dieses Widerspruchs auch durchaus bewusst, er hat nur – zumindest fürs Erste – nicht die Energie, etwas daran zu ändern. Dass die Novelle in Ellipsen und als Abfolge von lose aneinander gerückten Eindrücken erzählt wird, unterstreicht formal, wie in Martins Gedanken das große Ganze fehlt, das alles zusammenhalten würde. Kurz: der Sinn.
Ruth trägt ihre Punkkluft, die Haare feuerrot, und Ava hat sich als Emo verkleidet, ach nein – sie meint: Wir müssen ins "Mellow"! – Was ist das? – Ne Szenebar. – So eine hirnlos gentrifizierte Kneipe, die auf vegan und schick macht? – Retro. Und es gibt Erdnüsse. – Gekauft, ruft Ruth das nächste Taxi herbei. 19:36 Uhr.
Das liest sich nicht so ganz unbekannt. Es erinnert mich stark an Literatur, die ich in den 90ern – vor meiner Rückkehr in die Science Fiction – gelesen habe. Dem Studium geschuldet, waren es damals hauptsächlich schwedische und norwegische Autoren. Kurz danach sollte aber auch im deutschsprachigen Raum die große Popliteratur-Welle anrollen, die mir Hebbens "Vampirnovelle" stark beeinflusst zu haben scheint.
Wohin führt der Weg?
Damit birgt Hebbens Erzählung den gleichen Fluch und Segen wie besagte Bücher von damals: Kurzfristig, ein Buch lang, las sich die aggressiv nach außen getragene Ziellosigkeit solcher Protagonisten – Vampire sind eigentlich eine gute Metapher für sie – beeindruckend, weil aus dem Leben gegriffen und voll authentisch wirkend. Auf Dauer, also spätestens ab einer Fortsetzung, gingen sie mir dann aber stets gewaltig auf den Zünder, weil unterm Strich arschunsympathisch. Und die waren nicht mal Serienmörder wie Martin und seine Freunde!
Die "Vampirnovelle" ist jetzt ein Buch und damit wie seine Vorläufer aus den 90ern noch auf Status beeindruckend. Bei einer etwaigen Fortsetzung – und am Schluss überschlagen sich die Ereignisse derart, dass eine Fortsetzung durchaus denkbar wäre – bin ich mir nicht so sicher, ob ich diesem Martin noch einmal folgen möchte. Aber wer weiß, Hebben könnte sogar das schaffen.
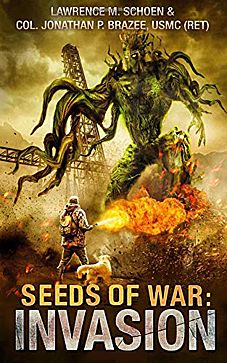
Jonathan P. Brazee & Lawrence M. Schoen: "Seeds of War: Invasion"
Broschiert, 162 Seiten, Semper Fi Press 2018, Sprache: Englisch
SF-Conventions bringen die Leut z'samm – und hier sorgten sie für eine besonders unwahrscheinliche Paarung, die durch die gemeinsame Liebe zu gutem Essen und zur Science Fiction im Allgemeinen zustande gekommen ist. Auf der einen Seite hätten wir den Kognitionspsychologen (und Klingonen-Experten) Lawrence M. Schoen, der in der Rundschau schon mit den wunderbar feingeistigen "Barsk"-Romanen vertreten war. Und auf der anderen Seite Jonathan P. Brazee, einen Veteranen der US-Marineinfanterie, der sich seinen vollständigen militärischen Rang auf die Cover seiner Bücher drucken lässt. Welche in hohem Takt in Brazees Eigenverlag mit dem bezeichnenden Namen Semper Fi Press erscheinen und – wenig überraschend – allesamt der Military SF angehören.
Rechnet man all die genannten Faktoren zusammen, konnte eigentlich nur so etwas wie "Seeds of War" dabei herauskommen: ein zwar eindeutig pulpiges, aber deswegen nicht dummes Abenteuer, das zu unterhalten versteht – in Form einer globalen Schlacht im Gemüsebeet.
Ein altes Schlachtross bäumt sich auf
Auf der terraformierten Agrarwelt Vasquez wird Nahrung für die interstellare Republik der Menschheit angebaut, die sich anscheinend im Dauerkriegszustand befindet und entsprechend hungrig auf Nachschub ist. Hier lebt Marine Lieutenant General Colby Edson, nachdem er seine militärische Karriere beendet hat, und betreibt im Alleingang eine der durchautomatisierten Mega-Farmen, die den Planeten prägen. Dass man das Haus der Nachbarn gerade noch am Horizont erkennen kann, ist dem einzelgängerischen Colby nur recht. Als Gesellschaft reicht ihm seine Hündin Duke voll und ganz. Und wenn er neben der Farmarbeit mal einen Moment der Selbstreflexion braucht, dann kann er ja – nettes Detail – die "I Love Me"-Wand in seinem Haus betrachten, auf der seine Auszeichnungen und das ganze übrige Kriegslametta hängen.
Eines Tages allerdings ist es mit der Routine vorbei. Zwischen den Nahrungspflanzen keimen plötzlich unbekannte Gewächse, die mit erschreckender Geschwindigkeit in die Höhe schießen und dann auch noch wie Triffids auf ihren Wurzeln zu laufen beginnen. Rasch wird Colby klar, dass er es mit einer waschechten biologischen Invasion zu tun hat. Das Haus der Nachbarn wurde über Nacht zerstört, über Funk meldet sich niemand mehr – anscheinend ist der ganze Planet betroffen. Also schlüpft Colby von seinen pinken Joggingshorts zurück in den alten Kampfanzug, bastelt Bomben aus Dünger und rückt den invasiven Gewächsen mit dem Flammenwerfer zu Leibe.
Die andere Seite
Zwischen den Kapiteln um Colbys Abwehrkampf sind sogenannte Interludes eingeschoben, die vermutlich – da sprachlich ein Stückchen avancierter – Schoens Beitrag sein dürften. Sie schildern die andere Seite des Gemüsekriegs: Im Orbit um Vasquez versteckt sich nämlich ein Alien-Raumschiff, dessen Insasse – ein interstellarer Gärtner pflanzlichen Ursprungs – nach 200 Jahren zum Planeten zurückgekehrt ist und entsetzt feststellen muss, dass statt der fraktalen Gärten, die er konzipiert hatte, ein Netzwerk rechteckiger Felder die Welt überzieht. Also sagt er denen, die er seinerseits für biologische Invasoren hält, den Kampf an und schickt eine mörderische Saat nach der anderen auf die Oberfläche hinunter.
Der Gag an "Seeds of War" ist, dass letztlich beide Kriegsparteien Bioinvasoren sind – schließlich hatte der Planet auch mal eine ursprüngliche Vegetation. Ob nun der Gärtner kunstvolle Pflanzungen drüberstülpt oder die Menschen industrielle Landwirtschaft mit Gentechnik und Pestizidgroßeinsatz betreiben, ist da auch schon egal. Selbst in ihren Methoden unterscheiden sich die Kontrahenten nicht, immerhin denkt auch der Gärtner beim Anblick der menschlichen Spuren sofort an Ausrottung. Nicht-pflanzliches Leben (ob "meat", also tierisches, oder "mechanical") ist für ihn nur Ungeziefer.
Auf in den Kampf
Diese Relativierung veredelt eine Handlung, die sich erwartungsgemäß als Dauerkampf gestaltet und in Brazees No-Nonsense-Stil daherkommt. Schon der Romaneinstieg, der sich nachträglich als Traum entpuppen wird, ist stilistisch gesehen Military-SF wie aus dem Lehrbuch: Colby durchlebt dabei einen Einsatz, bei dem alles schiefgeht, was nur schiefgehen kann – gewissermaßen die Kriegsveteranenvariante des Traums, in dem man geht und doch nicht vom Fleck kommt:
"I need you to pull back, then create a hasty line of defense along the ridge running from zero-three-three-eight to zero-three-four-five. I'll give you air and arty support, but you need to move it now. You've got forty mikes to get into position." – Ebenso hektisch wie vergeblich versucht Colby in diesem Traum, seine Kameraden zu retten. Entsprechend witzig wirkt es, wenn er sich später mit demselben Eifer erneut in die Schlacht wirft – nur dass die Reihen der Seinen nun aus Melonen- und Maisstauden bestehen.
"Seeds of War: Invasion" verknüpft klassische Military-SF-Muster mit ein paar eher unüblichen Ideen und versteht es dadurch, den Leser bei Laune zu halten. Einziger Minuspunkt: Nach all dem grünen Getümmel kommt das Ende so unspektakulär daher wie eine eingegangene Topfpflanze. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend: Mit "Scorched Earth" und "Bitter Harvest" haben die beiden Autoren bereits zwei weitere Kurzromane folgen lassen, in denen der Kampf gegen das galaktische Gärtnerunwesen fortgeführt wird. Denn Vasquez ist nicht die einzige Welt, in der die böse Saat aufgeht ...
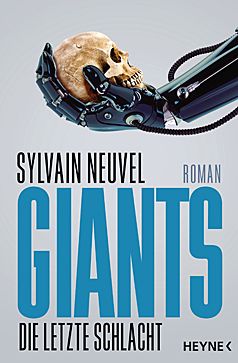
Sylvain Neuvel: "Giants. Die letzte Schlacht"
Broschiert, 480 Seiten, € 15,50, Heyne 2018 (Original: "Only Human. The Themis Files, Book 3", 2018)
Vorwarnung: Wer Sylvain Neuvels Romane "Giants. Sie sind erwacht" und "Zorn der Götter" noch nicht gelesen hat, sollte hier gleich wieder aussteigen, sonst wird er mit Spoilern konfrontiert. Und wer sie gelesen hat, der wird sich zu Beginn von "Die letzte Schlacht" trotzdem kurz fragen, ob er etwas verpasst hat und dies womöglich bereits Band 4 ist. Immerhin kehren die Hauptfiguren Rose Franklin und Vincent Couture hier von einem mehrjährigen Aufenthalt auf einem anderen Planeten zurück, von dem wir noch gar nichts gewusst hatten.
Doch nein, es ist Band 3. Er gliedert sich bloß in zwei verschiedene Zeitebenen, soferne man das bei der speziellen Erzählweise der "Giants"-Romane überhaupt so sagen kann. Wie gehabt besteht die Handlung ausschließlich aus aneinandergereihten "Files", von Tagebucheinträgen über Regierungsverlautbarungen bis zu Gesprächsprotokollen. Letztere sind eindeutig die am häufigsten verwendete Variante und wie schon in den Vorgängerbänden mit jeder Menge "Oh, Scheiße!" und "AAAAAAAHH!" so lebendig gehalten, dass man das Gefühl hat, mitten in der Handlung zu stecken.
Kurz zum Kontext
Für sein Themis-Universum (benannt nach einem der darin auftretenden Mecha bzw. Riesenroboter) hat Sylvain Neuvel einen verblüffend an "Perry Rhodan" erinnernden evolutionären Kontext geschaffen: Außerirdische haben in grauer Vorzeit die Erde erreicht und sich mit den hiesigen Urmenschen gekreuzt. Außerdem haben sie im Erdboden versteckt die Fragmente von Riesenrobotern hinterlassen, ihrer bevorzugten Waffe.
Das genetische Erbe der Vermischung sorgt nun aber für Ungemach. Auf Esat Ekt, der Heimatwelt der Außerirdischen, hängt man inzwischen nämlich einer Philosophie an, die man sich als radikale Variante der Obersten Direktive von "Star Trek" vorstellen kann. Einmischungen in andere Zivilisationen sollen nicht nur strikt vermieden, sondern – falls doch geschehen – möglichst wieder rückgängig gemacht werden. Was im Fall der Menschheit beinahe auf einen Genozid hinausgelaufen wäre: In Band 2 wurde eine neue Welle von Robotern zur Erde geschickt, um alle Menschen mit gemischtem Erbgut zu eliminieren. Erst als die Aliens bemerkten, dass das praktisch die gesamte Menschheit betreffen würde, ließen sie von ihrem Vorhaben wieder ab und kehrten nach Hause zurück – mit Rose und Vincent in ihrem Kielwasser.
Zur aktuellen Handlung
Im neuen Band finden unsere Helden nach neun Jahren Abwesenheit eine Erde vor, die sich sehr zum Schlechteren verändert hat. Mit Hilfe eines zurückgelassenen und wieder zum Laufen gebrachten Riesenroboters haben die USA reihenweise andere Staaten unterworfen. Russland zieht beim fröhlichen Okkupieren inzwischen nach, es droht ein Weltkrieg. Ebenso besorgniserregend ist aber die politische Richtung, in die sich praktisch sämtliche Staaten der Erde entwickelt haben: Von der Info über die DNA-Vermischung nervös gemacht, haben sie ihre Bevölkerungen je nach Anteil außerirdischen Erbguts in Bürger von Stufe A1 bis A5 aufgeschlüsselt. Wer hoch eingestuft ist, landet im Lager – und die "Berechnung" beruht zumindest zum Teil auf rein rassistischen Beurteilungen.
Auf Esat Ekt sieht es freilich kaum besser aus, wie wir aus den Rückblickskapiteln (bzw. Files) erfahren. Rose und Vincent mussten sich auf einer Welt einleben, in deren Ghettos es vor den Ergebnissen von Speziesvermischungen nur so wimmelt. So wie auf der prähistorischen Erde ist es nämlich auch auf zahlreichen anderen Planeten gelaufen – und die "reinblütigen" Aliens wissen nicht so recht, wie sie ihre ungeliebten Abkömmlinge am besten aus dem Verkehr ziehen sollen. Auch hier wird der Ton gegenüber ethnisch Unerwünschten rauer. Ein ungewollter Nebeneffekt der Parallele ist freilich, dass die Außerirdischen komplett den Nimbus des Geheimnisvollen verlieren, den sie in den ersten beiden Bänden noch hatten, und nun recht banal rüberkommen.
Nicht ganz auf Augenhöhe mit den Vorgängern
Irgendwann im Lauf der Lektüre ist das Buch aus dem Jahres-Best-of, für das es angesichts der formidablen Vorgängerbände ungeschaut vorgesehen gewesen war, rausgefallen. Der Grund: Es übernimmt mit der Collage-Technik zwar das formal auffälligste Charakteristikum der beiden vorangegangenen Bücher – aber nicht das inhaltlich wichtigste: den Mystery-Faktor. In Band 1 und 2 durften wir noch die ganze Zeit über die Zusammenhänge rätseln, doch inzwischen sind alle diesbezüglichen Fragen geklärt. Offen war/ist höchstens noch, wie es weitergeht. Darum ist "Die letzte Schlacht" auch nicht wirklich der Abschluss einer Trilogie, sondern schon die erste Fortsetzung einer bereits abgeschlossen gewesenen Duologie. Insofern ist es nur folgerichtig, wenn Neuvel im Nachwort andeutet, dass er in Zukunft durchaus wieder ins Themis-Universum zurückkehren könnte.
Das Rätselraten war es, was die ersten beiden "Giants"-Bücher so spannend machte. Dessen Fehlen versucht Neuvel damit zu kompensieren, dass er einen neuen Aspekt herausschält. Er geht ausführlich auf die rassistische Teile-und-herrsche-Politik ein, die sowohl auf der Erde als auch auf Esat Ekt zu Lasten ethnischer Minderheiten umgesetzt wird. Das wirkt, durch die Parallelsetzung noch einmal extra betont, ein wenig bemüht. Allerdings ist das Thema dem Autor offensichtlich ein Anliegen: Sein nächster Roman wird die Immigrationsdystopie "The Test" sein und den Aspekt in den Mittelpunkt stellen – was vermutlich eine überzeugendere Umsetzung ergeben wird als der letztlich doch eher enttäuschende Versuch, die "Giants"-Reihe in eine neue Richtung zu führen.
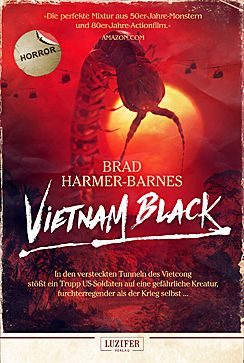
Brad Harmer-Barnes: "Vietnam Black"
Broschiert, 250 Seiten, € 13,40, Luzifer Verlag 2019 (Original: "Vietnam Black", 2017)
Beinahe hätte ich beim Durchforsten der Frühlingsbuchprogramme schon weitergeklickt, weil ich in der Romansynopsis zu "Vietnam Black" von "ausgetrockneten Leichen" gelesen und automatisch an Vampire gedacht hatte (schnarch). Dabei ist der Tausendfüßer auf dem Cover doch gar nicht zu übersehen! Und der im Buch ist ein wahres Prachtexemplar: Mehrere Meter misst der Viet Nam Den oder Vietnam Black, der im Dschungel haust und Menschen schneller zerstückelt, als sie schreien können. Sein Schöpfer Brad Harmer-Barnes steht in der langen britischen Tradition des Creature Horror und hat seine Leser unter anderem schon mit Spinnen und Riesenhaien beglückt – jetzt wird's noch ekeliger.
In der grünen Hölle
Zeitlicher Hintergrund des Romans ist der Vietnamkrieg. Den Alltag der vor Ort stationierten G.I.s bestimmen Hitze, Schlamm, giftige Tiere und Fallen des Vietcong ("Das ist Vietnam, Baby!"). Entsprechend un-pc ist der Umgangston: "Wenn Sie unbedingt in einem toten Schlitzauge rumstochern wollen, dann nur zu." Alles andere wäre aber auch vollkommen unglaubwürdig.
Als sich ein einheimischer Informant nicht mehr meldet, schickt die US-Army Sergeant Vincent Reese und Corporal Michael Hanson mit einem kleinen Trupp zu einer Aufklärungsmission in den Dschungel. Unterwegs stoßen die sieben Mann ("Charaktere" wäre zu viel gesagt) unter anderem auf ein verlassenes Panzerfahrzeug, das mit seltsamen Löchern übersät ist, und einen leergesaugten Leichnam: die ersten Vorboten des Schreckens, der ihnen noch bevorsteht. Am Zielort angekommen, finden sie sämtliche Dorfbewohner samt deren Tieren massakriert vor. Nur eine junge Frau hat überlebt und stammelt panisch vom Viet Nam Den. Leider verhindert die Sprachbarriere, dass die Soldaten mit dieser Info etwas anfangen könnten, bis das Monster – etwa zur Mitte des Romans – seinen ersten tödlichen Auftritt hat.
Was folgt, wird sich jeder in etwa zusammenreimen können. Zunehmend spannend gerät allerdings die Frage, ob am Ende überhaupt jemand das Wüten des Riesentausendfüßers überleben wird. Denn wie gehabt in solchen Monstergeschichten (bis hin zum "Weißen Hai" höchstselbst) haben wir es mit einem Metabolismus aus der Hölle zu tun: Das Tier frisst und frisst und frisst in einer Frequenz, die sich nur mit einer schweren Essstörung oder der Mutter aller Bandwürmer erklären lässt.
Unterhaltsam wie ein B-Movie
Der Blurb am Cover nennt "Vietnam Black" eine perfekte Mischung aus 50er-Jahre-Monstern und 80er-Jahre-Actionfilm, was ganz gut hinkommt – insbesondere wenn man sich den 80er-Jahre-Actionfilm als "Predator" konkretisiert. "Perfekt" ist natürlich ein ziemlich großes Wort, denn das eine oder andere sprachliche Limit ist hier schon erkennbar: sowohl beim Autor, dem die Formulierung "die feinen Härchen auf XYs Unterarmen sträubten sich" so gut gefallen hat, dass sie ständig wiederkehrt, als auch beim Übersetzer. Wie zur grünen Hölle habe ich mir zum Beispiel ein gasartiges, fragendes Kratzen vorzustellen? Alles in allem sind das aber keine großen Dinger, und es wird sich ohnehin niemand Thomas Mann erwarten, wenn Riesentausendfüßer angreifen.
"Vietnam Black" ist unterhaltsam, während es andauert, und danach umgehend vergessen – mehr will es aber auch nicht und braucht es daher auch nicht. Es ist die literarische Entsprechung eines Monster-B-Movies, das man sich im Kino oder auf Tele 5 gibt – mit dem entscheidenden Vorteil, dass man hier die billigen Tricks nicht sieht.

Dennis Ehrhardt: "Sinclair. Dead Zone"
Klappenbroschur, 462 Seiten, € 12,40, Fischer Tor 2019
John Sinclair??!? Hui, da steigen Erinnerungen an die Heftromanstände hoch, die in meiner Kindheit noch in Supermärkten herumstanden. Helmut Rellergerds alias Jason Darks Serie "Geisterjäger John Sinclair" mit dem unverwechselbaren Logo war damals ebenso omnipräsent wie "Jerry Cotton", "Perry Rhodan" & Co. Und wie PR (siehe Rundschau-Anfang) ist nun auch der auf übernatürliche Fälle spezialisierte Scotland-Yard-Mann John Sinclair zu Buchehren gekommen, die Popkultur-Aufbereitungsmaschinerie läuft auf Hochtouren. Jetzt warte ich nur noch auf eine in Leder gebundene "Mythor"-Trilogie ...
Ein Reboot soll es sein, um die immerhin bis in die frühen 70er Jahre zurückreichende Serie zu modernisieren und auch für jüngere Generationen zugänglich zu machen. Dass der neue Sinclair Altfans nicht völlig vor den Kopf stößt, dafür sorgt der Autor Dennis Ehrhardt, der zuvor schon für die aus der Serie entsprungene Hörspiel-Reihe gearbeitet hat. Kurz gesagt: Serienveteranen wird ein Wiedersehen mit alten Bekannten unter veränderten Umständen erwarten, Neueinsteiger wiederum brauchen keinerlei Vorwissen. Sie können "Sinclair. Dead Zone" – Beginn einer neuen Buchreihe – lesen wie jeden anderen Urban-Fantasy-Roman mit Horroreinschlag.
Der (Wieder-)Einstieg
Apropos Hörspiele: Da "Sinclair" nach der Buchform auch als Sextett von Hörspielen erscheinen wird, gliedert sich der Text in sechs penibel gleich lange Abschnitte. Und gleich der erste beschert uns nicht nur ein Wiedersehen mit Sinclair selbst, sondern auch mit anderen alten Serienfiguren, allen voran Sadako Shao und Gan Zuko, die ebenfalls für die Londoner Polizei arbeiten. Sie ragen allerdings höchstens eine Nasenspitze weit aus einem dichten Knäuel von Handlungssträngen und Protagonisten heraus.
Kurz die zentralen Elemente genannt: Vor den Azoren hebt eine Expedition einen großen schwarzen Steinwürfel aus dem Meer. Als eine Archäologin die unbekannten Schriftzeichen auf dessen Oberfläche berührt, hat sie eine Vision von einem mörderischen Spinnenmonster, das zur gleichen Zeit in London sein Unwesen treibt. Unsere Helden von der Polizei ermitteln anfangs noch im Drogenmilieu, aber bald werden sie sich auch mit dem vielbeinigen Scheusal beschäftigen müssen. Und irgendein Geheimbund, der die Expedition offenbar finanziert hat, ist auch noch im Spiel.
Und wie geht es weiter?
Am Ende des ersten Abschnitts ... ist der Titelheld tot, mit einem gesprengten Frachtkahn in die Luft geflogen. Überraschung! Nicht dass wir auch nur für eine Sekunde annehmen würden, dass John Sinclair für immer tot bleiben wird – das wäre für ein Reboot doch ein etwas radikaler Ansatz. Aber Leser sollten sich darauf einstellen, dass Sinclair zumindest für den Rest dieses Buchs keine Rolle mehr spielen wird, auch nicht – in Gedanken, Worten und Werken seiner Mitstreiter – indirekt.
Eine zweite wichtige Erkenntnis: Das Reboot beginnt tatsächlich bei null. Da wird Sinclair mit einem parasitären Wesen konfrontiert, das von einem Wirt zum nächsten springt – ein Motiv, mit dem jeder Horrorkonsument bestens vertraut ist und das dem versierten Geisterjäger aus der Heftromanserie erst recht bekannt wäre. Der Buch-Sinclair hingegen rätselt, warum Menschen, zwischen denen es keine Verbindung zu geben scheint, plötzlich Bluttaten begehen; auf übernatürliche Umtriebe kommt er gar nicht erst. Der "Geisterjäger" steht hier also noch ganz am Anfang seiner Karriere (und halt am Ende seines Lebens, aber das wollen wir wie gesagt nicht so wörtlich nehmen ...).
Personenstau
Und all das hat sich lediglich im ersten Sechstel des Buchs abgespielt, eine ganz schöne Ladung. Auch danach wird sich das Dickicht übrigens nicht so schnell lichten. Wir sind schon längst im dreistelligen Seitenbereich, und Ehrhardt führt immer noch neue Perspektivfiguren ein. Was vor allem daran liegt, dass er gerne "um die Ecke" erzählt: Eine konkrete Situation wird aus der Sicht von jemandem geschildert, der nur indirekt beteiligt ist (Beispiel: die Freundin eines Gangsters, der von der Riesenspinne zerstückelt wird) – gewissermaßen also einer Nebennebenfigur.
Das ist eine legitime Erzählstrategie. Da sie aber ein Mindestmaß an persönlichen Informationen über die jeweilige Perspektivfigur erfordert, sehen wir uns als Leser mit einem wahren Wildwuchs an Namen und Lebensläufen konfrontiert. Sofern nicht schon jetzt auf eine etwaige TV-Adaption geschielt wird, ließe sich das gerne etwas ausdünnen – immerhin ist "Sinclair" kein gesamtgesellschaftliches Sittenbild, sondern eine Gruselgeschichte.
Das Voranschreiten der Handlung wiederum ist spannend, aber nicht allzu schnell. "Sinclair" folgt über weite Strecken der Police-Procedural-Struktur, mit allem, was dazugehört: aufwändige Recherchen, Zeugenbefragungen, Zeugenbeseitigungen und der Verdacht, dass die eigenen Vorgesetzten die Ermittlungen blockieren. Der Horror ist lange Zeit nur Nebensache, und ein bisschen von dem Tempo, das der rasante Abschnitt 6 entfaltet, hätte auch 2 bis 5 gutgetan.
Plus und minus
Ausdrücklich positiv zu erwähnen ist, dass im Fall von Bill Conolly, einer weiteren alten Serienfigur, die Modernisierung besonders stimmig ausfällt. In den Heftromanen ein Reporter alter Schule, sieht sich Bill im Buch mit der Krise des Journalismus konfrontiert und beschließt, seine Geschichten auf einem eigenen Youtube-Kanal zu vermarkten. Wofür er allerdings erst mal die Hilfe zweier jugendlicher "Influencer" braucht, deren Follower-Zahl in keinem Verhältnis zu der ihrer Gehirnzellen steht. Da prallen zum Schreien komisch zwei Welten aufeinander, wenn Bill den beiden gehaltvollere Themen unterjubeln will: "Weiß nicht, ob das nicht unseren Markenkern verfälscht, Bruder." Und ehe wir's uns versehen, verfällt der gute alte Bill in peinlichen Jugendsprech und wettert gegen die "Mainstream-Medien".
Ausdrücklich negativ ist anzumerken, dass der – immerhin nicht allzu kurze – Roman zu keinem Abschluss findet. Es gibt nicht nur jede Menge offene Enden (unter anderem kommen neben dem Spinnenmonster noch andere Wesen zu Überraschungsauftritten, zudem erlebt Shao eine mysteriöse Verschiebung der Realität), auch formal ist hier kein Schlusspunkt gesetzt. Die Erzählung hört einfach mittendrin auf. Das ist eine ziemlich riskante Strategie des Autors: Sie könnte Leser dazu treiben, jetzt unbedingt auch das nächste "Sinclair"-Buch lesen zu müssen. Sie könnte sie aber auch zum Gedanken führen: Also, wenn jetzt womöglich jeder künftige Band ohne Abschluss bleibt, dann steige ich lieber gar nicht erst ein. Die Verkaufszahlen werden zeigen, welche Reaktion überwiegt.
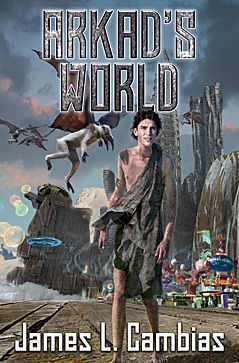
James L. Cambias: "Arkad's World"
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, Baen 2019, Sprache: Englisch
Ein buntes Planetenabenteuer mit einem sympathischen Helden, jeder Menge schrulliger Aliens und originellen Ideen (Piraten greifen mit einer Superkleber-Kanone an!) sowie der richtigen Dosis Gefühl – das ist es, was uns US-Autor James L. Cambias in seinem jüngsten Roman "Arkad's World" serviert. In der Rundschau war er vor ein paar Jahren schon einmal mit "Meer der Dunkelheit" ("A Darkling Sea") vertreten, der Geschichte eines Erstkontakts zwischen mehreren in Biologie und Mindset sehr unterschiedlichen Spezies. In spielerischer Form kehrt dieser Aspekt hier wieder.
Menschheit in der Diaspora
Zunächst zum Hintergrund: Die Erde ist vom Alien-Volk der Elmisthorn unterworfen worden, freie Menschen findet man in der Galaxis nur noch als Nachkommen von Flüchtlingen. Es ist also das klassische Szenario von der Diaspora der Menschheit. Und an dieser Stelle merkt man auch gleich den Unterschied zwischen einem seit Jahrzehnten aktiven SF-Experten wie Paul di Filippo und ... mir. Der schüttelte in seiner Rezension zu "Arkad's World" aufs Stichwort jede Menge Beispiele aus der Genregeschichte aus dem Ärmel, bis zurück zu Keith Laumers "Earthblood". Meine stärkste Assoziation war der Zeichentrickfilm "Titan A.E.".
Die Erde spielt in "Arkad's World" allerdings keine direkte Rolle. Alleiniger Schauplatz ist der Planet Syavusa, der zu keiner der galaktischen Machtsphären gehört und daher seit langem politisch Unerwünschte und Heimatsuchende anzieht wie ein Magnet. Syavusa hat mehrere Einwanderungswellen erlebt: Den Grundstein legte die mysteriöse Maschinenzivilisation, die im Roman mehrfach Thema sein wird. Auf sie folgten alle möglichen Völker, wobei drei davon – die Pfifu (an Land lebende Kopffüßer), die fledermausartigen Itooti und die Vziim (eine Art pelzige Riesenschlangen) – den Löwenanteil ausmachen und daher in der Geschichte den Großteil der Komparsen stellen. Dazu kommen Dutzende andere in kleinerer Zahl – bis hin zu einzelnen Individuen, die auf dem Planeten keine Artgenossen haben.
Arkad allein zu Haus
Ein solcher Einzelfall ist der menschliche Teenager Arkad, ein obdachloser Waisenjunge, der sich in der multikulturellen Maschinenstadt Ayaviz mit Müllsammeln und Gelegenheitsjobs durchschlägt. Alle seine Freunde (und Bandenmitglieder) gehören anderen Spezies an – doch eines Tages hört er das Gerücht, auf dem Raumhafen seien andere seiner Art gelandet. Arkad legt sich mächtig ins Zeug, um mit diesen in Kontakt zu kommen, was ihm schließlich auch gelingt. So trifft er auf den Historiker Jacob Sato, die Widerstandskämpferin Ree Bright, vor allem aber auf die rätselhafte Baichi, sein potenzielles Love Interest. Wie heutzutage in Film und Literatur obligatorisch, ist Baichi viel taffer als alle Jungs. In diesem Fall wird das Neo-Klischee aber davon abgemildert, dass Baichi ein Cyborg-Experiment der Maschinenzivilisation ist; ihre überlegene Kampfkraft hat also wenigstens eine Begründung.
Die drei sind auf der Suche nach einem der letzten Raumschiffe, das die Erde vor der Invasion verlassen konnte. Laut Jacob soll dieses nämlich etwas an Bord gehabt haben, das im Kampf gegen die Elmisthorn noch wertvoller sei als eine Superwaffe. Und möglicherweise war es das Raumschiff, mit dem Arkads Familie einst nach Syavusa kam – also lässt sich unser junger Held mit ein paar Tricks als einheimischer Guide engagieren.
Es folgt eine Queste zu Lande, zu Wasser und durch die Luft, die mit den auf Syavusa zur Verfügung stehenden Low-Tech-Mitteln absolviert werden muss. Wir treffen dabei unter anderem auf die schon erwähnten Piraten und ein tragikomisches Duo von Mad Scientists, wir erleben einen Fall von Verrat und diverse Überraschungen (etwa zu Arkads Vergangenheit, die ungewöhnlicher ist, als zu vermuten war), und auch der Planet selbst wird zu einem entscheidenden Akteur werden.
Das Leben unter den Anderen
Zentrales Element sind aber die vielen Begegnungen mit Angehörigen anderer Spezies – speziell die kindsköpfigen Itooti bringen immer wieder Leben in die Bude. Cambias hat einen ähnlichen Ansatz wie Larry Niven oder Alan Dean Foster und leitet aus den biologischen/evolutionären Grundvoraussetzungen einer Spezies kulturelle Besonderheiten ab. Das reicht bis zu unterschiedlichen Kommunikationsdesigns: Jedes Volk drückt sich auf eine charakteristische Weise aus. Die jeweiligen Idiome respektive formelhaften Sprechweisen werden vom Autor konsequent durchgezogen, sind originell konzipiert und dankenswerterweise auch nicht nervig zu lesen (ein Gegenbeispiel zum Gähnen wäre der in der SF immer wieder auftauchende Fall vom sprechenden Insekt, bei dem jedes "s" zum "zzzzzz" wird).
Obwohl "Arkad's World" in erster Linie eine spannende Abenteuergeschichte ist, kann sie aus ihrem Interspezies-Szenario veritable Momente der Weisheit ableiten. Arkad hat all die Sprachen und kulturellen Eigenheiten der ihn umgebenden Spezies von Kindesbeinen an gelernt – und das hat ihn geprägt. Obwohl er ein Leben in Armut führen musste, bedauert er bald die menschlichen Besucher von außerhalb, weil ihnen eine solche Erfahrung nicht vergönnt war: They only had other humans to talk to. It meant, he realized, that they didn't know the difference between being intelligent and being human.
Einziger Wermutstropfen an "Arkad's World" ist, dass das Buch mit dem Erreichen eines Etappenziels endet (im Gegensatz zum John-Sinclair-Roman vorhin aber wenigstens das). Das eingangs beschriebene große galaktische Szenario ist damit noch lange nicht abgehandelt: Wir dürfen davon ausgehen, dass Cambias weitere Abenteuer folgen lassen wird.
P.S.: Und der Vergleich mit "Titan A.E." war letztlich gar nicht so weit daneben.

Scotto Moore: "Your Favorite Band Cannot Save You"
Broschiert, 128 Seiten, Tor Books 2019, Sprache: Englisch
Kontraste in vielerlei Form sind es, die dieses seltsame kleine Buch prägen. Angelegt sind diese schon in der Person des Autors, einem recht bunten Vogel: US-Autor Scotto Moore kommt aus der Theaterszene, ist ein Lovecraft-Fan und hat schon eine Reihe humoristischer Bearbeitungen des Cthulhu-Mythos und anderer Phantastik-Themen abgeliefert. Daneben betreibt er verschiedene Blogs, die von Musik bis zu den Kuriositäten des Lebens ein breites Themenfeld abdecken – einer davon heißt übrigens "Things That Cannot Save You. A Catalog Of Your Doom". Und in der einen oder anderen Form wird das alles in "Your Favorite Band Cannot Save You" auftauchen.
Und so beginnt es
Hauptfigur der Novelle ist ein Musik-Blogger aus den USA – oder auch eine Bloggerin. Dank Ich-Perspektive bleiben wir über Namen und Geschlecht nämlich im Dunkeln, ich wähle jetzt einfach "er". Eines Tages findet unser Erzähler im Netz die schönste Musik seines Lebens und hört das Stück "Overture" der ihm unbekannten Band Beautiful Remorse eine Nacht lang durch, bis ihm fast die Blase platzt (wer nach dem Sound fragt: man kann ihn sich offenbar irgendwo zwischen Ambient und Shoegazing vorstellen).
Niemand kennt Beautiful Remorse, die einzige Quelle ist eine äußerst dürftige Webpräsenz auf der Seite von Bandcamp – immerhin versehen mit der Info, dass in weiterer Folge insgesamt zehn Tracks online gestellt werden sollen. Deren Titel korrespondieren mit dem immer haarsträubender werdenden Geschehen, wir wir noch sehen werden.
Mene mene tekel u-parsin
Schon bei Track 2 verfallen alle g'standenen Musikkritiker in Trance, was als erstes Vorwarnzeichen dienen sollte. Unser Erzähler lässt sich aber nicht davon abhalten, zu einem Live-Auftritt von Beautiful Remorse zu fliegen, die sich als reine Frauenband mit einer ziemlich durchgeknallten Sängerin entpuppen. Die resolute Frontfrau Airee Macpherson schwurbelt Sätze wie: "The album we're releasing is a musical incantation. It draws power virally from the psychic network of minds that are rapidly attuning their brain waves to our musical signature." Und sie erklärt nonchalant, dass sie mit Fertigstellung des letzten Tracks den Planeten verlassen und/oder unterwerfen wird.
Das sollte lächerlich klingen, doch die Band ist von immer mehr Seltsamkeiten umgeben. Und auch der Gewaltpegel steigt: Zunächst kommt es auf dem Konzert zu einer Prügelei, auf einen ersten Todesfall werden bald viele weitere folgen. Dennoch kann unser Erzähler gar nicht anders, als mit der Band auf Tour zu gehen – auch wenn er sich die bange Frage stellt, ob er noch Beobachter oder schon Komplize ist.
Zwischen den Stühlen
Wie gesagt, Scotto Moore ist Lovecraft-Fan. Die deutlichsten Parallelen weist seine Novelle aber nicht zu den Erzählungen von HPL selbst, sondern zu einer anderen Bearbeitung von dessen Stoffen auf: dem John-Carpenter-Film "Die Mächte des Wahnsinns", in dem ebenfalls ein Erzeugnis der Populärkultur die Wirklichkeit zu verändern beginnt. Und stilistisch könnte Moore von Lovecraft gar nicht weiter entfernt sein. "Your Favorite Band Cannot Save You" wird in ausgesprochen prosaischem Ton erzählt – in Kontrast zu Lovecrafts Wortbombardement, aber auch beispielsweise zu der nebelhaften Stimmung, die eine Caitlín R. Kiernan mit ihrem Zugang zum Lovecraft'schen Kosmos in "Agents of Dreamland" sprachlich heraufbeschwor.
Stattdessen herrscht hier Alltagston, der das Schaudern, das die Hauptfigur immer stärker befällt, nur bedingt an die Leser weitervermitteln kann. Garniert wird das Ganze mit gelegentlichen Pointen – etwa wenn sich die Musik-Blogger in einem Darknet treffen, als wäre man im Genre des Verschwörungsthrillers gelandet. Es sind aber auch nicht genug Pointen, um die Erzählung als humoristisch zu bezeichnen. "Your Favorite Band Cannot Save You" ist ein durchaus unterhaltsamer kleiner Happen zwischendurch, aber letztlich nicht Fisch noch Fleisch. Und auch nicht Tintenfisch.
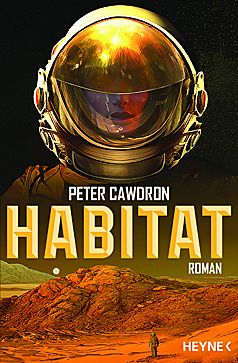
Peter Cawdron: "Habitat"
Broschiert, 350 Seiten, € 13,40, Heyne 2019 (Original: "Retrograde", 2016)
"Ich hoffe, Sie hatten an dieser Geschichte genauso viel Vergnügen wie ich", wünscht uns der neuseeländische Autor Peter Cawdron mit sonnigem Gemüt im Nachwort von "Habitat". Ja, so viel Vergnügen, wie man halt haben kann, wenn ein Atomkrieg ausbricht ...
Davon einmal abgesehen, ist "Habitat" aber tatsächlich sehr gut lesbar geworden. Es zahlt sich eben doch aus, wenn ein Werk erst mal die Redaktion eines Verlags durchlaufen hat. Peter Cawdron hat sich seine schreiberische Karriere nämlich erst einmal im Self-Publishing-System aufgebaut – und wie sehr viele andere, die diese Strategie verfolgen, binnen weniger Jahre eine hohe Zahl an Titeln auf den Markt geworfen. Dieser Roman wurde allerdings erst vom Verlag Houghton Mifflin Harcourt aufgegriffen, ehe er seinen Weg zu einer Übersetzung ins Deutsche fand.
Auf dem Planeten des Kriegsgottes
Alleiniger Schauplatz des Romans ist der Mars in naher Zukunft. Dort wurde in unterirdischen Lavatunneln die internationale Forschungskolonie Endeavour eingerichtet, bestehend aus vier Modulen: einem US-amerikanischen, einem chinesischen, einem russischen und einem multinational besetzten aus europäischen und asiatischen Staaten. Zwischen den Kolonisten herrscht bestes Einverständnis – zu Romanbeginn sitzen die Neo-Marsianer gerade gesellig beim Kartenspiel zusammen.
Bis der fröhliche Abend ein jähes Ende findet, als die Nachricht eintrifft, dass auf der Erde ein Atomkrieg ausgebrochen sein soll. Schlagartig kehrt das Misstrauen in Endeavour ein. Die Informationen von der Erde bleiben bruchstückhaft, die Kolonisten sehen in Freunden plötzlich mögliche Feinde. Man wirft sich gegenseitig vor, einander Informationen vorzuenthalten oder Daten zu fälschen. Es kommt zu rätselhaften technischen Ausfällen und schließlich auch zu den ersten Todesfällen.
Spalten oder einigen?
Im Original heißt der Roman "Retrograde", was sich auf eine altbekannte optische Täuschung bezieht: Wenn die Erde einen der äußeren Planeten überholt, der auf seiner Bahn ja langsamer unterwegs ist, scheint sich dieser für kurze Zeit rückwärts zu bewegen. Auf Deutsch spricht man von "Planetenschleifen" – der englischsprachige Ausdruck ermöglicht aber ein Wortspiel, das gut zur Handlung passt: Retrograd, also wörtlich übersetzt rückschrittlich, ist nicht nur der Marsorbit zur Romanzeit, sondern auch die politische und soziale Entwicklung. Wo zuvor noch friedliche Kooperation herrschte, fällt man nun in alte Freund-Feind-Schemata zurück.
Allerdings gibt es auch Gegenkräfte – allen voran die Hauptfigur und Ich-Erzählerin Liz. Die Mikropaläontologin ist nicht nur skeptisch gegenüber Autoritäten und deren Informationspolitik (Loyalität hält sie gar für eine "psychische Erkrankung"), sie hat auch Freunde in den anderen Modulen. Dass Liz das Fähnlein der wissenschaftlichen Zusammenarbeit hochhält, liegt nicht zuletzt aber auch an einer guten Portion Egozentrik: "Ich bin wegen der Wissenschaft zum Mars gekommen. Das lasse ich mir von keinem gottverdammten Atomkrieg nehmen."
An der Grenze zur Gegenwart
"Habitat" verbindet zwei Motive respektive Genres. Das eine ist das von der abgeschieden lebenden Gruppe, die den Kontakt zur Außenwelt verliert und sich nur ausmalen kann, was dort Schreckliches geschehen sein mag (siehe etwa "Cold Earth" von Sarah Moss). Das andere ist die Schilderung des vermutlich nächsten Schritts der Raumfahrtgeschichte, siehe etwa die Semi-Doku-Serie "MARS" auf National Geographic oder auch Andy Weirs "Der Marsianer". Die darin geschilderten Technologien liegen im Prinzip schon vor, es lässt sich also gar nicht so leicht sagen, ob das SF-Label hier wirklich noch passt. War "Gravity" ein Science-Fiction-Film?
Ähnlich wie Andy Weir und erst recht wie die Macher von "MARS" baut Peter Cawdron allerhand Wissenswertes in seinen Roman ein. Da dieser durchgehend im Präsens erzählt wird, fällt das Wechseln zwischen Handlung und Fun Facts aber so unaufdringlich wie möglich aus – sieht man mal von der Kleinigkeit ab, dass das eine oder andere Faktum doppelt erklärt wird. Generell wird "Habitat" in recht sachbezogenem Stil erzählt, was sich aber gut damit begründen lässt, wie Liz halt gestrickt ist: Ich fühle mich seltsam unbeteiligt, als ich versuche, über die Auswirkungen dessen nachzudenken, was soeben geschehen ist. Sich vom Augenblick zu lösen und objektiv die Folgen zu analysieren ist ein guter Mechanismus, um den Schock zu bewältigen.
Ob sich letztlich die Kräfte der Spaltung oder die der Kooperation durchsetzen, wird übrigens nicht die einzige Frage sein, die den Roman spannend hält. Dazu kommt noch ein Element, das der Klappentext dankenswerterweise verschweigt und das ich auch hier nicht weiter andeuten werde. Unterm Strich ist damit ein achtbarer SF-Thriller aus "Habitat" geworden. Noch dazu einer von der lobenswerten Sorte, die erst einmal den angerissenen Handlungsbogen zu Ende führt, ehe eine Fortsetzung folgt. Was dann im Sommer unter dem Titel "Reentry" geschehen wird.

Frank W. Haubold: "Gesänge der Nacht"
Gebundene Ausgabe, 208 Seiten, € 20,50, Begedia 2018
Immer mal wieder kommt mir in einer Anthologie eine Kurzgeschichte unter, bei der ich mir denke: Da steckt das Potenzial für eine größere Erzählung drin, vielleicht sogar für eine Saga. Schön, wenn man das mal rückwärts nachvollziehen kann. "Das ewige Lied" – eine der acht Erzählungen aus den Jahren 2000 bis 2018, die Frank W. Haubold hier versammelt hat – ist erstmals 2005 erschienen. Und war offensichtlich die Urzelle der im Jahrzehnt darauf folgenden "Götterdämmerung"-Trilogie, die klassische Science Fiction mit dem Metaphysischen verband.
Die letzte Antwort
Neben dieser Erzählung, in der es um Weltraumrekruten vor der Schlacht geht, stammen noch zwei weitere Geschichten in "Gesänge der Nacht" aus diesem Universum. In "Am Ende der Reise" hat Raumkapitän Daniel den Rand des bekannten Weltraums erreicht und ist Gast oder Gefangener eines seltsamen Phänomens, das längst verstorbene Menschen, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben, an Bord manifestiert. Dass die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits durchlässig werden, ist übrigens ein Grundmotiv, das sich durch diesen Band zieht.
Während in "Am Ende der Reise" die Frage, ob der Tod wirklich das Ende bedeutet, offen bleibt, wird sie in der abschließenden Geschichte "Die letzte Frage" nicht nur explizit gestellt – eine Super-KI übernimmt hier gewissermaßen die Adressatenrolle von Gott –, sondern sogar verbindlich beantwortet, zumindest für dieses spezielle Universum. Ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn die Antwort ausgeblieben wäre – wenn schon nicht für den Fragesteller Viktor, dann wenigstens für uns Leser. Immerhin lassen die meisten Geschichten in dieser Sammlung fast alles offen und fahren sehr gut damit. Aber vielleicht wollte Haubold wenigstens eine Gewissheit als Schlusspunkt setzen.
Im Zwischenreich
Maximale Offenheit zeigen zwei Geschichten im vorderen Teil des Bands, die nicht unter Science Fiction fallen, sondern scheinbar in unserer Realität ablaufen – eine Vermutung, die sich aber sukzessive auflöst. So gerät "Die Stadt am Fluss" zu einem surrealen Trip ins Land der Erinnerung, wenn Protagonist Robert nach 30 Jahren in seine einstige Heimatstadt zurückkehrt, die nun aber fast menschenleer ist und seltsame Anzeichen von Verfall zeigt. Wie ein einzelnes Farbbild in einem Schwarzweißfilm kommt Robert hier seine einstige Jugendliebe entgegen – offenbar ohne seitdem auch nur einen Tag gealtert zu sein. Es bleibt völlig offen, wo hier die Grenzen zwischen Erinnerung, Wunschvorstellung und Vision verlaufen.
Ähnliches gilt für "A flor dos sonhos", einer insgesamt der "Stadt am Fluss" sehr ähnlichen Erzählung, in der Vergangenheit und Gegenwart zu einem kaum durchschaubaren Zwischenreich verschmelzen. Mit einem Rummelplatz, der in Abwesenheit von Menschen von alleine munter weiterläuft, als würdigem Schauplatz.
Stimmung sticht Genre
Vergleichsweise konventionell ist die Schauergeschichte "Der Wunderbaum" gehalten, in der Hauptfigur Gabriel zu jenem Ort in den Bergen zurückkehrt, an dem (wieder) vor 30 Jahren etwas Tragisches geschehen ist. Gabriel ist übrigens Schriftsteller, was Haubold Gelegenheit für ein paar neckische Selbstreferenzen gibt. Vor allem aber ist er typisch für die Protagonisten fast aller Geschichten hier: Es sind mit wenigen Ausnahmen Männer in reiferen Jahren, die einen Verlust erlitten haben und von einer tiefen Unruhe erfüllt sind, Getriebene.
Wirklich jung ist nur Marian in "Der Garten der Persephone". Er gehört zu einer Gruppe von Raumfahrern, die von einer vergeblichen interstellaren Expedition zur Erde zurückkehren und diese als Geisterwelt vorfinden – buchstäblich. Der Tod ist in all diesen Geschichten omnipräsent, doch lauert er zumeist nicht, sondern wartet geduldig auf die Menschen, die sich ihm früher oder später bereitwillig hingeben. Es liegt eine an James Tiptree Jr. erinnernde Stimmung über den "Gesängen der Nacht".
Am meisten beeindruckt war ich allerdings vom kompromisslosen "Der hinter den Reihen geht". Die Geschichte beginnt mit einem geradezu klassischen Motiv apokalyptischer Erzählungen: Der Protagonist, Morten mit Namen, erwacht allein an einem abgeschiedenen Ort (in dem Fall die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Anstalt) und hat offenbar den Weltuntergang verpasst. Doch Morten hört Trommeln in seinem Kopf, und die treiben ihn an – denn er hat noch eine Aufgabe zu erfüllen. Eine Erklärung wird nicht geliefert und braucht es auch nicht. Stark.

Daniel H. Wilson: "Die Dynastie der Maschinen"
Broschiert, 416 Seiten, € 15,50, Knaur 2019 (Original: "The Clockwork Dynasty", 2017)
Eine Secret History mit Elementen von Steampunk und "Terminator" hat US-Autor Daniel H. Wilson hier für uns entworfen. Er ist also so technophil wie immer unterwegs, diesmal aber mit Fokus auf die Vergangenheit. Seit sehr langer Zeit nämlich, so erfahren wir in "Die Dynastie der Maschinen", tobt hinter den Kulissen der menschlichen Zivilisation ein Konflikt zwischen verfeindeten Fraktionen der Avtomat, anthropomorpher Maschinen mit Ich-Bewusstsein.
Eine der beiden Hauptfiguren, Peter, ist ein solcher Avtomat – die andere heißt June Stevanov und hat ganz wie der Autor ein Faible für Technologie. Der Roman zeichnet den Weg dieser beiden Protagonisten nach: den von June zur Lösung des Avtomat-Rätsels und den von Peter zu sich selbst. Fassen wir es in einem Satz zusammen: Explosionen säumen ihren Weg. Für weitere Details sei auf die Rezension zur Originalausgabe "The Clockwork Dynasty" verwiesen, die schon vor eineinhalb Jahren in der Rundschau erschienen ist.
So geht es weiter
Mit stolzgeschwellter Brust verweise ich darauf, dass nur drei Titel in dieser Rundschau noch aus 2018 stammen. Das ist in der ersten richtigen Ausgabe des Jahres – nach dem traditionellen Best-of im Jänner – meist eher umgekehrt. Ein paar 2018er, hauptsächlich englischsprachige, liegen zwar noch zuhause herum, aber die werden auf die kommenden Rundschauen homöopathisch verteilt.
Wer auf Hausaufgaben wartet, kann für die nächste Ausgabe indes schon mal ein paar Titel vorbereiten. Da hätten wir etwa "Der Atem einer anderen Welt" aus der niemals stillstehenden Schreibstube von Seanan McGuire oder Thomas Carl Sweterlitschs "Am Ende der Zeit", das im englischsprachigen Raum für Furore gesorgt hat. Außerdem steht eine neue Novelle von Alastair Reynolds ("Permafrost") kurz vor der Veröffentlichung, das neue Jahr lässt sich also recht vielversprechend an. (Josefson, 16. 3. 2019)
________________________________
Weitere Titel
Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher