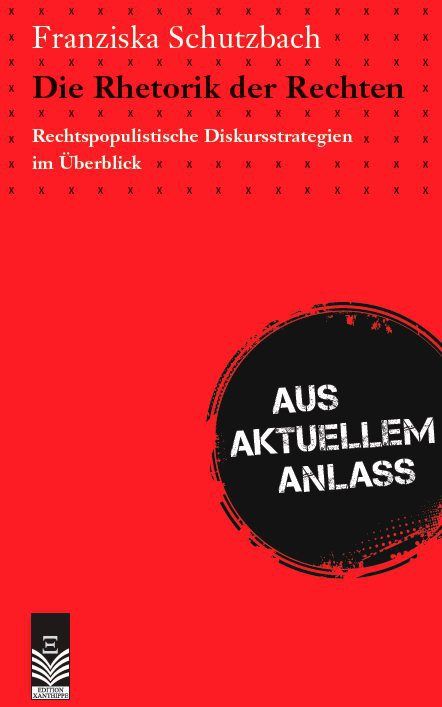STANDARD: Was sind wesentliche sprachliche Merkmale des Rechtspopulismus?
Schutzbach: Rechtspopulismus agiert meistens knapp im demokratischen Rahmen – oder streift die Grenzen. Dieses Spiel zwischen Distanzierung und Flirt mit Extremismus und vor allem das Kompatibelsein mit der liberalen Mitte, das zeichnet Rechtspopulismus aus. Es wird viel mit liberalen Werte wie Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung und Demokratie gearbeitet. Man formuliert also damit einen Anspruch auf die liberale Mitte und wird so kompatibel mit einer breiten Wählerschaft.
STANDARD: Seit wann werden solche Strategien systematisch angewandt?
Schutzbach: Diese Strategien sind nicht alle am Reißbrett entstanden. Viele sind entstanden, weil man einfach gesehen hat: Es funktioniert. Manches ist aber durchaus geplant und findet sich zum Beispiel in Parteistrategiepapieren oder in Anweisungen christlich-fundamentalistischer Netzwerke wie der "Agenda Europe". Dort heißt es zum Beispiel, man müsse sich wann immer möglich gegen die politische Korrektheit wenden und Menschenrechte und Gleichstellungsgesetze als politisch korrekte Tyrannei diskreditieren. Anti-Political-Correctness geht zurück bis in die Reagan-Ära. Diese Strategie wurde in den 1990er-Jahren aus den republikanischen US-Wahlkämpfen in den deutschsprachigen Raum importiert und hier zuerst von rechtsradikalen und antisemitischen Verschwörungstheoretikern verwendet.
In einem Buch des Rechtsextremen Klaus Groth, "Die Diktatur der Guten – Political Correctness", aus den 1990er-Jahren heißt es gleich im ersten Satz: "Die Diktatur hat einen neuen Namen, die Political Correctness, sie ist die Herrschaft der Minderheiten über die Mehrheit."
STANDARD: Vor Political Correctness wird heute auch in liberalen Kreisen als Zensurinstrument gewarnt.
Schutzbach: Ja, da werden diese Schnittstellen sichtbar: Auch Liberale wenden sich gegen "zu viel Staat" und vermuten in jedem Gender-Mainstreaming-Programm "Umerziehung von oben". Kurzum: Anti-Political-Correctness und Antietatismus sind Scharniere zwischen rechten und Mitte-Positionen. Hier sind auch Antifeminismus und Genderbashing zentral, denn Feminismus und Gender stehen für die verhassten staatlichen Institutionen, für internationale Abkommen, für Menschenrechte und Grundgesetze – also für alles, was man als "Gleichheitsdoktrin" diskreditiert. Hier klatschte das Feuilleton in den letzten Jahren beherzt mit, so lange, bis liberale Verfassungsaufträge plötzlich als "extrem" oder "totalitär" galten. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass Antifeminismus eine der zentralen Chiffren ist, mit denen rechtes Denken in der Mitte salonfähig gemacht wird.
STANDARD: Den Vorwurf "Zensur" hören heute linke Emanzipationsbewegungen, während rechte Bewegungen oder Parteien als Kämpfer gegen eine Meinungsdiktatur gesehen werden. Wie war diese erstaunliche Entwicklung möglich?
Schutzbach: Demokratische Errungenschaften wie die Menschenrechte werden als diktatorisch oder totalitär gebrandmarkt, um sie zu delegitimieren. Da spielt die Inszenierung des Tabubruchs eine große Rolle. Mit der Rhetorik der Anti-Political-Correctness ist eng die Heldentat der Enttabuisierung verbunden. Damit kann man sich als Freiheitskämpfer inszenieren. Manche Rechte bezeichnen sich sogar schon als Punks. Diese neue Art Widerstand kämpft dafür, weiterhin sexistisch oder rassistisch sein zu dürfen. Mit Schlagwörtern wie "Tabubruch" und "Meinungsvielfalt" wurde es möglich, Lügen zu verbreiten und die Wirklichkeit stark zu verzerren, sei es über Migrationsprozesse oder über Gleichstellung. Und dabei geht nicht nur um einen Kulturkampf.
STANDARD: Sondern?
Schutzbach: Es geht auch um Fragen der Umverteilung von Macht und Ressourcen beziehungsweise darum, diese Umverteilung zu verhindern. Nochmals das Beispiel Gleichstellungspolitik: Gleichstellung ist in der Verfassung verankert, dazu gehört auch die praktische Verantwortung, Gleichberechtigung in die Wirklichkeit umzusetzen. Und das heißt auch: staatliche Programme. Anti-PC-Denken delegitimiert das und erreicht in der Schweiz – wie ja auch in Österreich – massive Kürzungen bei Gleichstellungspolitik.
STANDARD: Warum funktionieren diese Strategien heute so gut?
Schutzbach: Das ist eine große Frage, und es ist viel dazu geforscht worden. Wir befinden uns ja tatsächlich in Zeiten eines tiefgreifenden Wandels. Der Neoliberalismus ist in der Krise, das Versprechen des Wohlstands für alle wurde nicht gehalten – nur ein kleiner Teil hat profitiert. Sogar beim Weltwirtschaftsforum wurde das teilweise offen ausgesprochen. Viele sozialdemokratische Parteien sind in den 1990er-Jahren einen Pakt mit dem Neoliberalismus eingegangen und haben die Sozialpolitik vernachlässigt – das gilt auch für die EU. Verunsicherung und Prekarisierung werden von Rechten ausgenutzt, um Feindbildpolitik zu betreiben und schnelle Lösungen sowie autoritäre Sicherheitsversprechen anzubieten. Dazu gehören neorassistische Fantasien einer homogenen Volksgemeinschaft genauso wie das Versprechen, die heile Familie und ihre traditionellen Geschlechterrollen würden uns vor der krisenhaften Welt bewahren.
Allerdings darf man den Erfolg dieser Ideologie nicht auf ökonomische Krisen reduzieren: Die AfD-Wählerschaft zum Beispiel besteht nicht nur aus abgehängten Arbeitern, sondern darunter sind viele Mittelständler.
STANDARD: Sie schreiben, eine wichtige rechtspopulistische Strategie sei, die Grenzen des Sagbaren durch die Forderung von "Meinungsfreiheit" zu erweitern. Doch es gibt tatsächlich bei vielem keine klare Grenze, was sagbar ist.
Schutzbach: Wir haben in liberalen Demokratien schon definierte Grenzen. Man darf etwa eine Gruppe Menschen nicht aufgrund ihrer Ethnie verleumden. Der Punkt ist aber, dass man Ressentiments und Hass auch mittels impliziter Redeweisen verbreiten kann, die innerhalb der formaldemokratischen Regeln bleiben. Es ist hier kaum möglich, universelle Maßstäbe festzulegen, an denen wir ein für alle Mal Grenzen für Sagbares definieren. Ich denke aber auch: Mit der Frage nach "Grenzen" sitzen Sie eigentlich schon rechtspopulistischer Rhetorik auf, im Sinne von "Wir müssen das jetzt definieren". Würde ich das tun, hieße es sofort: "Schutzbach sagt, hier endet die Meinungsfreiheit." Man will solche Statements jetzt aus sogenannten Progressiven herauskitzeln, man will, dass sie sich hinreißen lassen dazu, Grenzen zu definieren, und damit als "die Intoleranten" dastehen, als Feinde der Meinungsfreiheit und Demokratie. Das ist eine extrem erfolgreiche Strategie, mit der Rechtsextreme, Rechtspopulisten und ihre liberalen Sympathisanten es derzeit schaffen, sich selbst als die Vertreter der wahren Demokratie und Freiheit zu inszenieren.
STANDARD: Was schlagen Sie vor?
Schutzbach: Statt Grenzen zu definieren, müssen wir analysieren, was eigentlich tatsächlich hinter diesen "Meinungen" steckt, für die von rechts geworben wird – und wo sie in der Konsequenz hinführen. Zum Beispiel, Flüchtlinge einfach ertrinken zu lassen. Wir müssen aufzeigen, dass viele dieser "Meinungen" eine grobe Verzerrung der Wirklichkeit sind, dass sie antipluralistisch und antiegalitär sind, dass sie, zu Ende gedacht, nicht davor zurückschrecken, Medien zu kontrollieren und Kritiker zum Verstummen zu bringen, wie es in Ungarn längst Normalität ist. Und wir müssen zeigen, dass die politischen Lösungen, die hinter diesen Meinungen stehen, keine wirklichen politischen Angebote sind für reale Themen wie Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Kostenexplosionen im Gesundheitsmarkt.
In Bezug auf die Frage, ob es noch eine Meinung ist oder nicht, würde ich viel lieber darüber sprechen, wie Themen geframt werden, also wie bestimmte Themen besetzt werden.
STANDARD: Haben Sie ein Beispiel?
Schutzbach: Medien sollten nicht unkritisch rechtspopulistische Framings bedienen. In der Schweiz haben wir Andreas Glarner, SVP-Politiker. Er setzt Themen, indem er etwa fragt: "Dürfen wir jetzt keine Würste mehr essen?" – wegen der muslimischen Kinder an Schulen. Wenn eine TV-Debatte oder Zeitungen dann mit genau diesem Satz titeln, dann ist das eine völlig unkritische Reproduktion. Damit wird schon etwas nahegelegt, dass es potenziell ein Verbot von Würsten geben könnte – was völliger Quatsch ist. Die Frage könnte stattdessen lauten: Welche Probleme und Potenziale gibt es durch Migration, wie geht Zusammenleben in einer sehr pluralen Gesellschaft? Und das bringt dann auch gleich eine ganz andere Einladungspolitik.
STANDARD: Trotzdem wollen Medien ein möglichst breites Meinungsspektrum abbilden. Das ist ja tatsächlich wichtig, oder?
Schutzbach: Ja, das ist auch ein ehrenvoller Anspruch. Es ist aber schon ein wenig Selbstbetrug, denn die Medien waren letztlich nie ausgewogen. Warum will man jetzt plötzlich all die Rechten vorkommen lassen? Lange Zeit hat man weder Frauen noch Migrantinnen, Lesben oder Schwule zu Wort kommen lassen. Seit vielen Jahren sagen Feministinnen etwa "Hallo, wir hätten da noch was zu Sorgearbeit, zu Schwangerschaft, zu sexualisierter Gewalt". Kam aber kaum vor. Da fragt man sich schon, warum ausgerechnet das Argument der Vielfalt so stark ist, wenn es darum geht, Rassismen und Ressentiments vorkommen zu lassen.
STANDARD: Es heißt oft, die Kommunikation zwischen Menschen mit unterschiedlichen politischen Positionen würde mehr und mehr abreißen. Sind die politischen Meinungsbildungsprozesse festgefahren?
Schutzbach: Bestimmte Stimmen sind hörbarer geworden. Allein die Debatte um #MeToo. Es war unglaublich, wie nachhaltig die Kritik an sexualisierter Gewalt über Monate extrem präsent und maßgeblich von Frauen dominiert war. Früher hatten klassische Medien eine Gatekeeper-Funktion, sie haben bestimmt, was eine Debatte ist und was nicht. Durch das Internet wurde das demokratisiert. Plötzlich reklamieren Frauen und Migranten für sich bestimmte Debatten. Verschiedenste Leute haben jetzt eine Stimme und Deutungshoheit. Dass das natürlich auch konfliktuös verläuft, das ist ganz klar. Ich würde da nicht von einem Scheitern der Kommunikation sprechen, sondern einem Zutagetreten von Konflikten, die so unmittelbar vorher nicht sichtbar waren. Das ist herausfordernd, aber dieses Gewusel und diese Widersprüche müssen wir einfach aushalten lernen. Den Versuch, hier Ordnung und Homogenität schaffen zu wollen, notfalls mit Gewalt, nennt der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit Faschismus. (Beate Hausbichler, 14.3.2019)