Jeden Freitag gehen weltweit junge Menschen auf die Straße, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Das moderne Wirtschaftssystem fresse zu viele Ressourcen und zerstöre den Planeten, lautet ihre Kritik. Doch der Kapitalismus lasse sich nicht ohne gravierende Kosten vom Wachstumsstreben abbringen, sagt der Schweizer Ökonom Mathias Binswanger. Denn wir seien zu Wachstum förmlich verdammt. Eine provokante These, die sowohl Verfechtern als auch Kritikern des Kapitalismus sauer aufstoßen dürfte. Effektive Umweltsteuern hält der Volkswirt für unrealistisch, ein bedingungsloses Grundeinkommen könne nicht funktionieren, mehr Konsum mache jedoch auch nicht glücklicher. Letztlich müsse ein Wandel von den Unternehmen ausgehen.
STANDARD: Ein Anzugträger läuft im Hamsterrad auf dem Titelbild Ihres Buches "Der Wachstumszwang". Seit der industriellen Revolution sind wir doch weit gekommen. Treten wir nun auf der Stelle?
Binswanger: Das ist ein neues Phänomen. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich das materielle Leben stark verbessert. Jetzt stellen wir fest, dass das Glück des Einzelnen in hochentwickelten Volkswirtschaften wie der Schweiz oder Österreich mit mehr Wohlstand nicht weiter zunimmt. Trotzdem merken wir, dass wir mit dem Wachstum weitermachen müssen, damit die Wirtschaft überhaupt funktioniert. Dafür steht dieses Hamsterrad.
STANDARD: Woher weiß man, dass die Menschen nicht glücklicher werden?
Binswanger: Das wissen wir aus Umfragen. Man sieht, dass das durchschnittliche Glücksempfinden der Menschen zunehmend vom materiellen Wohlstand entkoppelt ist. In ärmeren Ländern lässt sich der Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen hingegen weiterhin beobachten.

STANDARD: Kritiker des Wachstums verweisen darauf, dass Ressourcen endlich sind. Sind wir also aufgeschmissen?
Binswanger: Das ist ein Dilemma. Der Wachstumszwang besteht ja nicht darin, dass da jemand mit der Peitsche steht. Bei genauer Analyse erkennt man, dass eine Mehrheit der Unternehmen nur Gewinne erzielen kann, wenn ein gewisses Wachstum stattfindet.
STANDARD: Und wenn es kein Wachstum mehr gäbe?
Binswanger: Dann würden einige Unternehmen pleitegehen, die Arbeitslosigkeit würde steigen, dadurch sinkt der Konsum, und andere Unternehmen müssen aufgeben. Der Wachstumszwang besteht darin, diese Abwärtsspirale zu vermeiden. Man hat in Griechenland gesehen, was passiert, wenn es sechs Jahre lang kein Wachstum gibt. Das hatte absolut dramatische Konsequenzen: Ein Drittel der Unternehmen ist verschwunden, die Arbeitslosigkeit stieg auf fast 30 Prozent ...
STANDARD: Was verstehen Wachstumskritiker nicht?
Binswanger: Die Dynamik dieses Systems. Die haben das Gefühl, wir haben jetzt ein Niveau erreicht, wo wir bleiben können. Aber das geht im heutigen Wirtschaftssystem nicht. Entweder man wächst oder man schrumpft.
STANDARD: Die neoklassische Wachstumstheorie, die heute an Unis gelehrt wird, kommt auch ohne Zwang aus.
Binswanger: Ja, dabei wird so getan, als ob das Wachstum von den Bedürfnissen der Menschen angetrieben würde. Man könnte jederzeit aufhören damit, wenn die Menschen nicht künftig noch mehr wollten. Dann würde niemand mehr heute auf Konsum verzichten, um Geld für morgen anzusparen. Sparer stellen das Geld für Investitionen zur Verfügung, daraus resultiert Wachstum – so sieht das die neoklassische Theorie.
STANDARD: Sie sehen das anders?
Binswanger: Es wird vernachlässigt, dass wir in einer Geldwirtschaft leben. Investitionen werden nicht durch Konsumverzicht und Sparen finanziert, sondern durch zusätzliches Geld, das in die Wirtschaft fließt. So kann man zusätzliche Investitionen finanzieren, ohne dass der Konsum reduziert wird.
STANDARD: Also mit der Idee, Ressourcen zu schonen und auf Wachstum zu verzichten, ist man auf dem Holzweg?
Binswanger: Die Idee an sich, Ressourcen zu schonen, da diese endlich sind, ist vollkommen richtig. Das Problem wurde etwa vom Club of Rome in den 70er-Jahren mit dem Bericht über die Grenzen des Wachstums beschrieben. Nur wurden diese Grenzen seither immer wieder in die Zukunft verschoben. Auch heute sehen wir nicht, dass die Rohstoffpreise steigen, weil sie knapp werden.
STANDARD: Freitags gehen viele Jugendliche auf die Straße für das Klima. Alles nutzlos?
Binswanger: Nutzlos würde ich nicht sagen. Es ist ein Unbehagen, das sich breitmacht: Das Wachstum hat Kollateralschäden, in dem Fall die CO2-Konzentration, aber es wird nicht ernsthaft etwas dagegen gemacht. Ähnliche Proteste gab es immer wieder in der Vergangenheit, das ebbt dann meist nach kurzer Zeit wieder ab, und die Wirtschaft wächst weiter wie bisher.

STANDARD: Kann die Wirtschaftsleistung nachhaltiger wachsen? Wenn grüne Technologien verkauft oder statt neuer Elektronikgeräte mehr Software-Updates entwickelt werden, steigt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch.
Binswanger: Ja, das Wachstum kann auch durch Qualitätsverbesserungen stattfinden. Tatsächlich hat in den letzten Jahrzehnten eine Entkopplung stattgefunden. Das heißt, wir können eine zusätzliche Einheit des Bruttoinlandprodukts (BIP) mit weniger Emissionen produzieren als früher. In Europa geht der absolute Energieverbrauch zum Teil zurück. Das liegt aber auch daran, dass wir diese energieintensiven Prozesse ins Ausland verlagern. Aber auch global betrachtet fand eine gewisse Entkopplung statt. Die Frage ist nur, wie weit das gehen kann.
STANDARD: Sind Sie da nicht so optimistisch?
Binswanger: Es gibt sicher noch Potenzial. Aber es gibt auch immer einen "Rebound-Effekt". Zum Beispiel: Wenn Motoren effizienter werden, baut man größere, luxuriösere und schwerere Autos. Ein Teil des Einsparpotenzials geht dadurch verloren.
STANDARD: Liegt das am Verbraucher? Wenn die Leute bereit sind, für ressourcen-schonende Produkte zu zahlen, werden sie gebaut?
Binswanger: Da wird der schwarze Peter zwischen Konsumenten und Produzenten hin und her geschoben.
STANDARD: Wer hat recht?
Binswanger: Ich würde sagen, die Konsumenten haben etwas mehr recht. In Ländern wie der Schweiz oder Österreich sind eigentlich viele Märkte gesättigt. Die Anbieter von Produkten bemühen sich aber aktiv, dass sich diese Sättigung nicht auswirkt. Wenn es nur um Mobilität ginge, wäre der Automobilmarkt kaum mehr ein Wachstumsmarkt. Alle, die ein Auto wollen, haben schon eines, und man müsste dieses einfach von Zeit zu Zeit ersetzen. Wenn ich aber aus dem Auto ein Statusobjekt mache, kann ich relative Bedürfnisse wecken, die im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen nie gedeckt sind. Ich kann immer etwas Besseres wollen als andere.
STANDARD: Kann das Bessere nicht das ökologischere sein? In Teilen Wiens übertrumpft man sich gegenseitig mit dem teureren Lastenfahrrad.
Binswanger: Solche Fälle gibt es, aber meistens ist ein Statussymbol nicht das ökologischere Produkt. Das Lastenfahrrad ersetzt nicht den Maserati.
STANDARD: Jene, die Verzicht üben, entziehen sich dem Wirtschaftskreislauf, beeinflussen aber nicht die Richtung, in die es geht?
Binswanger: Ja, und für die Wirtschaft wäre es auch gefährlich, wenn das die Mehrheit täte. Deshalb versucht man das mit allen Mitteln zu verhindern: Bestehende Produkte werden laufend entwertet, indem man kontinuierlich versucht, mit tatsächlich oder angeblich besseren Produkten auf den Markt zu kommen – jedes Jahr ein neues Smartphone. Das funktioniert gut, der Konsum steigt von Jahr zu Jahr. Das ist das wahre Wirtschaftswunder: nicht dass wir laufend mehr produzieren können, sondern dass alles auch gekauft wird.
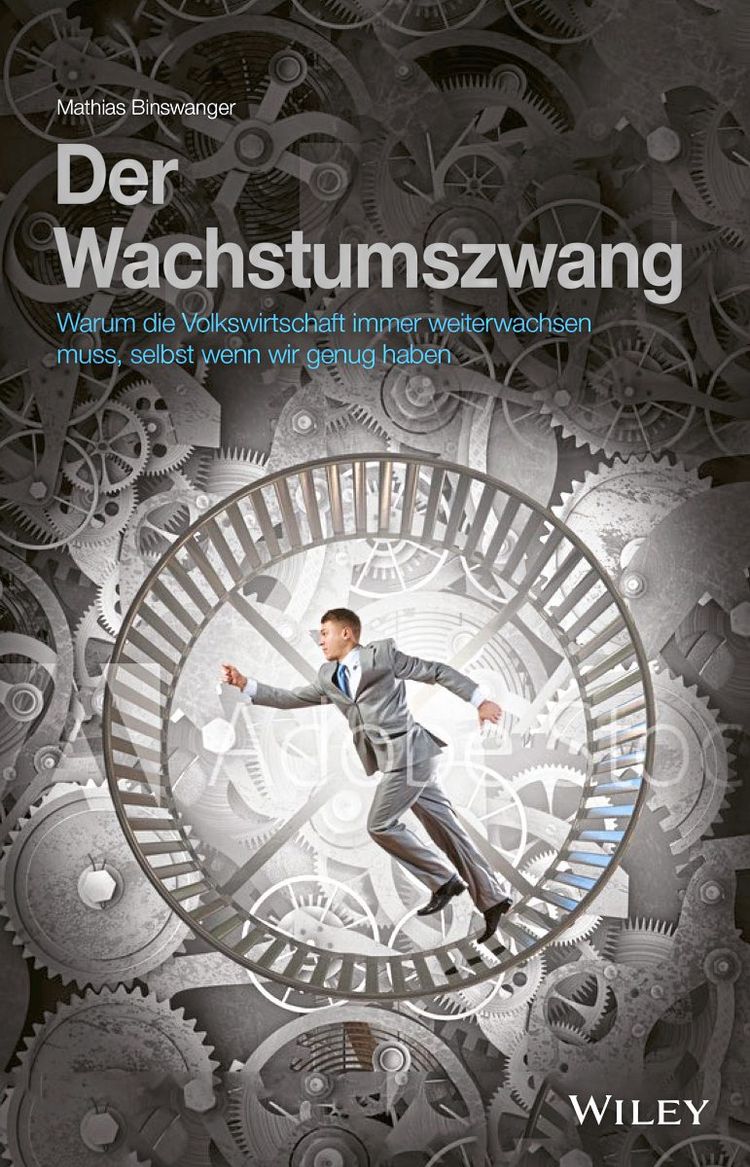
STANDARD: Wäre es fünf nach zwölf, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst?
Binswanger: Nicht für die Umwelt, aber für die Wirtschaft. Dann ändert sich die öffentliche Wahrnehmung, die ökologischen Probleme treten in den Hintergrund, sobald die Arbeitslosigkeit steigt. Das größere Problem sind interne Widersprüche des Systems: Die digitale Transformation führt etwa dazu, dass Menschen neue Arbeitsplätze brauchen. Das wird derzeit so gelöst, dass wir immer mehr Bürokratie aufbauen.
STANDARD: "Bullshit Jobs" nennt das der Ethnologe David Graeber …
Binswanger: Genau, also Controlling, Regulierung, Organisation etc. – in einem Land wie der Schweiz oder Österreich würde man besser von Bruttoinlandsorganisation sprechen statt vom Produkt. Die wenigsten produzieren noch etwas.
STANDARD: Die Schweiz hat einmal über ein bedingungsloses Grundeinkommen abgestimmt und es abgelehnt. Wäre so eine Idee eine Lösung für den digitalen Wandel?
Binswanger: Da ist auch ein Dilemma enthalten: Wenn der Betrag des Grundeinkommens gering ist, kann man ihn finanzieren, aber er reicht dann für die meisten Menschen nicht. Wenn der Betrag hoch ist, kann man zwar davon leben, aber die Finanzierung wird zum Problem. Diese funktioniert nur, wenn die überwiegende Mehrheit weiterhin in bezahlten Jobs arbeitet und die erforderlichen Geldsummen erwirtschaftet. Die Intention, die Menschen vom Zwang der bezahlten Arbeit zu befreien, lässt sich damit nicht erreichen.
STANDARD: Einige Ökonomen sehen eine Phase der säkularen Stagnation, also einen Wachstumsrückgang, in dem wir uns befinden. Wie passt das zu Ihrer These?
Binswanger: Ich glaube, diese Stagnation gibt es gar nicht. Sie ist eine Illusion, die darauf basiert, dass man bei uns die 50er- und 60er-Jahre als Ausgangspunkt nimmt. Später war es Japan, das rasant wuchs, heute ist es China. Wenn wir die Welt anschauen, sehen wir keine Stagnation.

STANDARD: Brauchen Sozialstaaten wie Österreich Wachstum, um später einmal Pensionen, Spitäler und Schulden zu zahlen?
Binswanger: Der Staat verstärkt den Zwang zum Wachstum, da er selber auf dieses angewiesen ist. So kann er mehr Geld ausgeben und sich permanent verschulden in dem Wissen, dass er in Zukunft höhere Steuereinnahmen hat. Ohne Wachstum wird die Wirtschaft zu einem Kuchen. Wenn der Staat die Renten der nicht mehr arbeitenden Bevölkerung bezahlen will, muss er das den Arbeitenden wegnehmen. Da ist es viel angenehmer für die Politik, der ganze Kuchen wird größer, und alle können mehr bekommen.
STANDARD: Das eröffnet ein politisches Dilemma für die Linke. Von dort kommt die stärkste Unterstützung für üppige Sozialtransfers, gleichzeitig kommen die Wachstumskritiker im Wesentlichen aus dieser Ecke. Lässt sich das auflösen?
Binswanger: Auch die Linke ist gespalten, ohne dass sie es merkt. Die gewerkschaftliche Sicht ist sehr wachstumsorientiert. Und von der grünen Seite kommt die Kritik am Wachstum. Das Dilemma, das im Wirtschaftssystem steckt, spiegelt sich auch in der linken Politik wider.
STANDARD: Wie würden Sie das Wirtschaftssystem verbessern?
Binswanger: Das heutige System braucht Wachstum, und wir haben im Moment keine funktionierende Alternative. Aber wir müssen nicht ein maximales Tempo anstreben, wie wir es bislang machen. Das liegt auch daran, dass Aktiengesellschaften (AGs) die wichtigsten Treiber des Wachstums sind. An der Börse entsteht enormer Druck, Gewinne zu maximieren. Wir können Unternehmen anders organisieren.
Bild nicht mehr verfügbar.
STANDARD: Wie denn?
Binswanger: Zum Beispiel in Richtung Genossenschaften, ohne diese verherrlichen zu wollen. Eine Genossenschaft kann sich auch andere Ziele setzen als Profitmaximierung. Sie können etwa Umwelt- oder soziale Ziele festlegen. Das schafft neue Möglichkeiten.
STANDARD: Eine AG sagt, wir setzen auf Profite, und eine konkurrierende Genossenschaft nicht. Kann das in einem Wettbewerb funktionieren?
Binswanger: Derzeit stehen Genossenschaften wie die Raiffeisenverbände oder die großen Schweizer Handelsketten (Migros und Coop, Anm.) tatsächlich in Konkurrenz zu AGs und verhalten sich wie diese. Wenn die anderen Unternehmen auch Genossenschaften wären, mildert das den Druck.
STANDARD: Dann müsste man allen die Gesellschaftsform aufzwingen.
Binswanger: Das ist immer eine Art Zwang. Es gibt ja auch heute nur ein paar Varianten, die rechtlich zulässig sind. Klar haben AGs historisch viel dazu beigetragen, das Wachstum in Gang zu setzen. Aber heute kann man das maximale Wachstumstempo hinterfragen. Ohne AGs gibt es trotzdem Wettbewerb und Innovation, aber vielleicht weniger Wachstum auf Teufel komm raus.
STANDARD: Wieso könnten nicht Staaten ökologische Ziele erreichen, etwa per CO2-Steuer?
Binswanger: Das unterliegt einem politischen Prozess, und dieser wird letztlich das Wachstum nicht gefährden. Dann kommt eine Steuer, aber sie ist so klein, dass sie nur marginale Wirkungen hat. Erst wenn der Anreiz bei den Unternehmen auf Gewinnmaximierung unter allen Umständen gemildert wird, betreiben wir Ursachen- und nicht mehr Symptombekämpfung.
STANDARD: Dann müssten die einzelnen Unternehmer dafür sein, ihre Gesellschaftsformen umzukrempeln.
Binswanger: Bei kleinen Unternehmen gibt es das bereits, etwa im Nahrungsmittelsektor. Aber solche Betriebe werden oft von der traditionellen Wirtschaft quersubventioniert. Das heißt, Menschen kaufen alternativ produzierte oder vertriebene Produkte mit Einkommen, welches sie in der traditionellen Wachstumswirtschaft verdienen.
STANDARD: Wird sich die Unternehmenskultur verwandeln?
Binswanger: Das wäre bereits eine kleine Revolution. Wir stehen auch in globaler Konkurrenz. Man wird argumentieren, dass wir mit China mithalten müssen, indem wir so stark wie möglich wachsen.
STANDARD: Aber gerade China ist weniger von Aktiengesellschaften als von staatsnahen Konzernen geprägt?
Binswanger: Ja, das ist wenig demokratisch. Der Kapitalismus ist sehr flexibel, er kann mit mehr oder weniger Staat, mehr oder weniger Demokratie, mehr oder weniger Umverteilung stattfinden. Wir könnten daher auch langsamer und ökologischer wachsen, aber ganz ohne Wachstum geht es nicht.
STANDARD: Theoretisch gefragt: Sie meinten, im Westen hätten wir den Plafond unseres Glücks erreicht. Glauben Sie an alternative Lebensumstände, die uns zufriedener machen?
Binswanger: Ich glaube, dass ab einem gewissen Wohlstand das Glück von anderen Dingen abhängt: das Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe, einem guten Sozialleben oder einem Lebenssinn.
STANDARD: Das kann ich mir doch indirekt alles kaufen mit mehr Wohlstand – indem ich dann weniger arbeite, habe ich Zeit für diese Ziele.
Bild nicht mehr verfügbar.
Binswanger: Das spießt sich schnell mit den gesellschaftlichen Vorstellungen von Erfolg und Anerkennung. Erfolg heißt für die meisten nach wie vor berufliche Karriere und mehr Wohlstand. Einige wenige nehmen sich da heraus, aber das Konsumwachstum zeigt: die Mehrheit macht weiterhin mit.
STANDARD: Sind die Aussteiger aus diesem System glücklicher oder schaffen sie ihre eigenen Spielregeln für Status und gegenseitige Bewertung?
Binswanger: Nicht zwingend, aber sie haben zum Teil bessere Chancen auf ein glückliches Leben. Sie sehen öfters einen Sinn in dem, was sie tun. In freiwilligem Verzicht steckt zunehmend Glückspotenzial. Wer nie hungert, erfreut sich weniger am Essen. (slp, 24.7.2019)