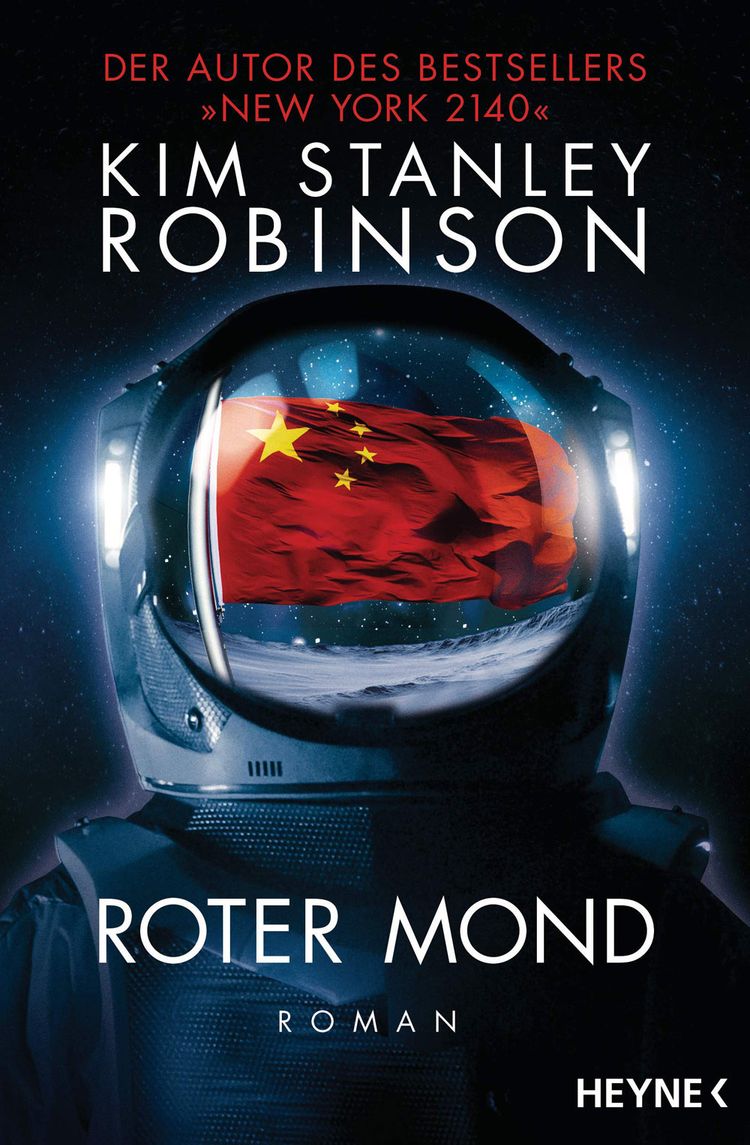
Am Anfang von Kim Stanley Robinsons neuem Wälzer "Roter Mond" lesen wir, wie eine Fähre auf dem Mond landet und die Passagiere sich mit slapstickartiger Unbeholfenheit in der lunaren Niedrigschwerkraft zurechtzufinden versuchen. Was in den Satz mündet: Der Mond war lustig! Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch Hoffnung ...
Eines habe ich mittlerweile gelernt: Wenn KSR den Panoramaerzählmodus anwirft, hängt es ganz wesentlich von den Protagonisten ab, ob man beeindruckt ist oder sich die eingeschlafenen Füße massiert. Es muss einfach jemand Leben in die ansonsten zu abstrakt bleibenden Prozessschilderungen Robinsons bringen. Das gelang in "New York 2140" – not so much in "2312". Und "Roter Mond" ist leider ein Totalrückfall in die Untugenden von "2312".
Systemisches Erzählen
Dass KSR vorwiegend aus einer systemischen Perspektive erzählt, macht das Schlussdrittel von "Roter Mond" besonders deutlich – nicht von ungefähr ist es auch der Abschnitt, in dem noch am ehesten etwas Bewegung aufkommt. Es ist halt nur keine individuelle Bewegung. Geschildert wird dann, wie in Peking die Massen zusammenströmen, weil das aktuelle Regime vor dem Ende steht. Parallel dazu gärt es in den USA: Immer mehr Bürger üben sich in "fiskalischem Ungehorsam" und ziehen ihr Geld aus der parasitären Finanzwirtschaft ab.
In beiden Fällen stellt sich die Frage: Wohin wird der anstehende Umbruch führen? Und nur Fragen wie diese interessieren Robinson wirklich – nicht die Schicksale seiner Charaktere, die er wie schon in "2312" entlang eines Pseudo-Krimiplots durchs Buch schleppt, dessen Aufklärung am Ende – ebenfalls wie in "2312" – letztlich überhaupt nicht mehr von Belang ist. Natürlich ist es Robinsons gutes Recht, statt Figuren Prozesse in den Vordergrund zu stellen. Aber kann das einen lebendigen Roman ergeben?
Irgendeinen Plot braucht's halt
In einem für 2048 durchaus realistischen Szenario existiert am Südpol des Mondes eine chinesische Kolonie, während sich am Nordpol die Ableger der USA und einiger anderer Staaten drängen. Auftritt Fred Fredericks: Der US-Amerikaner arbeitet für ein Schweizer Unternehmen und bringt dessen jüngste Entwicklung, ein Quantenkommunikationsgerät, zum Leiter der chinesischen Kolonie. Allerdings wurde Fred ohne sein Wissen mit einem Kontaktgift präpariert. Die Zielperson stirbt, und obwohl Fred dem Anschlag beinahe ebenfalls erliegt, gilt er als Hauptverdächtiger. Für den Rest des Romans wird der etwas täppische Fred nun von Ereignissen, die er nicht unter Kontrolle hat und großteils auch nicht versteht, wie ein Blatt im Wind weitergetragen werden.
Ein nicht unerheblicher Teil dieses Windes wird von der bedeutend aktiveren zweiten Hauptfigur des Romans kommen. Chan Qi ist eine höhere Tochter (konkret die des chinesischen Finanzministers) und der Pekinger Bürokratur aus verschiedenen Gründen unbequem. Sie pflegt Kontakte zu Dissidenten, und jetzt ist sie auch noch schwanger geworden, was auf dem Mond nicht erlaubt ist. Also wird sie zusammen mit Fred zur Erde abgeschoben. Sie schafft es aber, sich der Verhaftung zu entziehen, indem sie ihre Beziehungen spielen lässt, und taucht mit Fred unter. Anschließend dümpeln die beiden in China herum, tun bedeutungslose Dinge und führen sokratische Dialoge. Ja, die sind leider auch wieder zurück; mehr dazu später.
In der zweiten Reihe hätten wir dann noch den freundlichen älteren Herrn Ta Shu, einen Dichter und Moderator einer Reise-Show, der die beiden unterstützt. Und einen namenlosen Daten-Analysten aus dem chinesischen Überwachungsapparat, der mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz Chan Qis Weg verfolgt – durchaus mit Sympathie, wie es aussieht.
"Wusstest du schon, dass ...?"
Zurück zu den Dialogen. "Weißt du, was das hukou-System ist?" "Nein. Erzähl es mir." Faktenvermittlung in Form gestelzter Gespräche – in "2312" bis zum Exzess betrieben – ist auch in "Roter Mond" wieder eines der Mittel der Wahl und liest sich genauso verkrampft wie eh und je. Und natürlich gibt es auch wieder glorifizierte Infodumps in Gestalt von Zwischenspielen, in denen uns irgendein allwissendes Erzählkonstrukt Robinsons großzügig Fakten und Kulturgut vermittelt. Dafür müssen diesmal die "Reiseberichte" Ta Shus herhalten – und das ist auch seine eigentliche Funktion im Roman, als Figur hat er keine Bedeutung.
Rein formal sind die KSR-typischen Wissensteile – sei es zur Mondphysik, sei es zur jüngeren Geschichte Chinas – diesmal übrigens weniger aufdringlich gestaltet als in "2312" oder "New York 2140", das muss man schon anmerken. Dafür leiden sie darunter, dass weder der Mond noch China großen Neuigkeitswert haben. Ian McDonald, Andy Weir und eine ganze Menge anderer Autoren haben uns in jüngerer Vergangenheit die Wunder des Mondes nahegebracht, da ist nicht mehr viel Neues herauszukitzeln. Und was die Besonderheiten Chinas anbelangt: Warum dafür nicht gleich zu chinesischen SF-Autoren wie Cixin Liu oder Hao Jingfang greifen?
Da schaut man
Wenn das von KSR so geschätzte Wissen also nur begrenzte Attraktivität hat, wäre der darum herumgesponnene Plot umso wichtiger. Doch wie schon eingangs gesagt, das ist weder Robinsons Stärke noch sein Interesse. Letztlich ist die Handlung nicht mehr als eine Aneinanderreihung von Vorwänden, um die Protagonisten von einem Schauplatz zum nächsten zu hieven, damit sie das dortige Objekt von Interesse – einen Mondkrater, einen chinesischen Bauernmarkt, eine Opernaufführung , ... – betrachten können. In Würdigung einer populären Website, die Nordkorea satirisch aufs Korn nimmt, lässt es sich auf eine einfache Formel bringen: "Roter Mond" = Kim Stanley Robinson Looking At Things.