"Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann 'ne Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen." Mit diesem Tweet hatte eine 17-jährige Schülerin vor ein paar Jahren eine Debatte über den Stellenwert der Wirtschaftsbildung im deutschen Schulsystem befeuert, die ähnlich auch in Österreich geführt wurde und immer noch wird. Wer hierzulande eine AHS durchlaufen hat, wurde auch in "Geografie und Wirtschaftskunde" (GW) unterrichtet. Dieses österreichische Spezifikum ist, wie der Name schon andeutet, ein Kombinationsfach, in dem zwei Gegenstände, eben Geografie und Wirtschaftskunde, gemeinsam und miteinander verzahnt unterrichtet werden.
Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler können sich ganz gut an Geografie erinnern, wenige hingegen an einen Unterrichtsinhalt, der dem Namensbestandteil Wirtschaftskunde wirklich gerecht geworden wäre. Diese anekdotische Evidenz lässt sich auch empirisch belegen: Dass Wirtschaftskunde im Unterricht meist zu kurz kommt, geht aus einer jüngst abgeschlossenen Interviewstudie des Instituts für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuniversität Wien hervor. Schülerinnen und Schülern ist es kaum bewusst, wie sehr Wirtschaft den Alltag durchdringt. Dass auch eine Apotheke ein Unternehmen ist oder eine Ärztin mit eigener Ordination eine Unternehmerin, ist den meisten nicht klar. Viele glauben, dass der Staat die Gehälter von Angestellten und die Preise von Lebensmitteln festlegt. Sie durchschauen den Zusammenhang von Inflation und Geldwert nicht, und Begriffe wie Handelsspanne oder Bruttoinlandsprodukt sind ihnen spanische Dörfer.
Wirtschaftsbildung als Allgemeinbildung
Als Reaktion auf solche Erkenntnisse wurde vielfach der Ruf nach mehr Wirtschaftsbildung in der Allgemeinbildung laut, im Idealfall in Form eines eigenständigen Fachs Wirtschaft in der AHS. Diese Forderung kommt von der Wirtschaftskammer und von einzelnen Unternehmen und Banken, ebenso aber etwa von der Schülerunion oder vom Institut für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuniversität Wien. Dessen Leiterin, Bettina Fuhrmann, ist auch Co-Autorin einer Reihe jener Studien, die den heimischen Schülern erhebliche Wissensdefizite und Verständnisschwierigkeiten attestierten.
Für einige Sozialwissenschafter ist die Vorstellung eines eigenen Faches, in dem die Funktionsweise von wirtschaftlichen Prozessen und Institutionen gelehrt wird, hingegen ein Graus. Sie fürchten eine "ökonomistische" Ausrichtung der Lehrinhalte auf markt- und unternehmensfreundliche Standpunkte ebenso wie eine einseitige Wirtschaftskunde, die sich vorrangig am neoklassischen Modell der Volkswirtschaft orientiert. "Manche Kritiker eines Schulfachs Wirtschaft suggerieren, die Befürworter seien Knechte des Neoliberalismus, die Schüler zu egoistischen Eigennutzmaximierern formen wollen", formulierte es Dirk Loerwald vom Institut für Ökonomische Bildung der Universität Oldenburg in einem Interview mit der "Wirtschaftswoche".
Kein Schulfach?
Den Gegnern von Wirtschaft als Schulfach zufolge kann und soll Wirtschaft nur eingebettet in ein sozioökonomisch ausgerichtetes multidisziplinäres Geflecht aus Politik, Geschichte, Geografie und Gesellschaftskunde unterrichtet werden. In Deutschland gilt der Wirtschaftssoziologe Reinhold Hedtke von der Universität Bielefeld als einer der profiliertesten Vertreter dieser Ansicht. Er ist Gründer und Herausgeber des "Journal of Social Science Education" und sitzt auch im Editorial Board der österreichischen Fachdidaktikzeitschrift "GW-Unterricht".
Wenn negativ ausfallende Studien zur Wirtschaftskompetenz von Schülern als Argument für die Einführung eines eigenen Wirtschaftsunterrichts dienen, dann ist es eine für Kritiker dieser Idee naheliegende Taktik, ebenjene Studien anzugreifen. Der Salzburger GW-Didaktiker Thomas Jekel tat dies 2018 gemeinsam mit einer Salzburger Doktorandin in einem Artikel in der "GW-Unterricht", deren Herausgebergremium er selbst angehört. Darin beschäftigte er sich mit impliziten Vorannahmen in neun Wirtschaftskompetenzstudien der letzten 30 Jahre sowie mit deren wissenschaftlich-institutioneller Einbettung, Methodik und Argumentation. Das kaum überraschende Fazit ist durchwegs negativ. Die Datenbasis sei "empirisch nicht valide", die Studien "theoretisch schwach fundiert" und wissenschaftsethisch defizitär. Die Ergebnisse der ökonomischen Bildung könne man "damit nicht vermessen"; vermessen sei es hingegen, "mit Hinweis auf diese Ergebnisse nach einer monoparadigmatischen wirtschaftlichen Bildung zu verlangen".
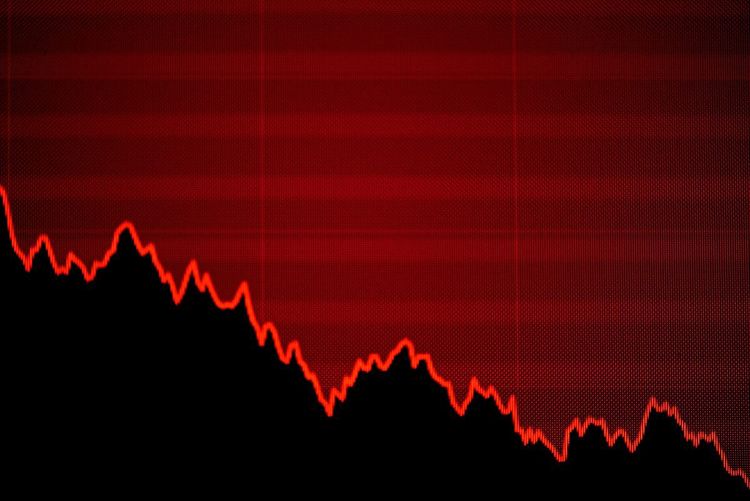
Einstellungsfragen
Dass Bettina Fuhrmann, die vier der neun untersuchten Studien beisteuerte, das anders sieht, ist wenig verwunderlich. Ein solcher wissenschaftsinterner Streit um einen ideologisch aufgeladenen Themenbereich ist im Grunde nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist allenfalls, auf welch argumentativen Schnellschüssen Jekels Urteil teilweise basiert. Um etwa Fuhrmanns angeblich "eindeutig wirtschaftsliberale Grundpositionierung" festzustellen, genügt ihm eine einzige Textstelle aus einer einzigen der vier Studien Fuhrmanns. Dort hatte die Autorin über Fragebogen-Items berichtet, mit denen die Einstellung von Schülerinnen und Schülern zu Wirtschaftsthemen erhoben worden war. Dabei mussten diese unter anderem ihren Zustimmungsgrad zu der Aussage "Die Löhne und Gehälter in unserer Wirtschaft sind fair" auf einer fünfteiligen Likert-Skala von "geringe Zustimmung" bis "hohe Zustimmung" einordnen. Was einem unbefangenen Leser als unverdächtige Fragestellung erscheinen mag, mutiert unter Jekels kritischer Lupe zum Beweisstück für Wirtschaftsliberalismus. Denn, so beobachtet er, "eine ablehnende Haltung [...] können die Schüler/innen nicht einnehmen". Stattdessen könnten sie "nur zustimmen", dass die Löhne und Gehälter fair seien.
Nun ließe sich wohl einwenden, dass es bei derlei Einstellungsfragen weltweit gängige Praxis sei, den Grad der Zustimmung statt den Grad der Ablehnung abzufragen. Oder dass geringe Zustimmung doch gleichzeitig hohe Ablehnung bedeute. Oder dass zwar vollkommene Ablehnung als Antwortmöglichkeit nicht angeboten wurde, aber ebenso wenig vollkommene Zustimmung. Derlei Einwände werden bei Jekel aber nicht einmal angedacht. Stattdessen verweist er auf "zahlreiche weitere Beispiele", die die "eindeutig wirtschaftsliberale Grundpositionierung" Fuhrmanns und ihrer Co-Autoren zeigen würden, ohne es für nötig zu halten, auch nur eines dieser angeblichen weiteren Beispiele zu zitieren. Ähnlich wird mit anderen Studien verfahren: Ein einzelnes Zitat aus einer einzelnen Studie genügt, um eine vernichtende Bewertung auf die Gesamtheit aller neun Studien zu extrapolieren. Ein Schelm, wer hier den Verdacht hegt, das abschließende Urteil habe schon vor Beginn der Analyse festgestanden.
Kampfbegriff "neoliberal"
Möglicherweise entfaltete die Veröffentlichung in einer Fachdidaktikzeitschrift von eher regionaler Bedeutung nicht die gewünschte Wirkung. Das würde zumindest erklären, warum Jekel und seine Co-Autorin wenige Monate später eine Analyse derselben neun Zeitschriften noch einmal in englischer Sprache veröffentlichten, und zwar in Hedtkes "Journal of Social Science Education". Ihr Gesamturteil wies dabei aber einen neuen Schwerpunkt auf. Diesmal findet sich nämlich schon im Titel der Arbeit die Ankündigung, sie hätten "neoliberal ideology" in österreichischen Studien zur Wirtschaftskompetenz von Schülerinnen und Schülern "aufgedeckt". Entsprechend knackig sind dann auch die Resultate formuliert. Die untersuchten Kompetenzstudien seien nicht nur "usually invalid" und dienten "mainly political interests", sondern seien allesamt auch "deeply rooted in neoliberal thought" und die darauf basierenden bildungspolitischen Forderungen "linked mainly to the neoliberal political project".
Das ist problematisch. Denn die Bezeichnung neoliberal ist bereits vor zwei Jahrzehnten zu einem politischen Kampfbegriff und spätestens seit der Krise von 2008 zu einem Schimpfwort geworden. Keiner Gruppierung würde es heute noch einfallen, sich selbst oder ihr Programm als neoliberal zu bezeichnen. Als neoliberal gelten heute die Gegner des Sozialstaats, die für einen entfesselten Kapitalismus, für schrankenlose Globalisierung und umfassende Deregulierung eintreten. Sie berufen sich auf Hayek und Friedman und bewundern Thatcher und Reagan. Neoliberalismus steht für Rücksichtslosigkeit und Eigeninteresse, für Privatisierung und Marktfetischismus, für Austerität und soziale Kälte. Kurz gesagt: Wer in einer wissenschaftlichen Publikation einer Gruppe von Autorinnen und Autoren direkt oder indirekt neoliberale Gesinnung vorwirft, sollte dies sehr gut und ausführlich belegen können.
Und hier wird es doch einigermaßen kurios, wie exemplarisch am Beispiel einer der analysierten Studien festgemacht werden kann. Betrachten wir also die explizit gegen jene Studie gerichteten Vorwürfe, die Fuhrmann gemeinsam mit einem Mitarbeiter 2016 in der "Zeitschrift für ökonomische Bildung" publizierte. Es handelte sich dabei um die Entwicklung eines Erhebungsinstruments zum Wirtschaftswissen für die achte Schulstufe. In der Einleitung schreibt Fuhrmann, ökonomische Bildung sei notwendig, weil sie "über die Förderung ökonomischer Kompetenzen zur Bewältigung ökonomisch geprägter Lebenssituationen beiträgt". Bei Jekel wird daraus der Vorwurf, Fuhrmann habe behauptet, solide wirtschaftliche Entscheidungen führten automatisch zu wirtschaftlichem Erfolg, was er als "fragwürdige Strategie der Universalisierung" einstuft. Fuhrmann beschreibt weiter, dass die Inhalte der verwendeten Fragen durch Experten beurteilt worden waren, und fügt hinzu: "Die inhaltliche Beurteilung des Erhebungsinstruments durch Expert/inn/en alleine gibt noch keinen Aufschluss darüber, ob die Testitems von der Zielgruppe tatsächlich verstanden [werden]. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche Erkundung der Angemessenheit für die Zielgruppe nach der Methode lauten Denkens vorgenommen, um die Gedankengänge der Testpersonen und damit deren Problemlösungsstrategien bei der Aufgabenbearbeitung aufzudecken". Jekel dagegen kritisiert, für Fuhrmann sei die Bezugnahme auf "sogenannte Experten" allein "ausreichend, um den Inhalt einer Frage zu rechtfertigen".
Kein gutes Licht
Im nächsten Vorwurf entfernt sich Jekel noch weiter von der Realität. Er zitiert die Arbeit von Fuhrmann mit der Feststellung, dort sei den Teilnehmern "trotz positiver Resultate" mangelhaftes Wirtschaftswissen konstatiert worden. Eine erstaunliche Behauptung angesichts einer Arbeit, die gar keine solchen Resultate beinhaltet. Denn wie ihr Titel schon verrät, will sie einen Fragebogen erst entwickeln und kann ihn demnach noch gar nicht in der Praxis eingesetzt haben. Noch schlimmer kommt es an jener Stelle, wo Jekel Fuhrmann vorwirft, sie habe Fragen gestellt, die "ideologisch durch neoliberale Glaubensinhalte aufgeladen" seien.
Dazu zitiert er das Fragebogen-Item "Es ist gerecht, dass in unserer Wirtschaft manche mehr und manche weniger verdienen" und behauptet, dass diese Frage "nur bei Zustimmung als korrekt beantwortet" gelten würde. Bei seiner angestrengten Suche nach dem rauchenden Colt des Neoliberalismus in Fuhrmanns Studie dürfte es Jekel dabei entgangen sein, dass dies eine der (wenigen) Fragen zur Einstellung zur Wirtschaft war und nicht eine der wesentlich zahlreicheren Fragen zum Wirtschaftswissen. Entsprechend werden die Antworten auf solche Einstellungsfragen natürlich auch in keinster Weise als richtig oder falsch bewertet. Dieser Vorwurf beinhaltet also nicht nur einen unbegründeten Neoliberalismusverdacht, sondern auch die faktisch falsche Unterstellung eines schweren methodischen Fehlers. Dass der Artikel in dieser Form online gestellt wurde, hätte schlicht nicht geschehen dürfen und wirft kein gutes Licht auf die Qualität des Peer-Review-Verfahrens des "Journal of Social Science Education".
Nonchalante Studie
Nachdem Fuhrmann von einem Kollegen auf die absurd begründeten Vorwürfe von Jekel und dessen Co-Autorin aufmerksam gemacht worden war, wandte sie sich in einer E-Mail an die beiden und an Herausgeber Reinhold Hedtke und forderte, dass der Artikel aufgrund "inhaltlich falscher Aussagen, die wissenschaftlicher Rufschädigung gleichkommen", zurückgezogen wird. Hedtke verweigerte dies und bot stattdessen lediglich an, einen Kommentar von Fuhrmann zu veröffentlichen. Ein paar Tage später überraschte er die Autorin mit der Bekanntgabe, die Autoren hätten nun eine "angepasste Version" des Artikels veröffentlicht. Eine solche Vorgangsweise ist für eine Fachzeitschrift äußerst unüblich, von Transparenz kann hier nämlich keine Rede mehr sein. Lediglich der winzige Hinweis "Version from September 5, 2019" am Ende des Artikels deutet an, dass zuvor eine andere Version des Artikels monatelang online gestanden hatte.
Tatsächlich wurden in der überarbeiteten Version die explizit falschen Behauptungen großteils entfernt. So wird Fuhrmann jetzt zwar nicht mehr fälschlich vorgeworfen, sie hätte positive Resultate als mangelhaft ausgegeben, doch stattdessen liest man nun, eine angebliche "Defizitorientierung" der Studie sei "im Konzept des diagnostischen Instruments implementiert", was immer das auch heißen mag. Der falsche Vorwurf, die Bezugnahme auf Experten, sei für Fuhrmann ausreichend, um den Inhalt einer Frage zu rechtfertigen, wurde durch die Voranstellung eines "Es scheint, dass" allerdings nicht wirklich zurückgenommen. Darüber hinaus findet sich nun wiederum der offenbar ersatzweise aus dem deutschsprachigen Artikel von 2018 entnommene und nach wie vor völlig unkommentierte Vorwurf, in einer Antwortskala sei "disagreement" ausgeschlossen worden.
Wurde zumindest Fuhrmanns 2016 publizierte Arbeit nun mangels geeigneter Belege aus der Riege der angeblich als "neoliberal" entlarvten Studien ausgenommen? Keineswegs! Nach wie vor seien sämtliche Studien "in neoliberalen Axiomen verwurzelt" und "im neoliberalen Projekt und in dessen ideologischen Strategien eingebettet". Wer jemals wissenschaftlich gearbeitet hat, kann sich angesichts solcher Nonchalance nur verwundert die Augen reiben. Aus der politischen Arena und aus den sozialen Medien ist die Taktik bekannt, den Gegner auch mittels fadenscheinigster Unterstellungen anzupatzen und in ein ideologisches Eck zu drängen; frei nach Wilhelm Busch: "Argumente sind nicht stets parat; man schreibt auch, wenn man keine hat." In der wissenschaftlichen Arena sollte man sich von solchen Vorgangsweisen dagegen tunlichst fernhalten. Ökonomische Bildung ist zu wichtig, um sie ideologischen Grabenkämpfern zu überlassen. (Ulrich Berger, 10.12.2019)
