
STANDARD: Welche ethischen Fragen ergeben sich beim Einsatz von Genom-Editierungs-Technologien wie CRISPR/Cas9 beim Menschen?
Ranisch: Wenn wir die Forschung und mögliche klinische Anwendungen von Genom-Editierung betrachten, ist es zunächst wichtig, zwischen zwei sehr verschiedenen Szenarien zu unterscheiden: Einerseits gibt es die sogenannte somatische Gentherapie, bei der es um den Einsatz von Genom-Editierung bei Patienten geht, die eine bestimmte Krankheit haben. Andererseits gibt es Keimbahneingriffe, bei denen Embryonen verändert werden. Bei diesen Eingriffen gibt es also zunächst noch gar keine Patienten, folglich geht es hier auch nicht um die Behandlung einer bereits manifestierten Erkrankung, sondern eher um eine Art Prävention.
STANDARD: Was für Herausforderungen bringt das mit sich?
Ranisch: Das Besondere an diesen Keimbahneingriffen ist, dass sie potenziell vererbt werden können. Auf diese Weise kann es sein, dass nicht nur die Person, die sich einmal aus dem veränderten Embryo entwickelt, sondern auch deren Kinder und Enkel die Genveränderung in sich tragen. Das gilt für erwünschte Wirkungen von Genom-Editierung, aber eben auch für mögliche Nebenwirkungen. Keimbahninterventionen wird daher auch nachgesagt, dass mit ihnen in die Evolution eingegriffen wird. Damit verbinden sich neue ethische Ansprüche.
STANDARD: Manchmal wird auch gesagt, die Gen-Schere mache es möglich, Gott zu spielen – wie denken Sie darüber?
Ranisch: Dazu muss man nüchtern feststellen, dass wir nahezu auf allen Ebenen sehr invasiv in die Natur eingreifen. Dass wir nun "Gott spielen" würden, halte ich daher für kein gutes Argument. Meiner Meinung nach ist eine andere Frage ernster: Es ist zwar trivial, dass wir von künftigen Personen, die von den Folgen einer Keimbahnintervention betroffen sind, kein Einverständnis einholen können. Wenn Keimbahninterventionen aber einmal in der Praxis verfügbar wären, könnten Eltern mit einer neuen Anklage konfrontiert sein: "Warum bin ich mit diesen oder jenen Genen geboren worden, wenn meine Eltern die Möglichkeit gehabt hätten, das zu ändern?" Oder auch: "Warum habt ihr euer Kind nicht vor dieser oder jener Krankheit geschützt, obgleich ihr die Möglichkeit hattet?"
STANDARD: Was ist das Problem, wenn durch Genom-Editierung Nachkommen vor schweren Krankheiten geschützt werden?
Ranisch: Wir reden in einem solchen Fall gerne von Keimbahntherapien. Wenn wir uns die Situation aber genauer ansehen, ist fraglich, ob das wirklich Therapien sind. Bei einer üblichen Therapie hat man es mit einem Patienten zu tun, also mit einer existierenden Person mit einer Krankheit. Hier kann das Risiko gerechtfertigt sein, auch einen riskanten Heilversuch zu unternehmen. Bei einer Keimbahnintervention ist das anders. Hier haben wir es mit Kinderwunschpaaren zu tun, die wissen, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Krankheit weitergeben werden. Der Patient wird sozusagen erst noch gezeugt. In diesem Zusammenhang wären Keimbahneingriffe vielmehr eine Art Kinderwunschbehandlung, die es Paaren erlauben könnte, ein gesundes Kind zu bekommen. Zugleich sind derartige Eingriffe aber selbst auch risikoreich, und einige ethische Konflikt würden sich auflösen, wenn das Paar auf Möglichkeiten wie Adoption oder Samenspende zurückgriffe oder schlichtweg auf die Familienplanung verzichtete. Das wäre für viele freilich ein hoher Preis.
Bild nicht mehr verfügbar.
STANDARD: Wo steht die Entwicklung somatischer Gentherapien basierend auf CRISPR/Cas9?
Ranisch: Momentan handelt es sich noch um experimentelle Verfahren. Solche Gentherapien könnten etwa einmal bei Erbkrankheiten wie den Bluterkrankungen Beta-Thalassämie und Sichelzellenanämie zum Einsatz kommen. Momentan gibt es noch keine zugelassene CRISPR-Therapie und lediglich ein paar Dutzend klinische Studien, die meisten davon in China und den USA, auch einige in Europa. Die bisherigen Daten sind zwar mitunter vielversprechend, aber es ist noch ein langer Weg bis zur breiten Anwendung. Zudem gibt es noch viele Herausforderungen.
STANDARD: Zum Beispiel?
Ranisch: Was Probleme macht, sind beispielsweise die Off-Target-Effekte – sozusagen ungewollte Veränderungen in Genen an einer falschen Stelle. Zudem entstehen in diesem recht jungen Forschungsgebiet laufend neue Fragen. Schon mehr als einmal wurde CRISPR totgesagt, da es im Verdacht stand, etwa Immunreaktionen auszulösen oder sogar Krebs zu befördern. Viele Befürchtungen haben sich so nicht bewahrheitet, sie zeigen aber, dass es viele Fragezeichen gibt. Wir müssen aufpassen, keinem Hype zu verfallen, sondern nüchternen Auges auf die Studien zu schauen und abzuwarten.
STANDARD: Wie sind solche CRISPR-Gentherapien ethisch zu bewerten?
Ranisch: Ethisch sind solche Therapien nicht anders zu bewerten als frühere Gentherapien, die bereits seit dreißig Jahren erforscht werden. Hier gibt es strenge Regeln für die klinische Prüfung und Zulassung. Es gibt aber auch Fragen, die drängender werden, etwa in Bezug auf die Kosten solcher neuer Therapien. Wir erleben momentan eine Situation, in der die Preise für pharmakologische Innovation nach oben hin offen scheinen. Kürzlich kam eine neue Therapie gegen seltene Muskelerkrankungen auf den Markt, bei der eine Einmaldosis zwei Millionen US-Dollar kostet. Ähnliches könnte sich mit ersten Anwendungen von Genom-Editierung wiederholen. Die Erforschung und Entwicklung ist schließlich nicht nur prestigeträchtig, sondern auch teuer und risikoreich. Vielleicht ist es im Zuge dieser Entwicklung an der Zeit, die bestehenden Vergütungssysteme zu überdenken. Da stellt sich für Gesundheitssysteme die Frage, wie man mit innovativen Therapien umgesehen soll, die pro Patient Millionen Euro kosten. Das lädt auch ein, Fragen nach neuen Bezahlmodellen zu stellen: Könnte man nicht beispielsweise den Preis einer neuen Behandlung auch an tatsächlichen Therapieerfolgen bemessen?
STANDARD: Wie bewerten Sie das Potenzial von Genom-Editierung in der Pflanzenforschung, wenn es etwa darum geht, die wachsende Weltbevölkerung nachhaltig zu ernähren?
Ranisch: Die Pflanzenzucht ist ein extrem ideologisch aufgeladenes Thema. Wir müssen jetzt erst einmal die weiteren Entwicklungen abwarten. Es gibt vielversprechende Ansätze, wonach CRISPR/Cas9 es ermöglichen könnte, Pflanzen zu züchten, die widerstandsfähiger und zugleich ertragreicher sind, verbesserte Produkteigenschaften haben oder besser schmecken. Diese Versprechen wurden aber auch schon vor dreißig Jahren im Zusammenhang mit der grünen Gentechnik gemacht, doch der große Durchbruch blieb aus. Gerade bei Genom-Editierung sollten wir uns vor Heilsversprechungen in Acht nehmen. Auch sollten wir uns vor Illusionen schützen. Sicherlich wird Genom-Editierung nicht das einzige Rezept sein, um die globale Ernährung sicherzustellen. Vielleicht kann sie aber einmal einen Beitrag leisten.
STANDARD: Was versprechen Sie sich vom Einsatz genetischer Methoden wie Gene-Drive, um Krankheiten wie Malaria zu bekämpfen?
Ranisch: Gene-Drive wird auch gerne als Vererbungsturbo bezeichnet, weil dadurch eine bestimmte genetische Veränderung über mehrere Generationen erhalten bleibt. Auf dem Papier lädt das zu wunderbaren Planspielen ein, damit etwa Stechmückenpopulationen auszurotten und somit Malaria zu bekämpfen. Gene-Drive könnte auch nützlich sein, wenn man eingeschleppte Tierarten wieder loswerden will. Wichtig ist dabei, zu sehen, dass Gene-Drive-Technologien einen sehr invasiven Eingriff in komplexe Systeme darstellen. Es bedürfte daher einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse. Fairerweise muss man auch sagen: Ein effektiver Weg, um Malaria zu bekämpfen, sind beispielsweise auch Moskitonetze. Zudem brauchte es vor der Anwendung ernsthafte Bemühungen, die lokal betroffene Bevölkerung in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Man muss gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, und diese kann auch sein: Nein, solche Eingriffe sind zu risikoreich oder schlicht unerwünscht.
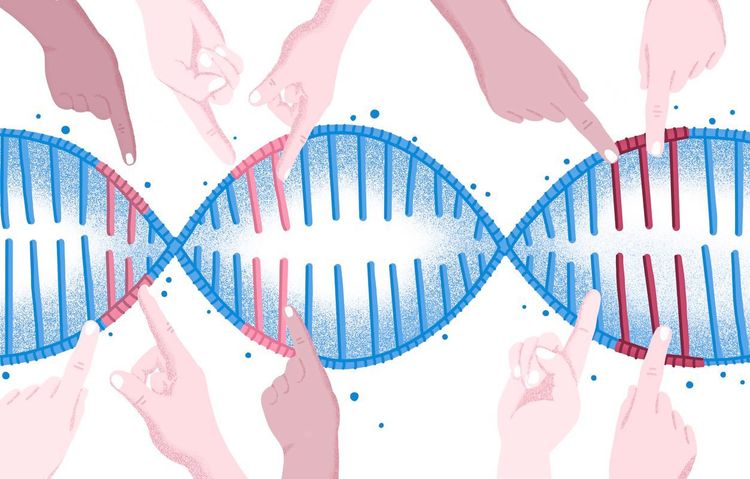
STANDARD: Wissen die Menschen überhaupt ausreichend über Genom-Editierung Bescheid, um sich an solchen Debatten beteiligen zu können?
Ranisch: Bereits für Deutschland zeigen Umfragen, dass nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung etwas mit dem Wort Genom-Editierung anfangen kann, noch weniger mit CRISPR. Dabei haben wir es mit einer Technologie zu tun, die invasiv in unsere Lebenswelt dringen könnte – sei es durch das, was auf unsere Teller gelangt, durch Tiere und die Umwelt oder die zukünftige Medizin. Wir müssen daher sehr sorgsam vorgehen, ein reiner Expertendiskurs reicht nicht aus. Es braucht eine breit angelegte Debatte. Wir müssen Sorgen ernst nehmen, aber zugleich auch einen kühlen Kopf bewahren. CRISPR und Co sind erstaunliche Werkzeuge, erzeugen trotz aller Versprechen aber auch Ängste. Genom-Editierung wird uns weder alle töten noch erlösen. Da bin ich mir recht sicher. (Tanja Traxler, 19.2.2020)