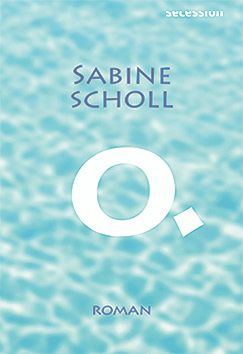Die Stimme auf dem Helmholtzplatz ist kräftig. Sie trägt ein rotes T-Shirt, eine schwarze Sporthose und hört nicht auf zu schreien. Pendelt zwischen Park und Gehsteig, der ihre Bühne bildet, hin und her. Das Publikum spricht französisch, englisch, spanisch, italienisch. Es ist ein lauer Abend. Es könnte schön sein. Dazukommende greifen sich leere Stühle und reihen sie nebeneinander auf. Holen Getränke – natürlich herrscht Selbstbedienung – und bemühen sich nicht zuzuhören.
Die Gäste plaudern, drehen Zigaretten und rauchen. Tun, als würde die Stimme nicht stören, obwohl sie nervtötend laut brüllt. Beharrlich wandert sie vom Gehsteig zum Park, vom Park zum Gehsteig, tritt zuweilen näher an die Gäste, erwartet jedoch keine Antwort. Sie will bloß wahrgenommen sein und zeigen, dass sie hier ist. Immer noch.
Genug Wohnungen
Doch alle haben sich darauf geeinigt, dass nichts diesen Abend beeinträchtigen soll, diesen Sommerabend, von dem alle in monatelangen Berliner Wintern träumen. Die Stimme schreit zwar auch in der Kälte, aber hinter geschlossenen Fenstern tönt sie nur leise, schlittert über abgeschliffene Parkette und verebbt in Richtung Bad.
Die Anwohner haben jahrelang dafür gekämpft, dass der Park jetzt ihnen gehört. Haben am hölzernen Piratenschiff für den Spielplatz mitgebaut. Die Anwohner sieben abends den Sand, befreien ihn von Spritzen, Kippen, Pisse und Kot. Auf den Mäuerchen jedoch sitzt stets die Stimme mit ihren Kameraden und öffnet noch ein Bier. Schreien macht Durst. Solange die Stimme den Flaschenhals zwischen ihren Lippen hält und schluckt, schweigt sie für einen kurzen, friedlichen Moment. Aber die Stimme gibt nicht auf.
Sie erinnert daran, dass dieser Platz einmal voller heruntergekommener Häuser war, um die sich keiner kümmerte. Denn Häuser gab es ohnehin genug. Wohnungen gab es genug. Man konnte sie wechseln, so oft man wollte. Die Stimme war damals schon hier, traf sich mit anderen Verlorenen, um zu trinken.
Eine andere Zeit
Jetzt aber herrscht eine andere Zeit. Auch ich sitze auf einem Stuhl im Freien und versuche die Stimme zu überhören. Vergeblich. Als ich noch in Chicago wohnte, schrien die Obdachlosen hinterm Haus in mehreren Stimmen gleichzeitig. Als ich in New York wohnte, sprachen die Stimmen meist puerto-ricanisches Spanisch oder afroamerikanisches Englisch.
Stets habe ich in Gegenden vor ihrer Gentrifizierung gelebt, aus Kostengründen, und musste ausziehen, als der Prozess in Gang kam. Mittlerweile zähle ich sogar in Berlin, wohin ich vor 20 Jahren wegen leistbarer Mieten und eines gemächlicheren Fortschreitens des Kapitalismus geflohen war, zu den Übriggebliebenen.
Doch seit ein paar Jahren drehen sich die Unterhaltungen sogar in Berlin – wie zuvor in New York – um Immobilien und Geld. Etwa so: "Damals in der Soundsostraße hat der Quadratmeter nur soundsoviel gekostet. Da hätten wir zugreifen sollen. Dafür bezahlst du heute dreimal so viel. Wie hätten wir das wissen sollen! Damals. Wir waren Snobs. Wohnungssnobs. Es gab immer noch was Besseres. Nun sitzen wir fest."
Probe kochen und putzen
Diejenigen, die zur richtigen Zeit genügend Geld aufbringen konnten, kreditwürdig waren oder Eltern mit Geld hatten, müssen sich um ständig steigende Preise nicht kümmern. Diejenigen, die nicht rechtzeitig vorgesorgt haben, können nicht mehr umziehen, sind zur Unbeweglichkeit verdammt und müssen zurechtkommen mit dem, was sie haben, oder nicht.
Die Zeitschrift des Mietervereins bringt Tipps zur Teilung von Zimmern, wenn Nachwuchs droht, und informiert über rechtliche Grundlagen der Untervermietung, wenn der Nachwuchs auszieht. Denn eine den geänderten Lebensumständen angepasste Wohnung zu finden, ist mittlerweile unmöglich.
Meine Bekanntschaften sind in zwei Gruppen zerfallen. Die einen haben finanzielle Unterstützung durch Familie und Partner, können hohe Mieten zahlen oder haben längst Eigentum erworben, als es noch halbwegs leistbar war. Die Kaufpreise haben sich seit 2004 nahezu verdreifacht. Allein von 2017 bis 2018 stiegen sie um 20 Prozent. Berliner ohne Rücklagen jedoch müssen einen immer größeren Anteil ihres monatlichen Einkommens fürs Wohnen aufwenden. Zwischen 2004 und 2019 haben sich die Mieten bei Neubezug nahezu verdoppelt.
Teure WG-Zimmer
Diese Misere trifft auch Studentinnen und Praktikanten, die mehr und mehr für ein WG-Zimmer bezahlen. Neben dem Vorstellungsgespräch und einem finanziellen Check-up müssen sie manchmal sogar Probe kochen und Probe putzen, werden bewertet, gereiht und wieder weggeschickt. Agenturen verdienen Geld mit ihrer Not. Dass die Stadt günstig für Künstler sei, weil es genügend und preiswerten Raum gebe, finden nur mehr die aus teureren Städten, wie New York und London, Zuziehenden.
Derartige Änderungen lassen sich sogar am Warenangebot des Ladens gegenüber unserem Wohnhaus ablesen. Als wir einzogen, waren Obst, Gemüse, türkische Konserven, Jog hurt, Fladenbrot und Getränke im Angebot. Mittlerweile dient das Obst eher dekorativen Zwecken. Als Horden von Feierwilligen durch die Kastanienallee zu ziehen begannen, nahmen alkoholische Getränke immer mehr Raum ein, Kühlvitrinen mit Bier und Wein wurden aufgestellt.
Dazu stehen teure Tees, Müsli, Biomilch in den Regalen. Dann kam die Theke mit Zigaretten und Tabak. Gemüse gibt es kaum mehr, dafür sorgfältig aufgetürmte Berge von Bierspezialitäten. Kaufe ich eine Flasche, bietet der Verkäufer an, sie sofort zu öffnen. Guter Service. Das berühmte Berliner Wegbier. Die Qualität des Obstes hingegen hat nachgelassen.
Wohnen im Container
Doch nicht nur Künstler ächzen, auch Kleinbetriebe, Mittelständler mit geringem Einkommen, die Familie haben oder eine gründen wollen. Handwerker, die in der Gegend angesiedelt sind, gibt es nicht mehr. Bauarbeiter kommen aus Polen und Rumänien, wohnen in Containern und fahren am Wochenende nach Hause.
Handwerker reisen in aller Frühe aus Brandenburg an. Alle arbeiten an der Vermehrung des Betongolds in einem Zeitalter, in dem Wohnungen keine Lebensräume für Menschen mehr sind, sondern Vermögenswerte, wie Aktien, mit denen spekuliert wird, um möglichst hohen Ertrag zu erzielen.
Neben sich dämlich verdienenden Immobilienentwicklern und -maklern sind neue Berufe entstanden: Die Wohnungsschätzer mit Flyern aus Hochglanzpapier, die Ahnungslosen ihre Wohnungen abknöpfen und teurer weiterverkaufen wollen. Die Wohnungsbühnenbauer, die eine Immobilie so einrichten, dass sie verlockender aussieht, als sie ist, und dadurch höhere Preise erzielt. Nicht zu reden von den Betreuern und Putzern der Ferienapartments, die den Wohnungsmarkt zusätzlich leerfegen.
Lärm, Geruch und Pisse
Dass die Verhältnisse schwierig sind, wurde mittlerweile auch den Berliner Behörden klar. Aber zu lange war man damit zufrieden, dass überhaupt gebaut wird. Vorwiegend jedoch im höheren Preissegment. Hinter dem Hauptbahnhof zum Beispiel werden ganze Stadtteile hochgezogen. Zitadellen der Reichen bilden sich her aus. Damit verschärfen sich Gegensätze.
Der mit 1. Februar 2020 eingeführte Mietendeckel wird das Unausweichliche bloß hinauszögern und nötige Reparaturen, die vom Vermieter zu tragen sind, einschränken. Unser vor 30 Jahren billig saniertes Haus kommt indessen weiter herunter. Nur das Allernotwendigste wird ausgebessert. Und weil wir in einem inzwischen als Gastronomiegebiet ausgewiesenen Viertel wohnen, dürfen sich Mieter nicht über Lärm, Geruch und Pisse im Treppenhaus auf regen, wie uns die Besitzerin des Cafés im Erdgeschoß erklärt. Sie hat mehr Rechte.
Die junge Mutter im vierten Stock mit mittlerweile drei Kindern erzählt, dass sie bei ihrer Wohnungssuche vor zwei Jahren das Büro der Hausverwaltung 15-mal mit Baby am Arm aufgesucht hat, die Verwalterin anflehte und ihr so lange auf die Nerven ging, bis sie die Wohnung bekam. Es gab 200 Mitbewerber. Die Wohnung ist weder billig noch in einem akzeptablen Zustand. Die nötigen Renovierungen bezahlte sie aus eigener Tasche.
Party rund um die Uhr
Eine Familie zu gründen ist in dieser Gegend schwierig. Dafür konzentrieren sich hier immer mehr junge Kurzzeitbewohner aus aller Welt, die nach Berlin kommen, um vor allem Spaß zu haben. Die Stadt ist zu einer Vergnügungsmaschine für Menschen geworden, die im Grunde nie erwachsen werden wollen. Klar, dass die Party rund um die Uhr geht und dabei entsprechenden Krach verbreitet.
Meine über achtzigjährige rüstige Nachbarin ist weit und breit die Einzige ihrer Art. Sie kann sich die Wohnung leisten, weil sie bereits zu DDR-Zeiten eingezogen ist. Regelmäßig unterhalten wir uns im Treppenhaus vor den Briefkästen oder zwischen überquellenden Mülltonnen.
"Da hieß es, im Osten war alles schlechter, aber jetzt sind wir schon so lange in dem neuen System, und es ist auch nicht besser!", kommentiert sie den desolaten Zustand des Hauses. "Den Rohrbruch im Keller haben sie zwar repariert, aber drei Tage später war das wieder hin. Alles Pfusch!"
Reporterin vor der Wohnungstür
Sie trägt Staubmantel, Perücke, Hut, Halstuch, Handtasche, Pumps, wenn sie ausgeht. Kittelschürze, Kopftuch und Wolljacke, wenn sie zu Hause bleibt. Im Erdgeschoß gab es früher einen Friseur, bei dem sie sich die Haare machen ließ und so von einer freien Wohnung erfuhr. Jemand war in den Westen abgehauen und hatte alles zurückgelassen. Ihr Verlobter ging zum Amt. Dort fragten sie nach Kindern, wegen der Berechtigung. "Dabei waren wir noch nicht mal verheiratet", kichert die Nachbarin.
Doch es klappte. Nun wohnt sie nach dem Tod ihres Mannes allein, hält per Handy Kontakt zu den Kindern. Sie ist nervös in letzter Zeit. Zu viele Menschen laufen durchs Haus, läuten unten, halten sich im Hof auf, suchen nach Pfandflaschen. Sie kennt nur wenige Nachbarn, denn niemand bleibt lang. Blickt sie vom Halbparterre aus dem Fenster, ist sie von der Straße aus gut sichtbar.
"Man weiß nie, was passiert", meint sie. "Einmal, da schaue ich hinaus, und eine junge Frau winkt, will sich mit mir unterhalten. Ein paar Tage darauf läutet es, dann steht plötzlich diese Reporterin vor der Wohnungstür, hinter ihr ein Mann mit laufender Kamera. ‚Dürfen wir reinkommen und Sie filmen? Erzählen Sie uns, wie es damals in Ostberlin war?‘" Empört wies sie die Eindringlinge ab.
Fremde gegen Fremde
Die alte Dame steht für eine verloren gegangene Ära am Prenzlauer Berg, ist die letzte Überlebende einer legendären Stadtlandschaft. So wie die mit Graffiti überzogenen Durchgänge und Treppenhäuser im Hirschhof, dessen Bewohner täglich damit rechnen müssen, dass das Haus zur Sanierung und Kapitalvermehrung freigegeben wird.
Im grün wuchernden Hinterhof, wo noch Reste von Dissidenz gegen das DDR-Regime spürbar sind, finden bereits Revierkämpfe von Fremden gegen Fremde statt. Der Amerikaner vom vollsanierten Haus gegenüber beugt sich über den Zaun und beschimpft eine Gruppe von Spanisch Sprechenden, die auf einem aus Paletten gebauten Lagerfeuer Steaks grillen. "Müsst ihr jeden Tag so ein Feuer machen? Überall Rauch. Das stört mich. Hört auf damit!"
Sie lassen sich nicht abhalten. Es ist heiß. Die Party geht weiter. Doch möglicherweise kippt das Ganze ohnehin bald. Wenn dann alles zu teuer wird, die Feierwütigen Nachwuchs haben und ihren städtischen Vergnügungsraum fliehen, werden die Superreichen einziehen und sich gesamte Etagen zu Apartments ausbauen lassen.
Wo vorher 30 Parteien wohnten, gibt es dann nur mehr drei. So stand es kürzlich in einem Artikel über das gentrifizierte Greenwich Village in New York zu lesen, wo der Prozess, der nun Berlin erfasst, bereits vor mindestens 20 Jahren eingesetzt hat. Dann werden auf der Kastanienallee nur mehr Putz- und Pflegekräfte, Lieferanten, Chauffeure und Personenschützer sichtbar sein.
Laute Stimmen sind dann für immer verklungen. Geld schreit nicht. (Sabine Scholl, 23.2.2020)